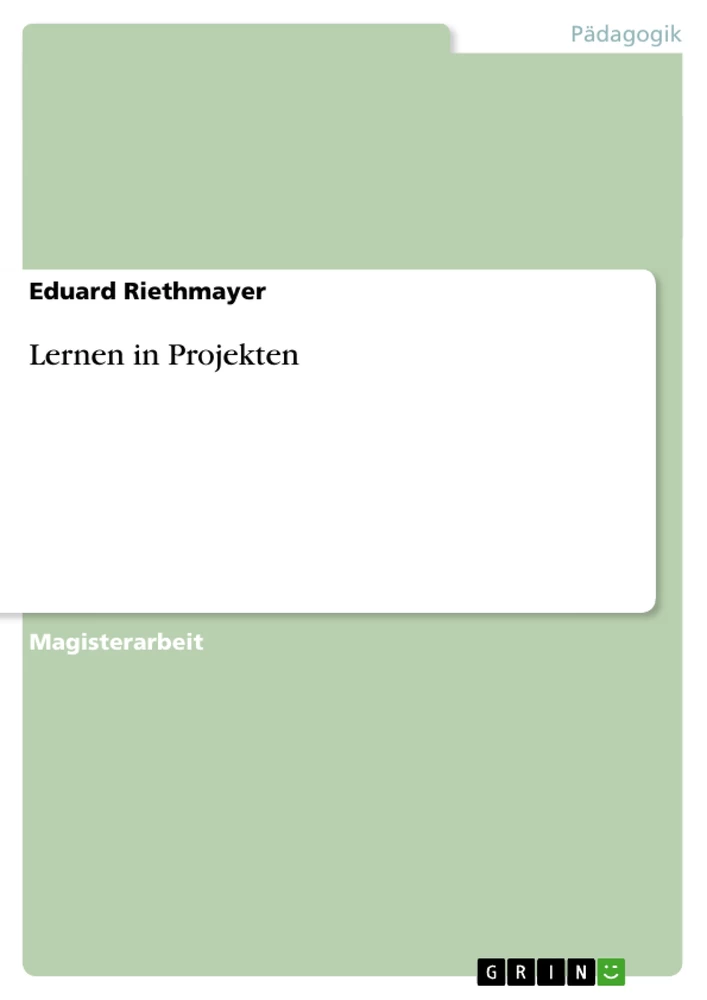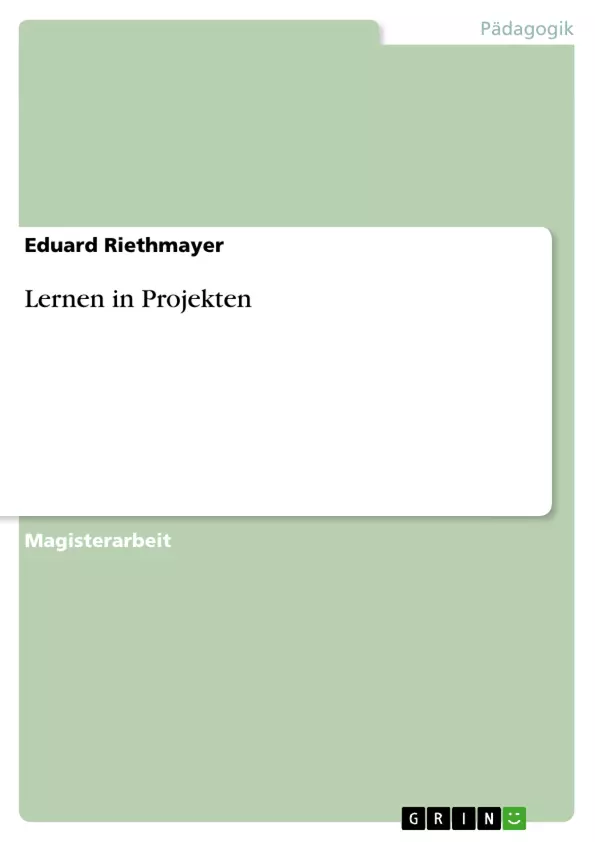Eine theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen zum Projektunterricht in ihrer Beziehung zu aktuellen Tendenzen der Schulreform. Begründet wird das Lernen in Projekten durch Aussagen der Allgemeinen Didaktik, der Handlungstheorie, der Selbstwirksamkeitstheorie und der Kognitionspsychologie. Es ist das Ziel dieser Arbeit, der Diskussion um die Unterrichtsreform und insbesondere um eine ihrer tragenden Säulen, der Projektmethode, eine auf die pädagogische Arbeit in der Institution Schule bezogene Basis zu schaffen. Dazu dient auch eine kritische Analyse der unreflektierten Verwendung des Projektbegriffs durch die aktuelle Bildungsreform.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Projekt?
- Die Verwendung des Begriffs „Projekt“
- Didaktische Einordnung
- Projekte mit dem Ziel der Herstellung gegenständlicher Produkte
- Projekte mit dem Ziel „nützlichen“ Orientierungs- und Handlungswissens
- Projekte als fächerübergreifendes Lernen an einem Thema im Unterricht
- Projekte als auf besondere Weise schülerzentriert gestalten Lehrgangsunterrichts
- Projekte als Methode handlungsorientierten Unterrichts im Rahmen eines umfassenden, philosophisch begründeten Erziehungskonzepts
- Projekte als universelles Modell für den Unterricht
- Projekt als pädagogisches Experiment
- Projekt als aktionistisches Modell
- Projektmethode als bildungstheoretisch begründetes Modell
- Gesellschaftliche Begründung für das Lernen in Projekten
- Symptome einer veränderten gesellschaftlichen Basis für den Bildungsauftrag der Schule
- Krise der Erfahrungsmöglichkeiten
- Krisen der Kindheit und des sozialen Verhaltens
- Krise der Schule
- Veränderungen in der beruflichen Ausbildung und Praxis
- Lernen durch Konstruktion
- Wissen
- Netzwerke des Wissens
- Bedeutung des bereichsspezifischen Wissens
- Die Sinnlosigkeit einer rein formalen Bildung
- Aufbau bereichsspezifischen Wissen durch exemplarisches Lernen
- Intelligentes Wissen vermitteln – die primäre Aufgabe der Schule
- Handeln
- Selbstwirksamkeitstheorie
- Projektunterricht und institutionelles Lernen in der Schule
- Projekte planen und durchführen
- Projektinitiative
- Auseinandersetzung mit der Projektinitiative in einem vorher vereinbarten Rahmen
- Plan zur Problemlösung entwickeln – kooperative Planung
- Handlungsorientierte Auseinandersetzung
- Problemlösung reflektieren
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik des Lernens in Projekten und untersucht die didaktischen, gesellschaftlichen und pädagogischen Aspekte dieser Unterrichtsform. Ziel ist es, die Relevanz von Projekten für den Bildungsauftrag der Schule aufzuzeigen und deren Potenzial zur Förderung von Selbstständigkeit, Handlungskompetenz und kritischem Denken zu beleuchten.
- Didaktische Einordnung und verschiedene Konzeptionen der Projektmethode
- Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den Bildungsauftrag der Schule
- Lernen durch Konstruktion und die Bedeutung bereichsspezifischen Wissens
- Selbstwirksamkeitstheorie und deren Implikationen für den Projektunterricht
- Planung und Durchführung von Projekten im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den aktuellen Kontext der Bildungsreformen und den Einfluss von Studien wie PISA auf die Diskussion um die Bedeutung von Projekten im Unterricht. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Projekt“ und untersucht die vielfältigen Konzeptionen der Projektmethode im schulischen Kontext. Dabei werden unterschiedliche Ziele und Schwerpunkte der Projektarbeit beleuchtet, wie z.B. die Herstellung von Produkten, die Vermittlung von Orientierungs- und Handlungswissen sowie die Förderung von fächerübergreifendem Lernen.
Kapitel drei widmet sich der gesellschaftlichen Begründung für das Lernen in Projekten. Es werden die Symptome einer sich verändernden gesellschaftlichen Basis für den Bildungsauftrag der Schule, die Krise der Erfahrungsmöglichkeiten, die Krisen der Kindheit und des sozialen Verhaltens sowie die Krise der Schule selbst analysiert. Darüber hinaus werden die Veränderungen in der beruflichen Ausbildung und Praxis im Hinblick auf die Anforderungen an die Bildungslandschaft beleuchtet.
Kapitel vier widmet sich dem Konzept des Lernens durch Konstruktion und dessen Bedeutung für den Projektunterricht. Es werden die Netzwerke des Wissens, die Bedeutung des bereichsspezifischen Wissens und die Sinnlosigkeit einer rein formalen Bildung thematisiert. Außerdem wird der Aufbau von bereichsspezifischem Wissen durch exemplarisches Lernen diskutiert und die Rolle der Schule als Vermittlerin von intelligentem Wissen hervorgehoben.
Kapitel fünf behandelt die Rolle des Handelns im Lernprozess und die Bedeutung von Selbstwirksamkeit für den Erfolg von Projekten. Es werden die zentralen Aussagen der Selbstwirksamkeitstheorie vorgestellt und deren Implikationen für den Projektunterricht im schulischen Kontext diskutiert.
Kapitel sechs widmet sich den Aspekten des institutionellen Lernens im Rahmen von Projekten. Es werden die Herausforderungen der Integration von Projekten in die Strukturen der Schule beleuchtet und die Chancen, die Projektarbeit für die Förderung von Selbstständigkeit, Handlungskompetenz und kritischem Denken bietet, aufgezeigt.
Kapitel sieben beschäftigt sich mit der Planung und Durchführung von Projekten in der Schule. Es werden verschiedene Phasen des Projektprozesses, wie die Projektinitiative, die Auseinandersetzung mit der Projektinitiative, die Planung, die handlungsorientierte Auseinandersetzung und die Reflexion der Problemlösung, detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Lernen in Projekten, Projektmethode, Bildungsauftrag, Selbstständigkeit, Handlungskompetenz, kritisches Denken, gesellschaftliche Veränderungen, Konstruktion, Wissen, Selbstwirksamkeitstheorie, institutionelles Lernen, Planung, Durchführung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Lernens in Projekten?
Ziel ist die Förderung von Selbstständigkeit, Handlungskompetenz und kritischem Denken durch eine schülerzentrierte, fächerübergreifende Unterrichtsform.
Welche Phasen umfasst ein typisches Schulprojekt?
Ein Projekt gliedert sich in Projektinitiative, kooperative Planung, handlungsorientierte Durchführung und die abschließende Reflexion der Problemlösung.
Warum wird Projektunterricht gesellschaftlich begründet?
Aufgrund einer "Krise der Erfahrungsmöglichkeiten" und veränderter Anforderungen in der Berufswelt, die mehr als nur reines Faktenwissen verlangen.
Was besagt die Selbstwirksamkeitstheorie im Kontext von Projekten?
Sie besagt, dass Schüler durch das erfolgreiche Bewältigen komplexer Projektaufgaben Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten gewinnen, was den Lernerfolg nachhaltig steigert.
Was ist der Unterschied zwischen formaler Bildung und intelligentem Wissen?
Intelligentes Wissen ist bereichsspezifisch und anwendbar, während rein formale Bildung oft träges Wissen bleibt, das in realen Situationen nicht genutzt werden kann.
- Citar trabajo
- M.A. Eduard Riethmayer (Autor), 2007, Lernen in Projekten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80916