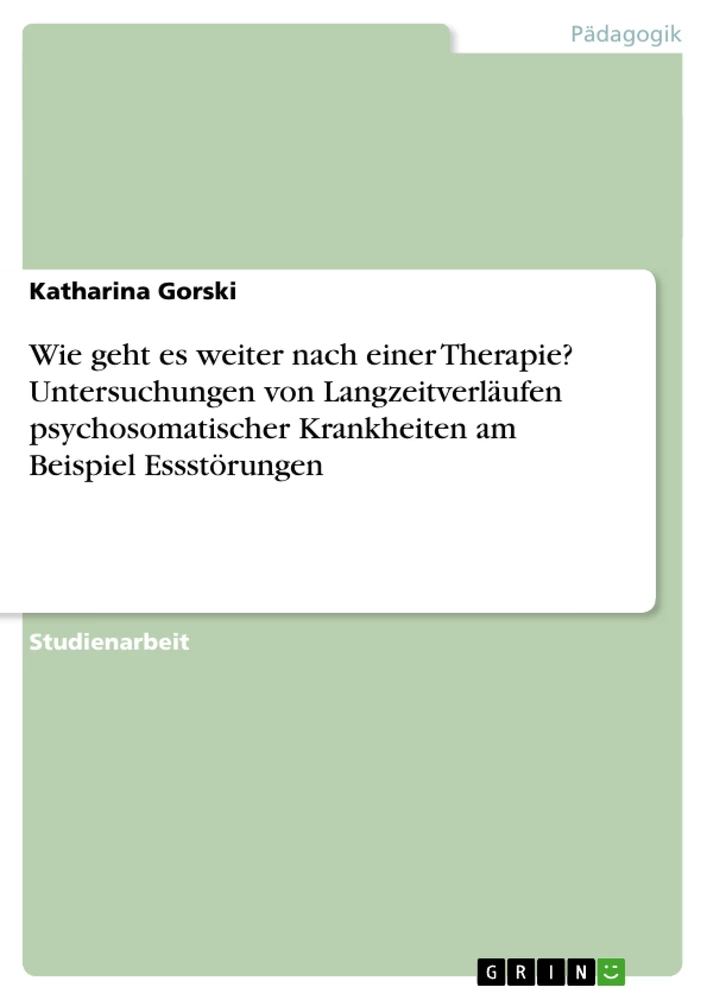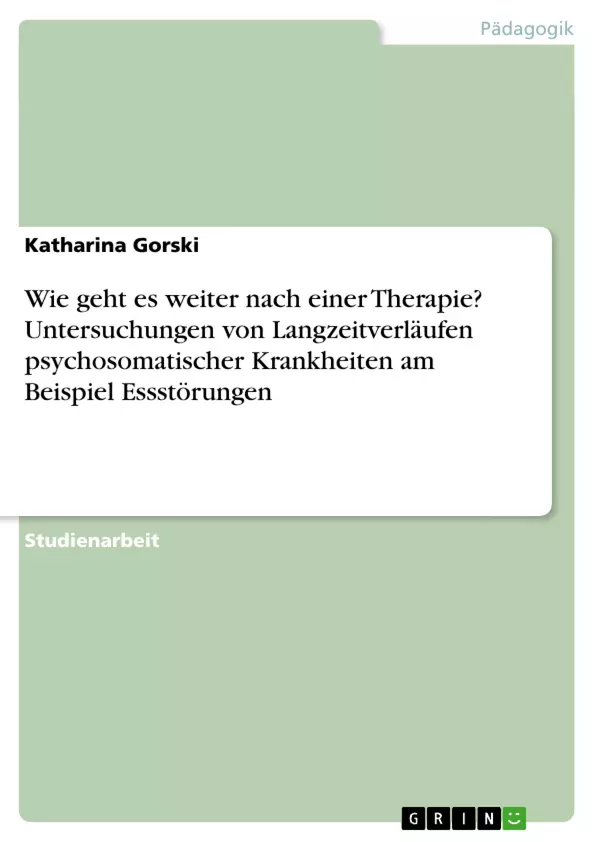Psychosomatische Krankheiten, insbesondere Essstörungen, haben in der Regel einen langen Verlauf. Doch meist sind Therapien viel kürzer als notwendig. In der Regel haben diese eine Dauer von zwei bis sechs Monaten, eine Essstörung kann jedoch über Therapieverfahren hinaus über viele Jahre andauern.
Diese Arbeit wird sich nach einer Einführung in die Thematik damit befassen, wie Daten zu Langzeitverläufen erhoben werden, welche Krankheitssymptome nach einer Therapie noch festzustellen sind, wie das soziale Leben ehemaliger PatientInnen aussieht etc. Bezug genommen wird hierbei auf eine Studie von Deter und Herzog aus dem Jahre 1995.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema Essstörungen
- Was sind Essstörungen und wie werden sie behandelt?
- Wie geht es weiter nach einer Therapie? Langzeitverläufe von Essstörungen
- Katamnese psychiatrischer und psychosomatischer Krankheiten
- Probleme bei der Datenerhebung
- Studien und ihr Untersuchungsablauf
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Studien
- Somatische Befunde
- Mortalität
- Sozialleben
- Psychosoziale Befunde
- Ergebnisse der Studie von Deter und Herzog (1995)
- Erklärungen für positive und negative Krankheitsverläufe
- Maßnahmen zur Unterstützung eines positiven Krankheitsverlaufs
- Das Beispiel der ambulanten psychosomatischen Nachsorge
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Langzeitverlauf von Essstörungen nach Beendigung einer Therapie. Sie untersucht, wie Daten zu Langzeitverläufen erhoben werden, welche Symptome nach der Therapie noch bestehen und wie sich das soziale Leben ehemaliger PatientInnen entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung einer Studie von Deter und Herzog (1995).
- Datenerhebung und -analyse zu Langzeitverläufen von Essstörungen
- Analyse der Krankheitssymptome nach Beendigung der Therapie
- Untersuchung des sozialen Lebens ehemaliger PatientInnen
- Bedeutung der Nachsorge für den Krankheitsverlauf
- Erklärungen für positive und negative Langzeitverläufe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der Langzeitverläufe von Essstörungen ein und erläutert die Problematik der kurzen Therapiedauer im Vergleich zur Dauer der Erkrankung. Die Arbeit zielt darauf ab, Daten zu Langzeitverläufen zu analysieren und die Auswirkungen auf das soziale Leben ehemaliger PatientInnen zu untersuchen.
- Einführung in das Thema Essstörungen: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Formen von Essstörungen, ihre Entstehung und Behandlung. Es wird auf die Bedeutung der Diagnose und des Therapieplans für den weiteren Krankheitsverlauf hingewiesen.
- Wie geht es weiter nach einer Therapie? Langzeitverläufe von Essstörungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Datenerhebung zu Langzeitverläufen und stellt verschiedene Studien und deren Ergebnisse vor. Es werden sowohl somatische als auch psychosoziale Befunde analysiert, wobei die Studie von Deter und Herzog (1995) als Beispiel dient.
- Maßnahmen zur Unterstützung eines positiven Krankheitsverlaufs: Dieses Kapitel befasst sich mit Maßnahmen, die einen positiven Langzeitverlauf unterstützen können. Es wird das Beispiel der ambulanten psychosomatischen Nachsorge vorgestellt.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Langzeitverläufe, Katamnese, psychosomatische Erkrankungen, Therapie, Nachsorge, Studien, soziale Integration, psychosoziale Befunde, somatische Befunde, Mortalität, Deter und Herzog (1995).
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauern Essstörungen im Vergleich zur Therapiezeit?
Während Therapien oft nur zwei bis sechs Monate dauern, können Essstörungen über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg andauern.
Was untersucht die Studie von Deter und Herzog (1995)?
Die Studie analysiert Langzeitverläufe von Essstörungen, inklusive somatischer Befunde, Mortalität und der psychosozialen Integration ehemaliger Patienten.
Welche Symptome bleiben nach einer Therapie oft bestehen?
Die Arbeit beleuchtet verbleibende Krankheitssymptome und untersucht, inwieweit das Essverhalten und die psychische Stabilität langfristig beeinträchtigt bleiben.
Warum ist die ambulante Nachsorge so wichtig?
Nachsorgemaßnahmen unterstützen einen positiven Krankheitsverlauf und helfen dabei, Rückfälle zu vermeiden und die soziale Reintegration zu fördern.
Was ist eine Katamnese?
Eine Katamnese ist die nachträgliche Untersuchung des Krankheitsverlaufs nach Abschluss einer Behandlung, um den langfristigen Heilerfolg zu bewerten.
- Citation du texte
- Katharina Gorski (Auteur), 2006, Wie geht es weiter nach einer Therapie? Untersuchungen von Langzeitverläufen psychosomatischer Krankheiten am Beispiel Essstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81021