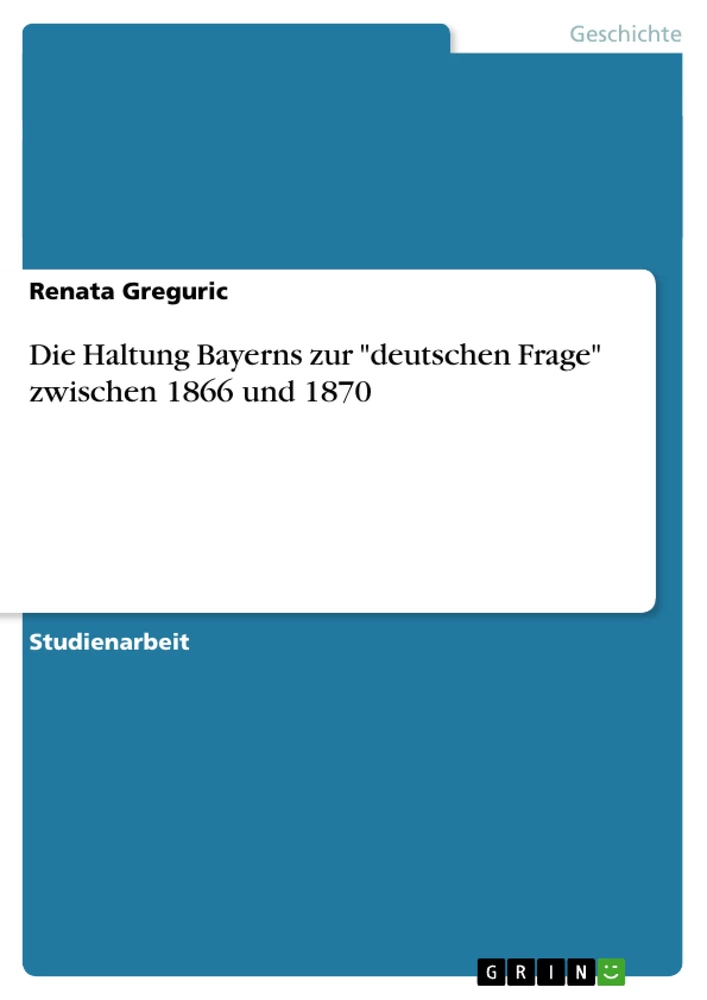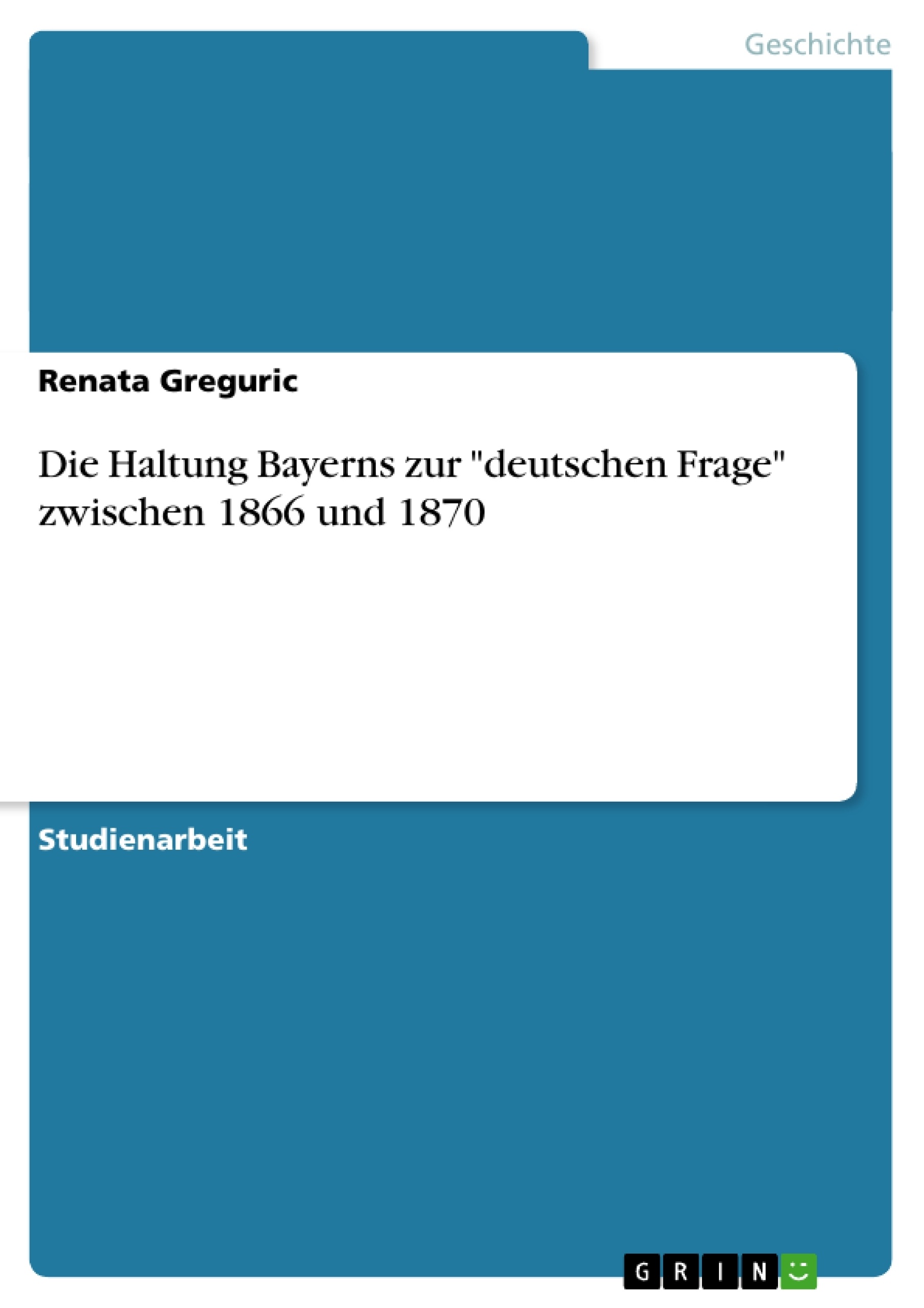Noch in der Schlacht von Königgrätz 1866 stand Bayern an der Seite Österreichs preußischen Truppen gegenüber. Vier Jahre später kämpfte die gleiche bayerische Armee unter dem Oberbefehl Preußens gegen die Franzosen; mehr noch, der Staat Bayern trat per Vertragsabschluss am 23. November 1870 der neu formierten Deutschen Bundesverfassung bei. Ludwig II. selbst regte die übrigen Fürsten dazu an, dem in diesem neuen Bündnis mit den Präsidialrechten ausgestatteten König Wilhelm I. von Preußen die Kaiserwürde anzutragen.
Offenbar hat sich innerhalb dieses Zeitrahmens die Haltung Bayerns zur Frage einer deutschen Einheit, die bereits seit Jahrzehnten diskutiert und verhandelt worden ist, verändert. Es stellt sich die Frage, wie eine solche Entwicklung innerhalb recht kurzer Zeit vonstatten gehen konnte, bzw. wie die Überwindung der offensichtlichen politischen Gegensätze zwischen Preußen und Bayern motiviert sein konnte.
Ferner ist von Interesse, worin genau eine Veränderung festzustellen ist und ob sie tatsächlich stattgefunden hat, sofern man von der offiziellen Haltung ausgeht. Landesintern herrschte indessen eine lebhafte Kontroverse über einen möglichen Anschluss an den nach 1866 gebildeten Norddeutschen Bund.
Die folgende Arbeit befasst sich mit diesen Fragen und Aspekten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie etwa der außen- und innenpolitischen Lage Bayerns, seiner wirtschaftlichen Bindungen, der herrschenden öffentlichen Meinung und der individuellen Interessen von Einzelpersonen oder Gruppierungen.
Jeder einzelne Faktor spielt innerhalb dieses Zeitraumes mit unterschiedlicher Gewichtung eine Rolle für die offizielle Haltung des Staates zur „deutschen Frage“, da sie sich erst aus dem Zusammenwirken aller heraus konstituiert.
Es wird sich zeigen, dass eine bestimmte Konstellation der Gegebenheiten dazu geführt hat, die Aufnahme der Verhandlungen im November 1870 in Versaille quasi unausweichlich zu machen. Der Bei-tritt in den neuen deutschen Bund erfolgte dem-nach nicht aus unvoreingenommener Überzeugung; er entsprang vielmehr einem Mangel an realistischen Alternativen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schlacht bei Königgrätz und ihre Konsequenzen für Bayern
- Die Auflösung des Deutschen Bundes
- Der Prager Friede und die Idee vom Südbund
- Die geheimen Schutz- und Trutzbündnisse
- Die verschleppte Reform der Wehrverfassung
- Erörterung über die Möglichkeit bayerischer Souveränität
- Gefahren von Außen: Die Luxemburg-Krise
- Das Druckmittel Zollverein
- Innenpolitische Interessenskonflikte
- Die Parteienlandschaft
- Der Ministerwechsel
- Die Haltung Ludwigs II.
- Zusammenfassende Überlegungen zu den Beitrittsverhandlungen
- Die einigende Wirkung des deutsch-französischen Krieges
- Bismarcks Verhandlungsstrategien
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Fuẞnoten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der bayerischen Haltung zur "deutschen Frage" zwischen 1866 und 1870, einem Zeitraum, der durch die Auflösung des Deutschen Bundes, die Folgen des Krieges von 1866 und die Bildung des Norddeutschen Bundes geprägt war. Im Zentrum steht die Frage, wie sich Bayern von einem Verbündeten Österreichs zu einem Mitglied des neu gegründeten Deutschen Bundes entwickelte.
- Die Auswirkungen der Schlacht bei Königgrätz auf die politische Landschaft Deutschlands und insbesondere auf Bayern.
- Die innenpolitische Debatte um die deutsche Einheit und die Rolle der verschiedenen politischen Gruppierungen in Bayern.
- Die außenpolitischen Beziehungen Bayerns zu Preußen, Österreich und anderen europäischen Mächten.
- Die Rolle der wirtschaftlichen Beziehungen und die Bedeutung des Zollvereins.
- Die Persönlichkeit und die Politik des bayerischen Königs Ludwig II. im Kontext der "deutschen Frage".
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet den historischen Kontext der "deutschen Frage" sowie die Ausgangssituation Bayerns im Jahr 1866. Der Fokus liegt auf der Schlacht bei Königgrätz und ihren Folgen für Bayern, insbesondere der Auflösung des Deutschen Bundes und der Entstehung des Norddeutschen Bundes.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Erörterung über die Möglichkeiten bayerischer Souveränität. Es werden die Gefahren von außen, insbesondere die Luxemburg-Krise, sowie die innenpolitischen Interessenskonflikte und die Rolle des Zollvereins beleuchtet.
Im dritten Kapitel werden die innenpolitischen Interessenskonflikte in Bayern im Kontext der "deutschen Frage" genauer betrachtet. Es wird die Parteienlandschaft, der Ministerwechsel und die Haltung von König Ludwig II. analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Beitrittsverhandlungen und der Entscheidung Bayerns, dem Deutschen Bund beizutreten. Es wird die einigende Wirkung des deutsch-französischen Krieges, Bismarcks Verhandlungsstrategien und das Fazit der Beitrittsverhandlungen behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: "deutsche Frage", "Bayern", "Königgrätz", "deutscher Bund", "Norddeutscher Bund", "Preußen", "Österreich", "Ludwig II.", "Zollverein", "Bismarck", "innenpolitik", "außenpolitik", "deutsche Einheit", "Souveränität".
- Citation du texte
- Renata Greguric (Auteur), 2005, Die Haltung Bayerns zur "deutschen Frage" zwischen 1866 und 1870, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81259