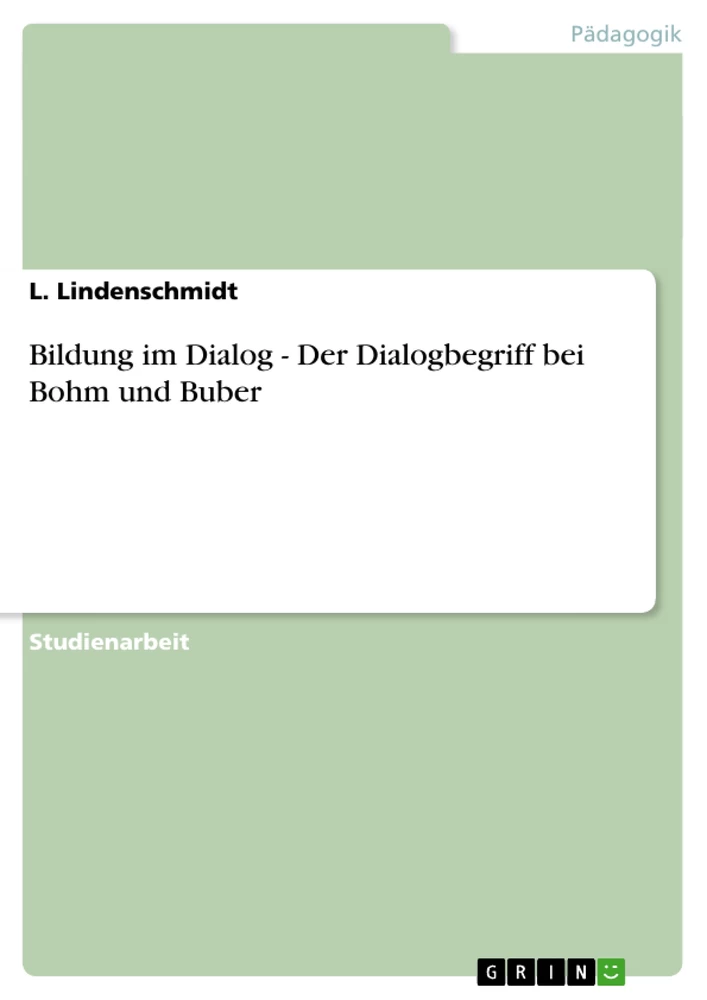Das folgende ausgearbeitete Referat analysiert den Begriff des Dialoges in Verbindung mit Bildung. Dazu werden zunächst die Begriffe »Dialog« und »Bildung« im Allgemeinen definiert, um anschließend explizit auf den Dialogbegriff bei Martin Buber und David Bohm überzuleiten. Die Frage nach vergleichbaren und nach widersprüchlichen Thesen der beiden Wissenschaftler soll beantwortet werden. Desweiteren wird auf die Methodik und Didaktik eingegangen, mit welcher das Thema den Studenten im Seminar »Bildung im Dialog« näher gebracht wurde. Ziel der Referenten war es, das Interesse in Bezug auf den Dialogbegriff zu wecken. Um dies zu erreichen wurde eine offene Diskussion geführt und ein Quiz mit Wettkampfcharakter durchgeführt, welches gleichzeitig als Lernzielkontrolle genutzt wurde. Es wurde zudem angestrebt, die nicht zu unterschätzende Bedeutung des Dialogbegriffes im Hinblick auf menschliches beziehungsweise gesellschaftliches Zusammenleben zu verdeutlichen. Insbesondere David Bohm und Martin Buber sehen im Führen eines Dialogs eine gute Möglichkeit um zwischenmenschliche Differenzen zu beseitigen. Diese Gedanken und Thesen der beiden Wissenschaftler wurden den Kommilitonen vermittelt und leiteten einen diesbezüglichen Denkprozess ein, der teilweise auch zu widersprüchlichen Meinungen und Kritik führte. Die Verbindung der Begriffe »Bildung« und »Dialog« führten im Verlauf des Referats unweigerlich zu weiteren, bis dato ungeklärten Fragen. Kann man im Dialog lernen? Oder lernt man von einem Dialog?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Dialog
- Bildung
- Biographische Daten Martin Bubers
- Zentrale Thesen Bubers
- Biographische Daten David Bohms
- Zentrale Thesen Bohms
- Praktische Umsetzung im Seminar
- Fazit und vergleichende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat untersucht den Begriff des Dialoges im Kontext von Bildung. Es werden die Begriffe "Dialog" und "Bildung" im Allgemeinen definiert und anschließend die Ansätze von Martin Buber und David Bohm zum Dialogbegriff näher beleuchtet. Ziel ist es, vergleichbare und widersprüchliche Thesen der beiden Wissenschaftler herauszustellen und die didaktische Umsetzung des Themas im Seminar "Bildung im Dialog" zu beleuchten. Darüber hinaus soll die Bedeutung des Dialogbegriffes im Hinblick auf menschliches und gesellschaftliches Zusammenleben verdeutlicht werden.
- Definition des Dialogbegriffes
- Martin Bubers Dialogphilosophie
- David Bohms Verständnis von Dialog
- Praktische Umsetzung des Themas im Seminar
- Bedeutung des Dialoges für menschliches und gesellschaftliches Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Zielsetzung des Referats. Der zweite Teil behandelt die Begriffsdefinitionen von "Dialog" und "Bildung" aus unterschiedlichen Perspektiven.
Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Lebensdaten von Martin Buber chronologisch dargestellt, um seine Denkweise und zentralen Thesen zu beleuchten. Kapitel vier präsentiert Bubers Kernideen zum dialogischen Prinzip, insbesondere die Unterscheidung zwischen "Ich-Du-Beziehung" und "Ich-Es-Beziehung".
Kapitel fünf gibt einen Überblick über das Leben des Quantenphysikers David Bohm, während Kapitel sechs seine zentralen Thesen zum Dialogbegriff darstellt. Bohm betrachtet den Dialog als einen kreativen Prozess, der zu Lösungen führt und die Gesellschaft zusammenhält.
Kapitel sieben beschreibt die praktische Umsetzung des Themas im Seminar "Bildung im Dialog", einschließlich der verwendeten Methoden und Medien.
Schlüsselwörter
Dialog, Bildung, Martin Buber, David Bohm, "Ich-Du-Beziehung", "Ich-Es-Beziehung", Problemlösungsfähigkeit, Wissenschaftsphilosophie, gesellschaftliches Zusammenleben, Toleranz, Weltoffenheit
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Unterschied zwischen der "Ich-Du" und "Ich-Es" Beziehung bei Martin Buber?
Buber unterscheidet zwischen der "Ich-Du-Beziehung" als einer Begegnung auf Augenhöhe und voller Präsenz und der "Ich-Es-Beziehung", in der das Gegenüber eher als Objekt oder Mittel zum Zweck wahrgenommen wird.
Wie definiert David Bohm den Begriff des Dialogs?
Bohm sieht den Dialog als einen kreativen Prozess, der über die bloße Diskussion hinausgeht. Er dient dazu, gemeinsame Bedeutungen zu finden und zwischenmenschliche Differenzen aufzulösen.
Kann man im Dialog lernen oder lernt man von einem Dialog?
Diese Frage steht im Zentrum der Arbeit. Die Verbindung von Bildung und Dialog impliziert, dass der Austausch selbst ein Lernprozess ist, der Weltoffenheit und Toleranz fördert.
Welche Bedeutung hat der Dialog für das gesellschaftliche Zusammenleben?
Sowohl Buber als auch Bohm sehen im Dialog die essenzielle Basis, um gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden und ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Wie wurde das Thema "Bildung im Dialog" im Seminar praktisch umgesetzt?
Die Referenten nutzten eine offene Diskussion und ein Quiz mit Wettkampfcharakter, um das Interesse der Studenten zu wecken und die Lernziele spielerisch zu kontrollieren.
Gibt es Widersprüche zwischen den Thesen von Buber und Bohm?
Die Arbeit analysiert vergleichbare und widersprüchliche Ansätze, insbesondere im Hinblick auf die wissenschaftsphilosophischen Hintergründe der beiden Denker.
- Citar trabajo
- Dipl.Päd. L. Lindenschmidt (Autor), 2006, Bildung im Dialog - Der Dialogbegriff bei Bohm und Buber, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81478