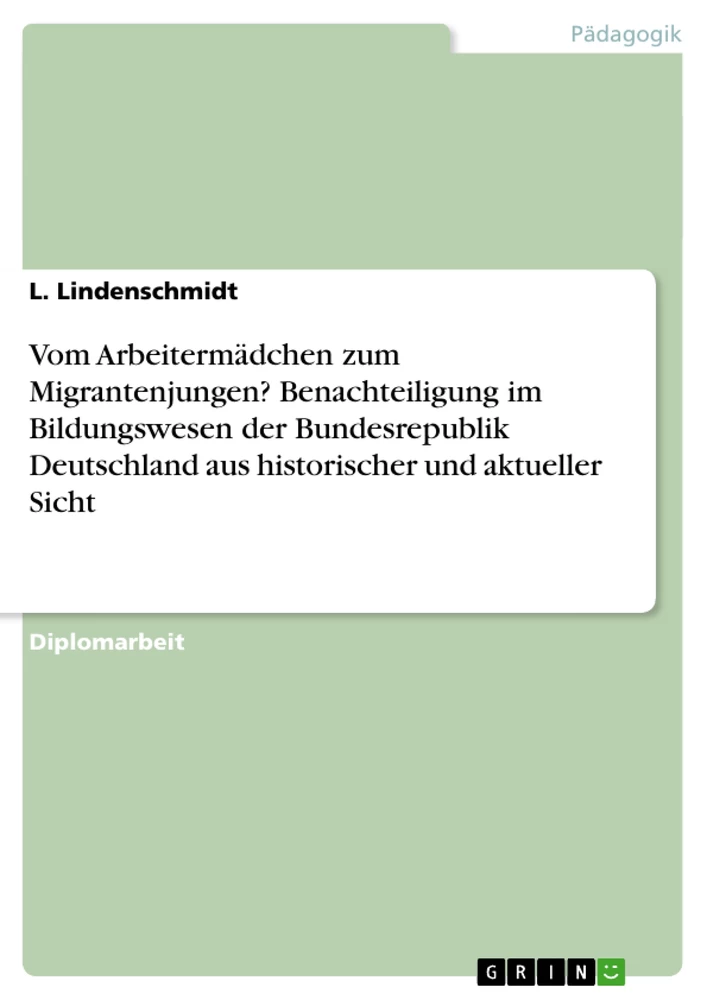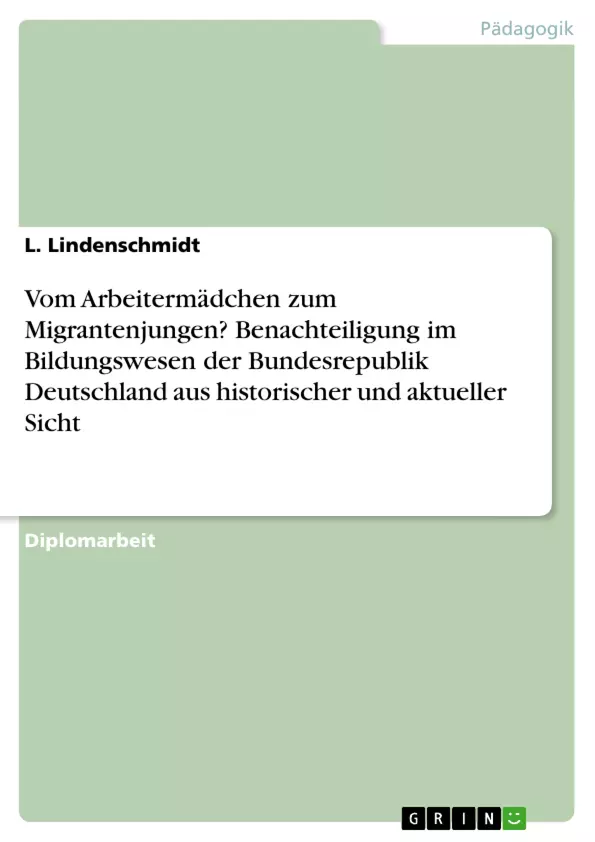Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem sind ein viel diskutiertes Thema in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. In kaum einem anderen Land ist der Unterschied zwischen den Schichten beziehungsweise Milieus in Bezug auf Bildungszugänge und –abschlüsse so groß wie in der BRD. Bereits in den 60er Jahren hat Picht eine deutsche »Bildungskatastrophe« erkannt und Ralf Dahrendorf wies in einer Vielzahl von Arbeiten auf bildungsspezifisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen hin. Als Synonym für diese Gruppen galt lange Zeit das Begriffskonglomerat vom »katholischen Arbeitermädchen vom Lande«. An dieser Stelle drängt sich jedoch die Frage auf, ob es in den letzten Jahrzehnten bis in die Gegenwart Veränderungen auf diesem Gebiet gegeben hat. Werden heute immer noch die Mädchen in der Schule benachteiligt? Haben Kinder aus den unteren Schichten der Gesellschaft weniger Chancen auf höhere Bildung als ihre Altersgenossen aus dem Bürgertum? Wie ergeht es der großen Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in deutschen Bildungseinrichtungen? Dies sind nur einige Fragen entlang derer sich die Argumentationslinie der Arbeit orientiert. Arbeiterkinder, Mädchen und Migrantenkinder werden schwerpunktmäßig betrachtet. Dabei wird die Entwicklung der bildungsspezifischen Chancenungleichheiten beginnend mit den sechziger Jahren, über die Wiedervereinigung bis in die heutige Zeit dargestellt. Die verwendete Methode entspricht einer Dokumentenanalyse, wodurch subjektive Fehlerquellen nahezu ausgeschlossen werden können. Wer sich mit vorliegendem Themenbereich beschäftigt, wird wenig über die Ergebnisse überrascht sein. Auch diese Arbeit bestätigt erneut die These, dass es keine Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem gibt. Eine schon fast historische Konstante bezüglich bildungsspezifischer Benachteiligung bilden dabei die Kinder aus den unteren gesellschaftlichen Milieus. Mädchen werden nicht mehr benachteiligt und haben die Jungen in fast allen Gebieten innerhalb des Bildungssystems überholt. Geringe Chancen auf eine erfolgreiche Bildungskarriere haben Kinder mit Migrationshintergrund. Sprachliche und kulturell bedingte Probleme, aber auch Vorurteile innerhalb des Lehrkörpers, sind die hauptsächlichen Gründe für diesen Missstand. Eine vollkommene Chancengleichheit ist innerhalb der deutschen Schulen und Universitäten kaum zu verwirklichen. Ziel muss es aber sein, bestehende Unterschiede möglichst gering zu halten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Eingrenzung des Themas
- Definition zentraler Begriffe
- Literaturlage und Forschungsstand
- Benachteiligung von Arbeiterkindern im Bildungswesen
- Die Situation in den 1960er Jahren
- Empirische Daten
- Gründe für die strukturelle Benachteiligung von Arbeiterkindern
- Die Arbeiterfamilie
- Bildungseinrichtungen
- Begabungsstrukturen
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung bis zur Wiedervereinigung
- Arbeiterkinder in allgemeinbildenden Schulen der 1970er Jahre
- Sozialstruktur der Studentenschaft der 1970er Jahre
- Auslesekriterien im (Hoch-)Schulwesen der 1980er Jahre
- Selektion im Sekundarbereich
- Studienentscheidung bei Arbeiterkindern
- Zusammenfassung
- Von der Vereinigung ins neue Jahrtausend
- Die zentrale Bedeutung der Bildung
- Unveränderte soziale Selektion
- Ursachen der Selektion
- Aktuelle empirische Daten zur Sozialstruktur an Hochschulen
- Fazit
- Die Verhältnisse von Mädchen im Bildungssystem
- Weibliche Bildungsbeteiligung ab den 1960er Jahren
- Historische Voraussetzungen
- Der Mädchenanteil in Bildungseinrichtungen
- Benachteiligung der Schülerinnen
- Gründe für weibliche Bildungsschranken
- Zusammenfassung
- Die Situation im Zuge der Wiedervereinigung
- Empirische Daten zur weiblichen Bildungsbeteiligung
- Wege zur Hochschulreife
- Gleichberechtigung durch Koedukation
- Weitere Ursachen für geschlechtsspezifische Bildungschancen
- Zusammenfassung
- Die Lage im Zuge der Jahrtausendwende
- Mädchen und junge Frauen an allgemeinbildenden Schulen
- Weibliche Partizipation in Hochschulen
- Geschlechterwandel in der schulischen Benachteiligung
- Exkurs: Geschlechtsspezifische Teilung der Arbeitswelt
- Fazit
- Migrantenkinder im deutschen Bildungswesen
- Von den ersten Gastarbeiterkindern bis in die achtziger Jahre
- Deutsche Migrationstradition
- Bildungsbeteiligung im allgemeinbildenden Schulwesen
- Segregation statt Integration
- Bildungspolitik und Integration
- Schulische Sozialisationsdefizite
- Zusammenfassung
- Migrantenkinder im Bildungssystem nach der Wiedervereinigung
- Ethnische Trennungslinien im Bildungssystem
- Nicht-Deutsche Schülerschaft in der Sekundarstufe I
- Schul(miss)erfolg ausländischer Schüler
- Schüler aus Aussiedlerfamilien
- Studierende ausländischer Herkunft an deutschen (Fach)Hochschulen
- Der Frauenanteil ausländischer Studierender
- Gründe für die Bildungsbenachteiligung ausländischer Schüler
- Zusammenfassung
- Migrantenkinder im deutschen Bildungssystem der Postmoderne
- Bildungskontext und -beteiligung anhand von PISA 2003 - Daten
- Art und Ausmaß bildungsspezifischer Differenzen
- Erklärungsversuche zur Bildungsbenachteiligung von Migranten
- Vermischung der Schülerschaft
- Fazit
- Vergleichende Darstellung von Verlauf und Entwicklung der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im Schulwesen
- Die Entwicklung vom Arbeitermädchen zum Migrantenjungen
- Bildungschancen und Schichtzugehörigkeit
- Geschlecht und soziale Herkunft
- Geschlecht und kulturell-ethnische Herkunft
- Bildungschancen und Herkunft
- Chancengleichheit: Eine Illusion?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungssystem aus historischer und aktueller Sicht. Sie analysiert die Ursachen und Entwicklungen der Bildungsungleichheit, die sich in der Vergangenheit insbesondere auf Arbeiterkinder und Mädchen konzentrierte und heute verstärkt durch die Bildungschancen von Migrantenkindern beeinflusst wird.
- Entwicklung der Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern in Deutschland
- Historische und aktuelle Faktoren, die die Bildungschancen von Mädchen beeinflussen
- Herausforderungen und Entwicklungen in der Bildung von Migrantenkindern
- Vergleichende Analyse der Benachteiligung verschiedener Gruppen im Bildungssystem
- Chancengleichheit im Bildungssystem und die Frage nach der Illusion der Gleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und die zentralen Begriffe definiert. Die Kapitel 2 bis 4 befassen sich jeweils mit den Bildungschancen von Arbeiterkindern, Mädchen und Migrantenkindern in Deutschland. Diese Kapitel untersuchen die historische Entwicklung, aktuelle Daten und Ursachen für die Bildungsbenachteiligung der jeweiligen Gruppen. Kapitel 5 stellt die Ergebnisse der vorherigen Kapitel vergleichend dar und analysiert die Entwicklung vom Arbeitermädchen zum Migrantenjungen. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse zusammenfasst und Schlussfolgerungen zieht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Themen Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Geschlecht, Migration, Arbeiterkinder, Mädchen, Migrantenkinder, Bildungssystem, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Segregation.
Häufig gestellte Fragen
Wer wurde früher als das 'katholische Arbeitermädchen vom Lande' bezeichnet?
Dies war in den 1960er Jahren ein Synonym für die am stärksten bildungsbenachteiligte Bevölkerungsgruppe in Deutschland.
Werden Mädchen heute immer noch im Bildungssystem benachteiligt?
Nein, Mädchen haben Jungen mittlerweile in fast allen Bereichen des Bildungssystems überholt; die Benachteiligung hat sich verschoben.
Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund für den Bildungserfolg?
Kinder mit Migrationshintergrund haben aktuell oft geringere Chancen auf eine erfolgreiche Bildungskarriere, bedingt durch sprachliche, kulturelle Hürden und Vorurteile.
Gibt es heute echte Chancengleichheit in deutschen Schulen?
Die Arbeit bestätigt die These, dass es weiterhin keine volle Chancengleichheit gibt, da die soziale Herkunft nach wie vor ein starker Selektionsfaktor ist.
Was sind die Hauptgründe für die Benachteiligung von Arbeiterkindern?
Gründe liegen in der Struktur der Arbeiterfamilien, den Selektionsmechanismen der Bildungseinrichtungen und oft fehlender Förderung.
- Quote paper
- Dipl.Päd. L. Lindenschmidt (Author), 2007, Vom Arbeitermädchen zum Migrantenjungen? Benachteiligung im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland aus historischer und aktueller Sicht , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81489