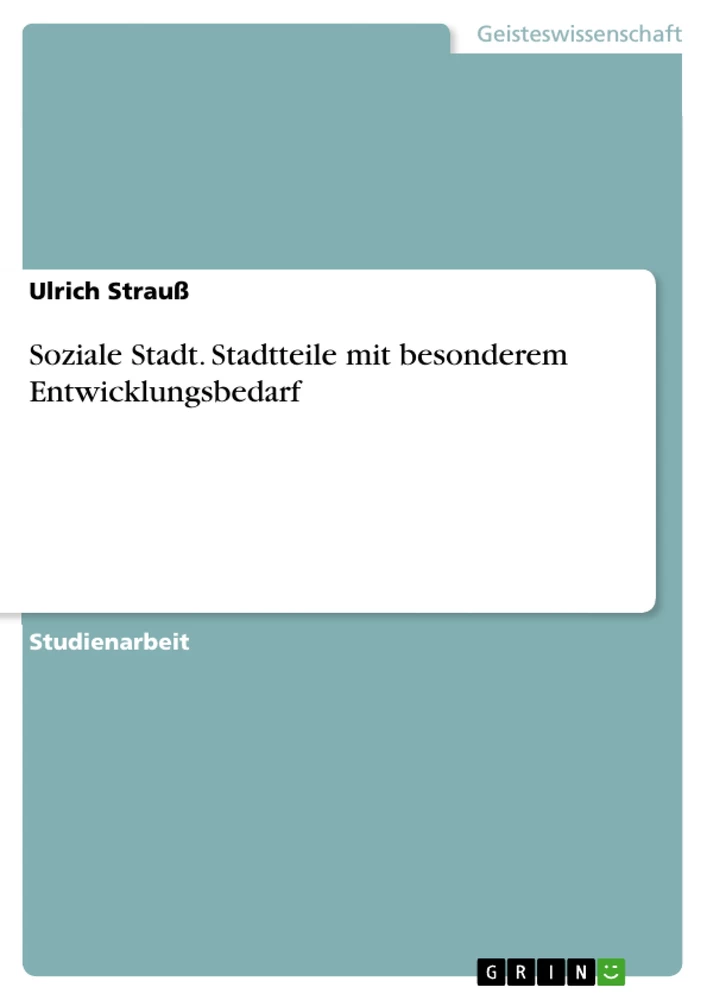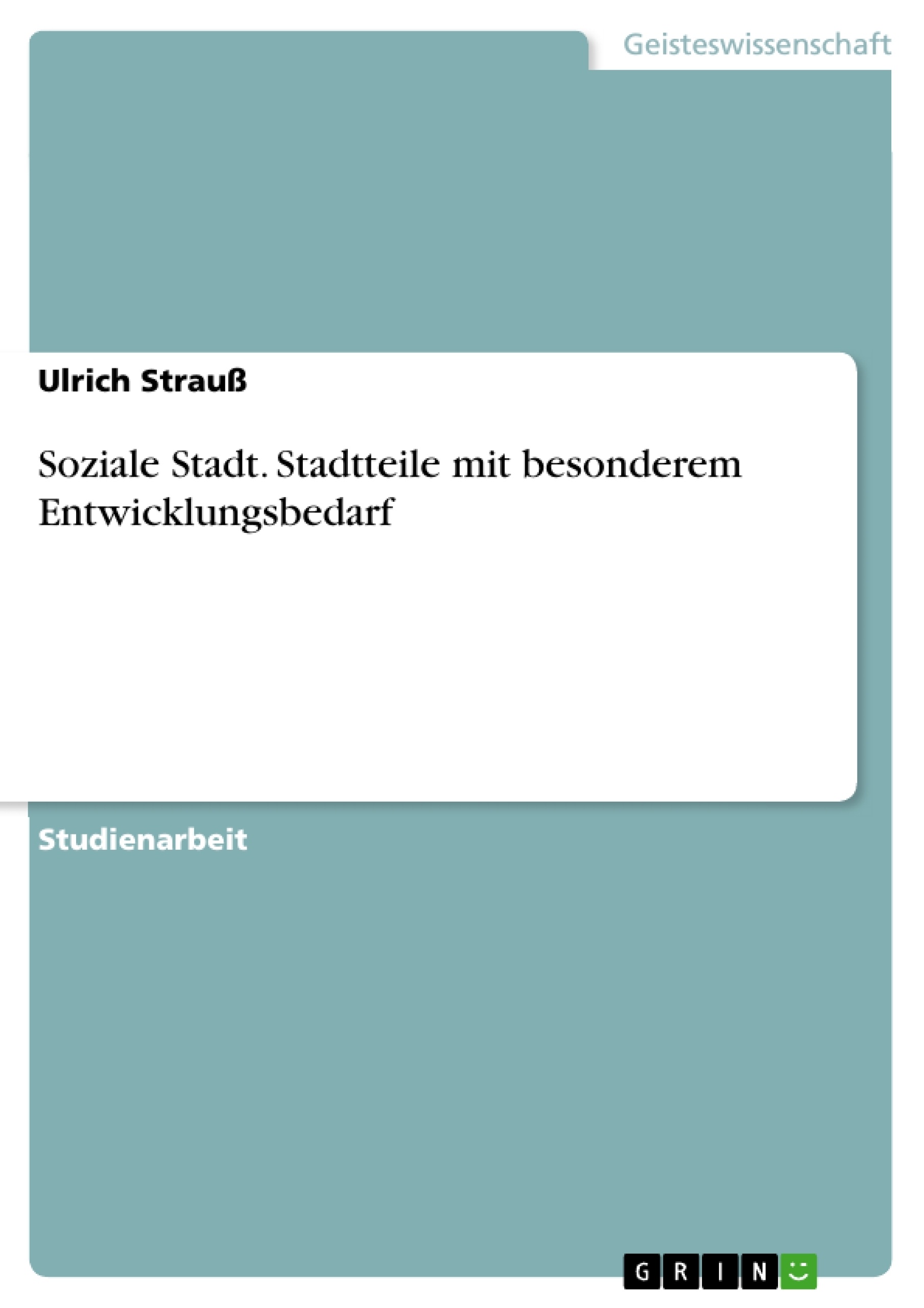Armut trifft auf Raum – so lässt sich in aller Kürze die Handlungsgrundlage des Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ beschreiben. Zum einen gibt es das gesellschaftliche Phänomen, dass die einen Menschen ärmer sind als andere zum anderen kumuliert sich diese Erscheinung in den Städten an bestimmten Brennpunkten und verstärkt sich. Armut wertet Stadtteile ab und zwar nicht nur einfach, sondern in einer Abwärtsspirale! „Das politische Versprechen, nie wieder mit dem gesellschaftlichen Problem ‚Armut’ konfrontiert zu sein, konnte nicht eingelöst werden.“ (Alisch 1998a S. 7)
In dieser Arbeit soll nicht über die politischen, gesellschaftlichen und sozialen Hintergründe spekuliert werden, die den Boden und Rahmen von solchen Entwicklungen bilden. Hier wird ein Schritt weitergegangen und eine programmatische Reaktion aufgezeigt; das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
In einem ersten Schritt wird die Ausgangssituation dargestellt. Dabei wird deutlich, dass das Programm als Paradigmenwechsel gehandelt wird, da es sich nicht alleine auf bauliche Maßnahmen stützt sondern es sollen „selbstständig lebensfähige und lebenswerten Stadtteile“ (vgl. Schwarzer 2003 S 121) geschaffen werden sollen. Zudem werden die gesellschaftlichen Hintergründe beleuchtet
Im zweiten Kapitel werden kurz die Vorläufer des Projektes genannt und der gesellschaftliche Hintergrund kurz skizzier bevor
im dritten Kapitel die Stadtteiltypen näher gefasst und die Auswahlkriterien für die Aufnahme in das Programm "Soziale Stadt" beschrieben werden
Mit seinen Zielen, Handlungsfeldern und Ablaufschema wird dass Programm näher dargestellt (Kap. 4) bevor in einem fünften Schritt die finzanzrechtlichen Rahmenbedingungen diskutiert werden.
Einen großen Raum nimmt die Beschreibung des Quartiersmanagementsbegriffes ein. Es wird seine Komplexität und auch Faktoren für Gelingen/nicht Gelingen aufgezeigt. Zudem werden andere Quartiersmanagement-Begriffe abgegrenzt
An dieses Kapitel schließt sich ein Exkurs an, der eine Diskussion zwischen GWA-Ansätzen und dem Quartiersmanagementmodell in der hier gezeigten Form kurz aufgreift.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Projekts „Soziale Stadt"
- Ausgangssituation
- Vorläuferprogramme
- Gesellschaftliche Hintergrund
- Die Gebiete
- Gebietscharakteristik
- Auswahlkriterien für Gebiete
- Ziele und Ablauf des Programms
- Maßnahmen im Rahmen der „Sozialen Stadt"
- Finanzrechtlicher Rahmen
- Finanzrechtliche Grundlagen
- Grundlage für die finanzielle Förderung
- Finanzierung
- Subsidiarität
- Mittelbindung
- Quartiersmanagement / Stadtteilmanagement
- Quartiersmanagement ist mehr als nur ein Manager
- Profil einer Stadtteilmanagerstelle
- Faktoren für den Erfolg
- Fazit
- Weitere Quartiersmanagement-Bedeutungen
- Exkurs: GWA vs. Stadtteilmanagement
- Kritik an dem Konzept „Soziale Stadt"
- Soziale Differenzen werden akzeptiert
- Rahmen gut gewählt?
- Kleinräumliche Lösung verfehlt Wurzeln der Problematik
- Programm fördert Deregulierung
- Diskussion der Kritik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" und untersucht die Grundlagen, Hintergründe und Umsetzungsmöglichkeiten des Programms.
- Entstehung und gesellschaftliche Voraussetzungen des Programms
- Charakteristik und Auswahlkriterien der Programmgebiete
- Ziele und Handlungsansätze des Programms
- Finanzrechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierung des Programms
- Die Rolle des Quartiersmanagements in der „Sozialen Stadt"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Programm „Soziale Stadt" als Reaktion auf die kumulative Konzentration von Armut in bestimmten Stadtteilen beschreibt.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung des Programms im Kontext von strukturellen Umbrüchen und der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Städtebau- und Stadtentwicklungspolitik.
Im dritten Kapitel werden die Vorläuferprogramme und der gesellschaftliche Hintergrund des Projekts „Soziale Stadt" näher erläutert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Gebieten, die in das Programm aufgenommen werden. Es werden die typischen Eigenschaften und die Auswahlkriterien für die Gebiete vorgestellt.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Ziele und den Ablauf des Programms, darunter die Maßnahmen zur Förderung von wirtschaftlicher Tätigkeit, Verbesserung der sozialen Infrastruktur und Integration der Quartiersbevölkerung.
Im sechsten Kapitel wird der finanzrechtliche Rahmen des Programms erörtert, einschließlich der rechtlichen Grundlagen, der Anforderungen an die Finanzierung und des Subsidiaritätsprinzips.
Das siebte Kapitel widmet sich dem Quartiersmanagement und stellt den Begriff in den Kontext des Programms „Soziale Stadt". Es werden die Aufgaben und Herausforderungen des Quartiersmanagements sowie Faktoren für seinen Erfolg untersucht.
Ein Exkurs im achten Kapitel diskutiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gemeinwesenarbeit und Stadtteilmanagement.
Das neunte Kapitel analysiert die Kritik an dem Konzept „Soziale Stadt", die vor allem die Akzeptanz sozialer Differenzen, die begrenzten Möglichkeiten des kleinräumlichen Ansatzes und die neoliberale Deregulierung des Sozialstaates betrifft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche „Soziale Stadt", Stadtteilentwicklung, Quartiersmanagement, Armut, soziale Segregation, integrative Stadtentwicklung, und Subsidiaritätsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Programms „Soziale Stadt“?
Das Ziel ist es, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf durch eine Kombination aus baulichen und sozialen Maßnahmen wieder lebenswert und selbstständig lebensfähig zu machen.
Was versteht man unter Quartiersmanagement?
Quartiersmanagement ist ein zentrales Steuerungselement, das Akteure vor Ort vernetzt, Projekte koordiniert und als Schnittstelle zwischen Bewohnern, Verwaltung und Politik fungiert.
Nach welchen Kriterien werden Gebiete für das Programm ausgewählt?
Die Auswahl erfolgt basierend auf sozialen Problemlagen wie hoher Arbeitslosigkeit, Armutskonzentration, schlechter Bausubstanz und mangelhafter sozialer Infrastruktur.
Welche Kritik gibt es am Konzept der „Sozialen Stadt“?
Kritiker bemängeln, dass der kleinräumige Ansatz die tieferen Ursachen von Armut nicht bekämpfen kann und das Programm teilweise eine Deregulierung des Sozialstaates fördert.
Wie wird das Programm finanziert?
Es handelt sich um ein Bund-Länder-Programm, bei dem die Finanzierung gemeinsam durch den Bund, die Länder und die beteiligten Kommunen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips erfolgt.
- Quote paper
- Dipl.SozPäd (FH); Dipl. Päd (Uni) Ulrich Strauß (Author), 2005, Soziale Stadt. Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81498