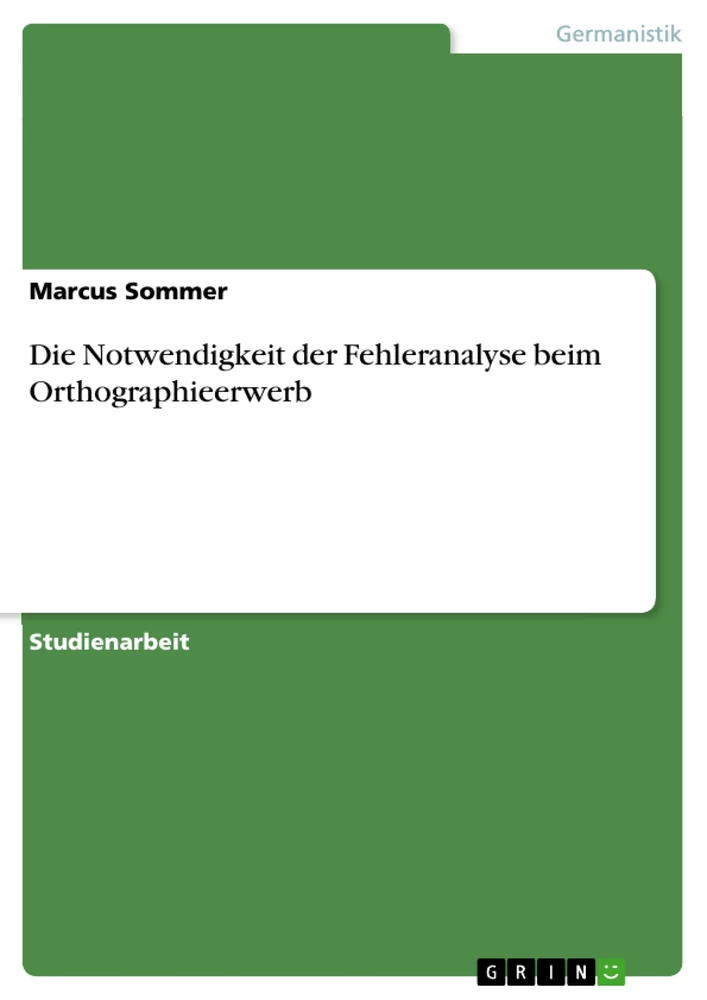Wochenlang wurde im Frühjahr 2006 in deutschen Tages- und Wochenzeitungen über die Frage debattiert: Wie frei dürfen Kinder schreiben? Oder anders formuliert: Welchen Wert hat die Fehleranalyse in den frühen Texten von Schreibanfängern?
Die renommierte Grundschulpädagogin Renate Valtin schlug Alarm, attackierte das beschriebene fehlerignorierende Vorgehen als "schädlich“ und versuchte sogar, dieses didaktische Prinzip zumindest an Berliner Grundschulen durch die Senatsverwaltung zu stoppen (vgl. Burchard 2006). Die Problematik beschäftigt auch die vorliegende Hausarbeit. Es gilt zu klären, inwieweit eine Fehleranalyse bei Schreibanfängern notwendig und wichtig ist. Müssen Schüler auf ihre orthographischen Fehlschreibungen hingewiesen werden oder überwiegen die Nachteile dieses Vorgehens? Inwiefern ist eine Fehleranalyse notwendig?
Die Hausarbeit versucht, diese Fragestellung argumentativ zu erörtern und mögliche Wege einer angemessenen Fehleranalyse aufzuzeigen. Dies wird exemplarisch an der Oldenburger Fehleranalyse durchgeführt, die ebenfalls kritisch betrachtet werden soll.
Zunächst soll aber in einem ersten Schritt versucht werden, den Begriff des (orthographischen) Fehlers zu definieren und zu erklären, unter welchen Gesichtspunkten ihn die heutige Pädagogik deutet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Der veränderte Blickwinkel: Die Bedeutung von Rechtschreibfehlern in der heutigen Didaktik
- 2.1.1 Das moderne Verständnis von Rechtschreibfehlern
- 2.1.2 Stadien des Schriftspracherwerbs
- 2.2 Die Notwendigkeit der Fehleranalyse
- 2.3 Möglichkeiten zur Diagnostizierung von Fehlerschwerpunkten: Das Fallbeispiel OLFA
- 2.3.1 Die Oldenburger Fehleranalyse als ein mögliches Instrument der Fehleranalyse
- 2.3.2 Kritische Anmerkungen zu OLFA
- 2.1 Der veränderte Blickwinkel: Die Bedeutung von Rechtschreibfehlern in der heutigen Didaktik
- 3 Synthese: Fehleranalyse als Hilfe zum kindgerechten Orthographieerwerb
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Notwendigkeit der Fehleranalyse im Orthographieerwerb bei Schreibanfängern. Sie beleuchtet den Wandel des Blickwinkels auf Rechtschreibfehler von Sanktionierung hin zu einem Verständnis als Lernprozessindikator. Die Arbeit analysiert Möglichkeiten der Fehlerdiagnostik und diskutiert kritisch ein konkretes Instrument, die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA).
- Wandel des Verständnisses von Rechtschreibfehlern in der Pädagogik
- Notwendigkeit und Bedeutung der Fehleranalyse im Schriftspracherwerb
- Möglichkeiten und Grenzen der Fehlerdiagnostik
- Kritische Betrachtung der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA)
- Kindgerechter Orthographieerwerb durch Fehleranalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die kontroverse Debatte um den Umgang mit Rechtschreibfehlern bei Kindern vor, die zwischen fehlerignorierendem Vorgehen und der Notwendigkeit einer Fehleranalyse schwankt. Sie führt in die Problematik ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der die Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer angemessenen Fehleranalyse bei Schreibanfängern untersucht.
2 Hauptteil: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit dem gewandelten Verständnis von Rechtschreibfehlern in der heutigen Didaktik. Er beschreibt die Abkehr von der traditionellen Sichtweise, die Fehler als Versagen interpretierte, hin zu einem Verständnis, das Fehler als wertvolle Hinweise auf den Lernprozess und die Strategien des Kindes betrachtet. Es werden verschiedene Methoden der Fehleranalyse vorgestellt und kritisch bewertet, insbesondere die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) im Detail beleuchtet. Der Hauptteil erörtert argumentativ die Notwendigkeit einer Fehleranalyse und zeigt mögliche Wege einer angemessenen Fehleranalyse auf.
3 Synthese: Fehleranalyse als Hilfe zum kindgerechten Orthographieerwerb: Die Synthese fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und betont die Bedeutung einer kindgerechten Fehleranalyse für den Orthographieerwerb. Sie verdeutlicht, wie eine konstruktive Auseinandersetzung mit Fehlern den Lernprozess unterstützen und das Selbstvertrauen der Kinder fördern kann, im Gegensatz zu dem früheren Verständnis, dass Rechtschreibfehler als Bestrafungsgrund dienten. Die Synthese betont den positiven Nutzen einer fundierten Fehleranalyse für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb.
Schlüsselwörter
Fehleranalyse, Orthographieerwerb, Schriftspracherwerb, Rechtschreibfehler, Didaktik, Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), Lernprozess, Fehlerverständnis, kindgerechter Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Fehleranalyse im Orthographieerwerb
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Notwendigkeit und den Möglichkeiten der Fehleranalyse im Orthographieerwerb bei Schreibanfängern. Sie untersucht den Wandel des Blickwinkels auf Rechtschreibfehler von Sanktionierung hin zu einem Verständnis als Lernprozessindikator und analysiert verschiedene Methoden der Fehlerdiagnostik, insbesondere die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: den Wandel des Verständnisses von Rechtschreibfehlern in der Pädagogik, die Notwendigkeit und Bedeutung der Fehleranalyse im Schriftspracherwerb, Möglichkeiten und Grenzen der Fehlerdiagnostik, eine kritische Betrachtung der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) und schließlich den kindgerechten Orthographieerwerb durch Fehleranalyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die die Problematik der Fehlerbehandlung im Orthographieunterricht einführt; einen Hauptteil, der sich mit dem gewandelten Verständnis von Rechtschreibfehlern, verschiedenen Fehleranalysemethoden und insbesondere der OLFA auseinandersetzt; und eine Synthese, die die Ergebnisse zusammenfasst und die Bedeutung einer kindgerechten Fehleranalyse für den Lernerfolg betont.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass eine konstruktive und kindgerechte Fehleranalyse ein wertvolles Instrument im Orthographieerwerb darstellt. Im Gegensatz zu früheren Ansätzen, die Rechtschreibfehler als Bestrafungsgrund sahen, wird hier der positive Nutzen einer fundierten Fehleranalyse für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb hervorgehoben.
Welche Methode der Fehleranalyse wird im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), bewertet deren Möglichkeiten und Grenzen kritisch und diskutiert ihre Anwendbarkeit im Unterricht.
Wie wird der Wandel des Verständnisses von Rechtschreibfehlern dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Abkehr von der traditionellen Sichtweise, die Fehler als Versagen interpretierte, hin zu einem Verständnis, das Fehler als wertvolle Hinweise auf den Lernprozess und die Strategien des Kindes betrachtet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit schlussfolgert, dass eine kindgerechte Fehleranalyse den Lernprozess unterstützen und das Selbstvertrauen der Kinder fördern kann. Eine fundierte Fehleranalyse ist demnach essentiell für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fehleranalyse, Orthographieerwerb, Schriftspracherwerb, Rechtschreibfehler, Didaktik, Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), Lernprozess, Fehlerverständnis, kindgerechter Unterricht.
- Quote paper
- Marcus Sommer (Author), 2007, Die Notwendigkeit der Fehleranalyse beim Orthographieerwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81553