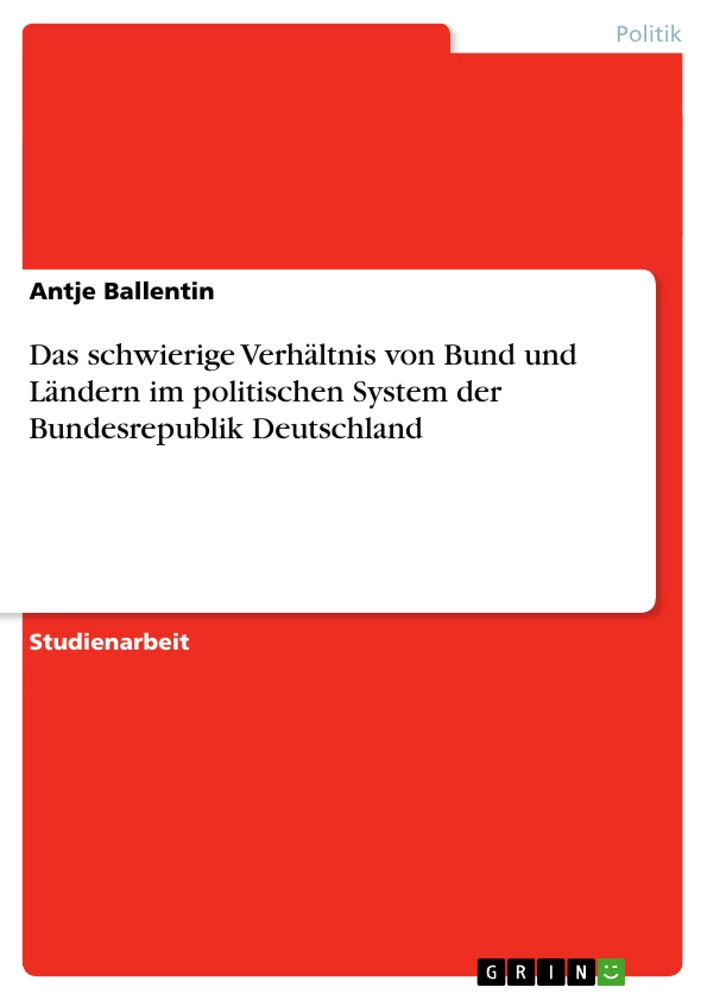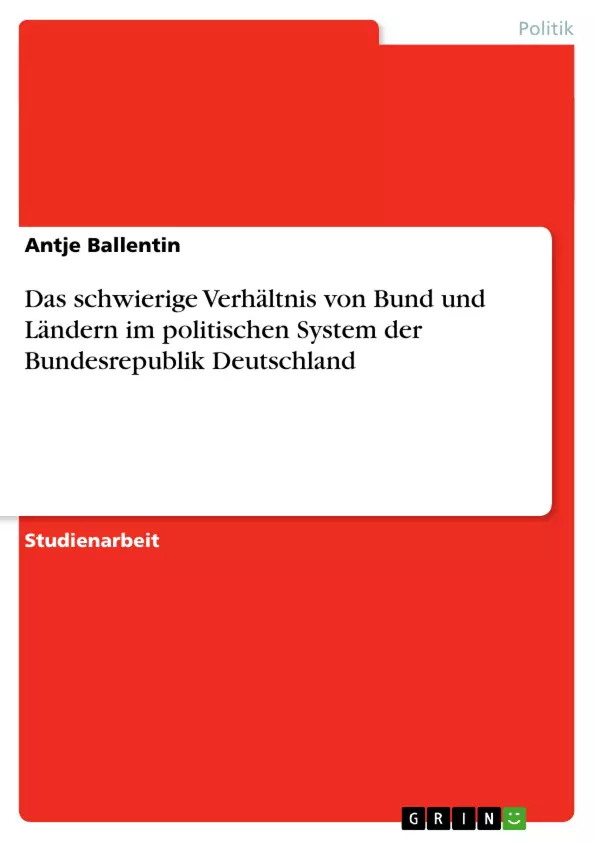„Der deutsche Föderalismus unterscheidet sich von allen anderen bundesstaatlichen Ordnungen [...] durch die unmittelbare Mitwirkung der gliedstaatlichen Regierungen an den Entscheidungen des Zentralstaates und durch das höhere Ausmaß der vertikalen und horizontalen Politikverflechtung.“
Der Politikwissenschaftler Fritz W. Scharpf benennt hier die zwei herausragenden Strukturmerkmale der bundesdeutschen föderalistischen Ordnung. Der Parlamentarische Rat entschied sich 1949 für die Tradition des deutschen Ratsprinzips, bei dem die Mitglieder des Bundesrates Abgesandte der Länderregierungen und an deren Instruktionen gebunden sind. Der Bundesrat repräsentiert die Länderinteressen beim Bund durch ernannte, nicht gewählte Regierungsvertreter und ist damit ein Instrument der Exekutive. Der sogenannte Exekutivföderalismus, welcher das Übergewicht der politischen Exekutiven aller Regierungsebenen bezeichnet, ist ein signifikantes Strukturmerkmal des bundesdeutschen, föderalen Systems.
Der politisch administrative Alltag der Bundesrepublik wird von einem dichten Netz von Aufgabenverflechtungen zwischen Bund und Ländern bestimmt. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit konzentriert sich auf diese zentralistischen Entwicklungen und die zunehmende Aushöhlung der Kompetenzen der Länder als Folgen der, von von Scharpf beschriebenen, Politikverflechtung.
Nach einem Überblick über die Ursprünge des bundesdeutschen Föderalismus, seine Neuerschaffung durch die Alliierten und durch den Parlamentarischen Rat und seiner Verankerung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sollen in dieser Arbeit die besonderen Entwicklungslinien und Strukturmerkmale im Verhältnis von Bund und Ländern sowie den Ländern untereinander nachgezeichnet werden. In der Arbeit herausgearbeitete Kritikpunkte, vor allem die Diskussion um das Finanzsystem, sollen die Problematik der Politikverflechtung aufzeigen und das schwierige Verhältnis von Bund und Ländern verdeutlichen. Dabei wird vor allem im Hauptteil weniger chronologisch als vielmehr problemorientiert vorgegangen. Das Spannungsfeld des deutschen Föderalismus in der Europäischen Union würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird daher ausgeklammert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die historische Entwicklung des deutschen Föderalismus bis 1948
- 2. Die Wiederentstehung der bundesstaatlichen Ordnung nach 1945
- 3. Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebung
- 4. Entwicklungslinien und Strukturmerkmale im bundesdeutschen Föderalismus
- 4.1 Der kooperative Föderalismus und die Politikverflechtung
- 4.2 Die Dritte Ebene
- 5. Die Unitarisierung des bundesdeutschen Föderalismus
- 5.1 Kompetenzausweitung des Bundes
- 5.2 Bundesdeutscher Exekutivföderalismus
- 5.3 Die Überlagerung des Bundesstaatsprinzips durch das Parteienstaatsprinzip und die Folgen
- 6. Die Diskussion um den Föderalismus am Beispiel der Finanzverfassung
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung und die Strukturmerkmale des deutschen Föderalismus mit einem Fokus auf die zunehmende Zentralisierung und die Aushöhlung der Kompetenzen der Länder. Die Arbeit analysiert das schwierige Verhältnis von Bund und Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Bezug auf die Politikverflechtung und die Herausforderungen, die sich aus dem kooperativen Föderalismus ergeben.
- Die historische Entwicklung des deutschen Föderalismus
- Die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
- Die Politikverflechtung und der kooperative Föderalismus
- Die Unitarisierungstendenzen des bundesdeutschen Föderalismus
- Die Rolle der Finanzverfassung im Spannungsfeld zwischen Bund und Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zwei zentralen Strukturmerkmale des deutschen Föderalismus heraus – die Mitwirkung der Länderregierungen an den Entscheidungen des Zentralstaates und die Politikverflechtung. Sie fokussiert sich auf die Entwicklung des föderalen Systems und die Aushöhlung der Kompetenzen der Länder durch diese Verflechtung.
- 1. Die historische Entwicklung des deutschen Föderalismus bis 1948: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des Föderalismus in Deutschland von seinen Wurzeln im Heiligen Römischen Reich über den Deutschen Bund bis zur Weimarer Republik nach. Es beleuchtet die unterschiedlichen Modelle und die Schwierigkeiten, die sich im Laufe der Geschichte ergaben.
- 2. Die Wiederentstehung der bundesstaatlichen Ordnung nach 1945: Dieses Kapitel analysiert die Entscheidung der Alliierten, einen föderalistischen deutschen Staat nach dem Zweiten Weltkrieg zu errichten. Es beschreibt die Herausforderungen bei der Schaffung der Bundesrepublik und die wichtigen Streitfragen, die im Parlamentarischen Rat diskutiert wurden.
- 3. Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebung: Dieses Kapitel erklärt die grundgesetzlichen Regelungen zur Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Es erläutert die Bereiche der ausschließlichen und der konkurrierenden Gesetzgebung sowie die Rolle der Länder bei der Verwaltung und der Rechtsprechung.
- 4. Entwicklungslinien und Strukturmerkmale im bundesdeutschen Föderalismus: Dieses Kapitel beleuchtet die beiden zentralen Entwicklungstendenzen des deutschen Föderalismus: den kooperativen Föderalismus und die Politikverflechtung. Es untersucht die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Entscheidungsfindung und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen.
- 5. Die Unitarisierung des bundesdeutschen Föderalismus: Dieses Kapitel analysiert die zunehmende Unitarisierung des deutschen Föderalismus durch die Ausweitung der Bundeskompetenzen, die Dominanz der Landesregierungen im Exekutivföderalismus und die Überlagerung des Bundesstaatsprinzips durch das Parteienstaatsprinzip.
- 6. Die Diskussion um den Föderalismus am Beispiel der Finanzverfassung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Finanzverfassung für das Verhältnis von Bund und Ländern. Es analysiert den horizontalen und vertikalen Finanzausgleich und die Kritikpunkte, die an diesem System geäußert werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen und zentralen Themen des deutschen Föderalismus, darunter die historische Entwicklung, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, die Politikverflechtung, der kooperative Föderalismus, die Unitarisierung, der Exekutivföderalismus, die Finanzverfassung und das Spannungsfeld zwischen Einheitlichkeit und Vielfalt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Besonderheiten des deutschen Föderalismus?
Kennzeichnend sind die unmittelbare Mitwirkung der Länderregierungen an Bundesentscheidungen (Bundesrat) und eine starke Politikverflechtung zwischen den Ebenen.
Was versteht man unter "Exekutivföderalismus"?
Es beschreibt das Übergewicht der Regierungen (Exekutiven) gegenüber den Parlamenten im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland.
Wie hat sich die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern verändert?
Es gibt eine Tendenz zur Unitarisierung, bei der der Bund seine Gesetzgebungskompetenzen ausweitet, was oft zu einer Aushöhlung der Eigenständigkeit der Länder führt.
Welche Rolle spielt die Finanzverfassung im Bund-Länder-Verhältnis?
Die Verteilung der Steuereinnahmen und der Finanzausgleich sind zentrale Streitpunkte, die das schwierige Verhältnis und die Abhängigkeiten verdeutlichen.
Was bedeutet "Politikverflechtung" nach Fritz W. Scharpf?
Es beschreibt die enge Verzahnung von Aufgaben und Entscheidungen, die dazu führen kann, dass Reformen durch gegenseitige Blockaden erschwert werden.
- Arbeit zitieren
- Antje Ballentin (Autor:in), 2007, Das schwierige Verhältnis von Bund und Ländern im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81554