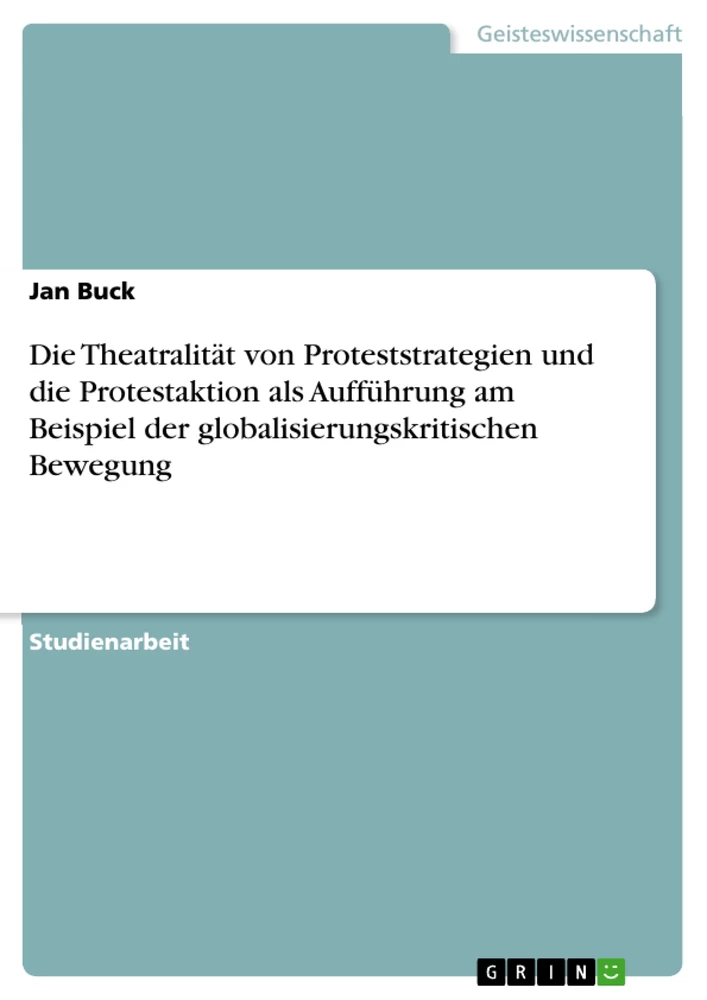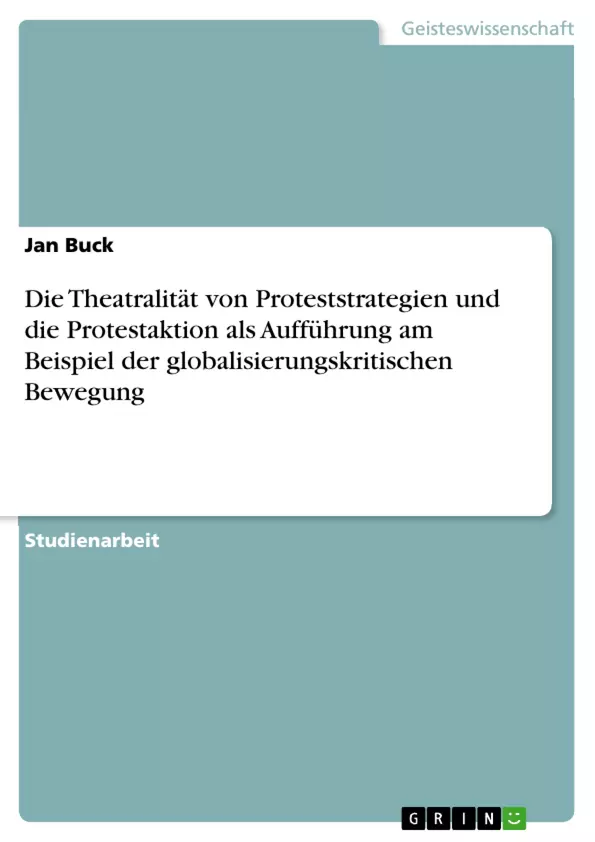Erika Fischer-Lichte definiert die Aufführung als ein Ereignis, das in der und durch die leibliche Ko-Präsenz von „Handelnden“ und „Zuschauenden“ zustande kommt. Akteure und Zuschauer konfrontieren sich miteinander und interagieren, wobei die Zugehörigkeit der einzelnen Personen zu den beiden Gruppen während der Aufführung wechseln kann.
Der theatrale Charakter von Demonstrationen und politischen Protestaktionen im Sinne einer nach außen gewandten Vorführung wurde bereits eingehend untersucht. Daher erscheint es vielversprechend, Protestbewegungen und -aktionen auf ihren Aufführungscharakter hin zu betrachten, besonders als Wechselspiel zwischen köperlich anwesenden Personengruppen. Denn Aktivisten sind nicht die einzigen Hadelnden in einer Protestsituation.
Dazu muss zunächst einmal die Frage geklärt werden, welche Gruppen von Personen in einer Protestsituation aktiv teilnehmen und wie die Rollen von Akteuren und Zschauern verteilt sind.
Fischer-Lichte unterscheidet genau zwischen dem Begriff der Aufführung und dem der Inszenierung. Für die Aufführungen von Protest und der Reaktion auf Protest spielen Inszenierungsstrategien – also eine gewisse Planung der Vorgehensweisen – eine wichtige Rolle. Interessanterweise versucht diese Planung auch Einfluss darauf zu nehmen, wann verschiedene Personengruppen die Rollen von Akteuren oder Zuschauern annehmen. Es soll also untersucht werden, welche Inszenierungsstrategien die verschiedenen Personengruppen erschaffen und was die Qualität ihrer Theatralität ausmacht.
Ebenso eng verbunden mit dem Begriff der Aufführung sieht Fischer-Lichte die Rolle von Körperlichkeit und Wahrnehmung. Die Bedeutung beider wird auch bei nur oberflächlicher Betrachtung von Protestaktionen sofort ersichtlich. Körperliche Anwesenheit und der Einsatz der eigenen Körperlichkeit ist auch nach dem Bedeutungsverlust von Massendemonstrationen mit dem Konzept der „Direkten Aktion“ ein zentrales Element zeitgenössischen Protests.
Als besonders geeignet für die Untersuchung des Aufführungscharakters von Protestaktionen bietet sich die globalisierungskritische Protestbewegung an. In ihr finden sich eine in der Vergangenheit unerreichte breite Vielfalt von Motivationen und Aktionsformen, ein offensiver Gebrauch von Körperlichkeit, ein extrem hochentwickelter Umgang mit Wahrnehmungsformen und aufsehenerregende Protest-Spektakel wie die WTO-Proteste 1999 in Seattle.
Inhaltsverzeichnis
- Der globalisierungskritische Protest als Aufführung
- Die Geschichte der globalisierungskritischen Bewegung
- Entstehung
- Anliegen
- Die soziale Exklusivität
- Das Fehlen ökologischer Nachhaltigkeit
- Die Missachtung der kulturellen Diversität
- Die Missachtung der Menschenrechte
- Der Mangel an demokratischer Partizipation
- Akteure und Zuschauer in Protest-Aufführungen
- Die Protestbewegung
- Die Sicherheitskräfte
- Die Beobachter
- Inszenierung und Körperlichkeit
- Inszenierungsstrategien der Bewegung
- Reclaim the Streets
- Pink & Silver
- CIRCA – Die „Clandestine Insurgent Rebel Clown Army“
- Tute Bianche
- Der Schwarze Block
- Inszenierungsstrategien der Sicherheitskräfte
- Inszenierungsstrategien der Bewegung
- Wahrnehmung der Medien
- Wahrnehmung und Körperlichkeit in der Aufführung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den theatrale Charakter von Proteststrategien, insbesondere der globalisierungskritischen Bewegung. Sie analysiert, inwieweit sich Protestaktionen als Aufführungen verstehen lassen, die durch Interaktion und Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern geprägt sind.
- Die Entwicklung der globalisierungskritischen Bewegung und ihre Kernthemen
- Die verschiedenen Akteure und ihre Rollen innerhalb von Protestaktionen
- Inszenierungsstrategien und Taktiken der Protestbewegung und der Sicherheitskräfte
- Der Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung und Konstruktion von Protest
- Das Zusammenspiel von Körperlichkeit und Wahrnehmung in der Aufführungssituation
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel legt den Fokus auf die Aufführungsdefinition von Erika Fischer-Lichte und stellt die Relevanz der theatralen Analyse von Protesten heraus.
- Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung der globalisierungskritischen Bewegung und ihre zentralen Anliegen.
- Kapitel 3 untersucht die Rolle der verschiedenen Akteure und Zuschauer in Protestaktionen, einschließlich der Protestbewegung, der Sicherheitskräfte und der Beobachter.
- In Kapitel 4 werden die Inszenierungsstrategien der Protestbewegung und der Sicherheitskräfte untersucht, darunter Reclaim the Streets, Pink & Silver, die Clownsarmee CIRCA, die Tute Bianche und der Schwarze Block.
- Kapitel 5 beleuchtet die Rolle der Medien bei der Wahrnehmung und Konstruktion von Protesten.
- In Kapitel 6 wird das Zusammenspiel von Körperlichkeit und Wahrnehmung in der Aufführungssituation anhand von Beispielen aus Seattle und Genua analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Globalisierungskritik, Protest, Theatralität, Aufführung, Körperlichkeit, Wahrnehmung, Inszenierung, Medien, Sicherheitskräfte, Akteure, Zuschauer, Direkte Aktion, Reclaim the Streets, Pink & Silver, CIRCA, Tute Bianche, Schwarzer Block, Seattle, Genua.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Protest als Aufführung" nach Erika Fischer-Lichte?
Eine Aufführung ist ein Ereignis, das durch die körperliche Ko-Präsenz von Handelnden (Aktivisten) und Zuschauern (Polizei, Medien, Passanten) entsteht und durch deren Interaktion geprägt wird.
Welche Inszenierungsstrategien nutzt die globalisierungskritische Bewegung?
Dazu gehören kreative und visuelle Aktionsformen wie die Clownsarmee (CIRCA), Pink & Silver, Reclaim the Streets sowie radikalere Formen wie der Schwarze Block oder die Tute Bianche.
Welche Rolle spielt die Körperlichkeit bei modernen Protesten?
Körperliche Anwesenheit und "Direkte Aktion" sind zentral. Der Einsatz des eigenen Körpers (z. B. durch Blockaden oder Kostümierung) dient dazu, Wahrnehmung zu erzwingen und politische Botschaften zu inszenieren.
Wie beeinflussen Medien die Wahrnehmung von Protestaktionen?
Medien fungieren als "Zuschauer", die den Protest für ein Massenpublikum konstruieren. Protestbewegungen gestalten ihre Aktionen oft gezielt als Spektakel, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren.
Warum ist die WTO-Protestaktion in Seattle 1999 so bedeutend?
Seattle 1999 gilt als Paradebeispiel für ein Protest-Spektakel, bei dem eine enorme Vielfalt an Aktionsformen und ein hochentwickelter Umgang mit Wahrnehmung den Aufführungscharakter moderner Bewegungen verdeutlichten.
- Citation du texte
- Jan Buck (Auteur), 2007, Die Theatralität von Proteststrategien und die Protestaktion als Aufführung am Beispiel der globalisierungskritischen Bewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81567