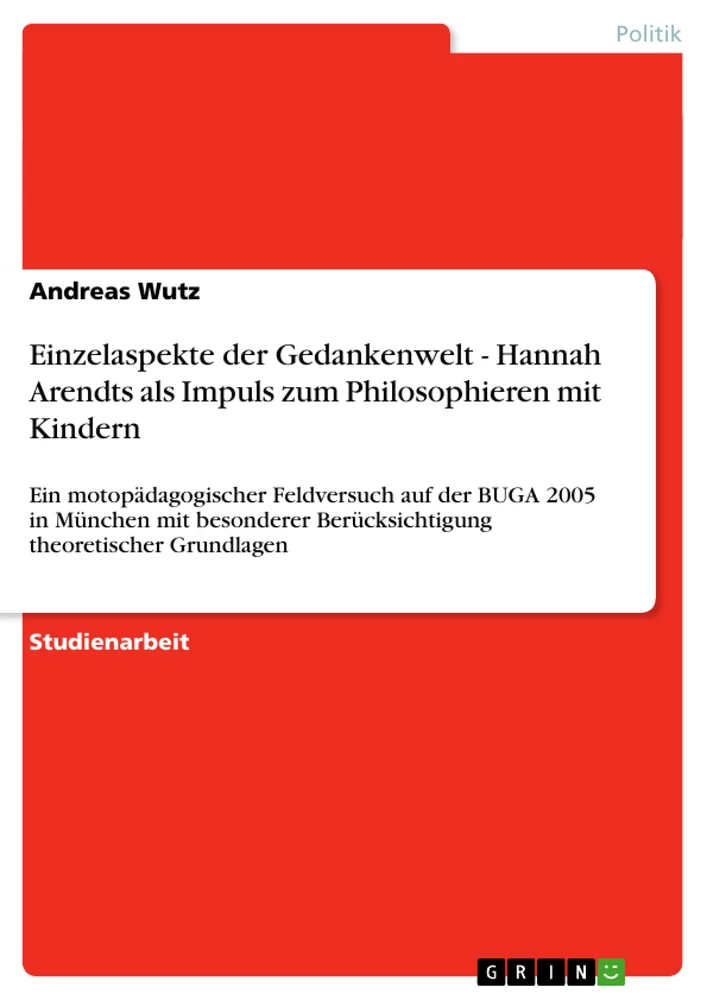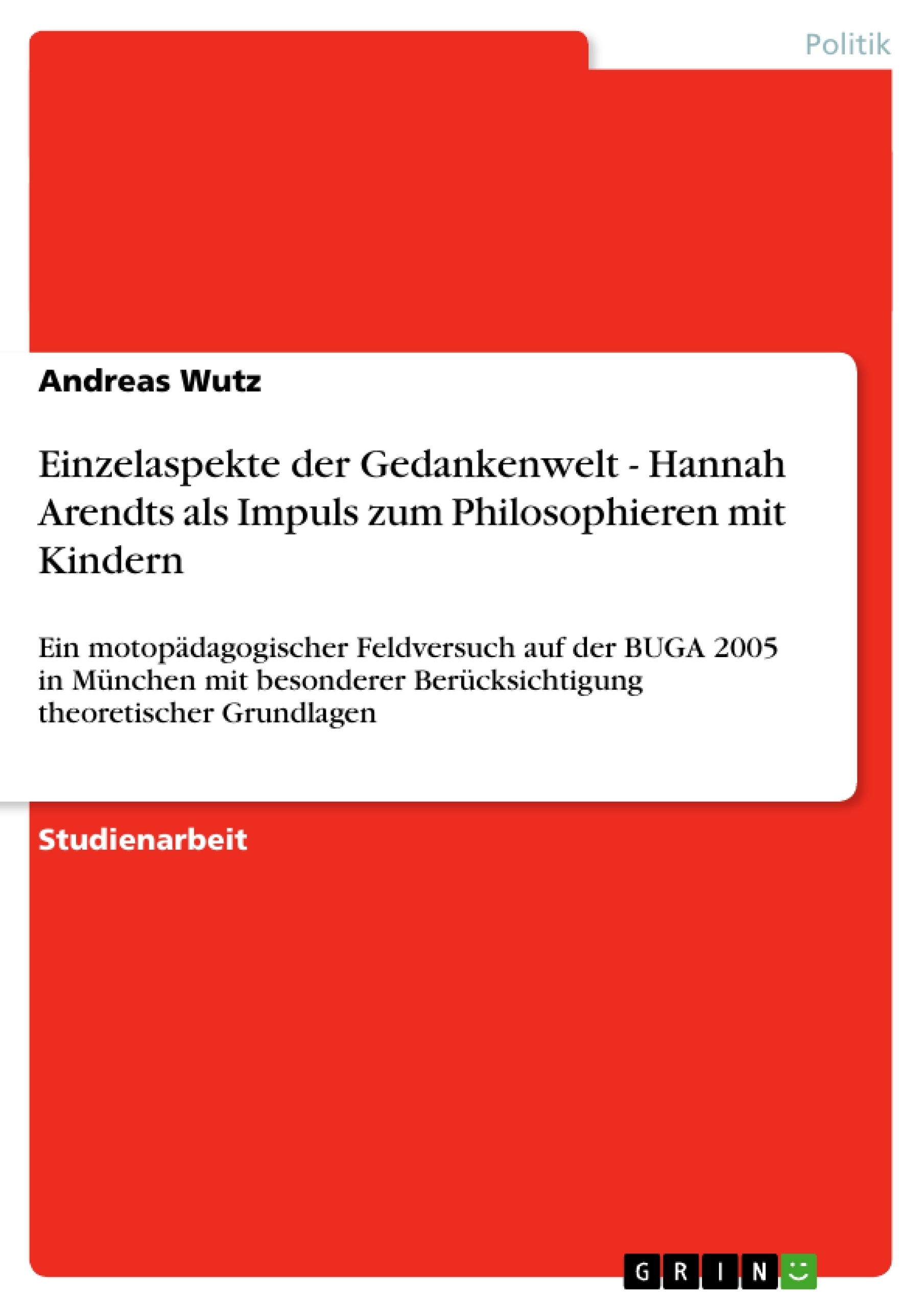Der in der Wirtschaft weit verbreitete und meines Erachtens etwas unglücklich gewählte Terminus Soft Skills ist letzten Endes nichts anderes, als der Versuch etwas zu kategorisieren und begrifflich verfügbar zu machen, was sich einer allumfassenden Definition und Evaluation entzieht. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten scheint jedoch gesellschaftlicher Konsens über das erstrebenswerte Ziel ganzheitlicher Bildung zu herrschen. Doch worin besteht dann das Dilemma? Das Problem ist, dass ein solches Unterfangen, Kindern eine moralisch-ethische Orientierung zu geben, im Grunde „quer zum Schulbetrieb“ gelagert ist, der nicht auf die Erörterung ungelöster Fragen ausgelegt ist. Einen Ausweg aus dieser Aporie sucht das an der Universität Regensburg unter der Leitung von Roswitha Wiesheu und Prof. Dr. Karlfriedrich Herb im Jahr 2005 gestartete Pilotprojekt Kinder philosophieren. Es verfolgt das ehrgeizige Ziel, die „Philosophie in den Dienst demokratischer Wertebildung für Kinder und Jugendliche zu stellen“ und als „umfassendes Erziehungs- und Unterrichtsprinzip“ zu etablieren. Jenseits bloßer Lippenbekenntnisse bleibt das Konzept nicht bei einer reinen Zielbeschreibung stehen, sondern umfasst gleichzeitig eine interdisziplinär erarbeitete Methodik, welche zum einen das theoretische Gerüst liefert, zum anderen aber ganz konkrete Maßnahmen und Handlungsanweisungen, z.B. zur Schulung der Lehrer, gibt. Im Rahmen dieser Initiative fand auf der BUGA vom 10. – 12.08.2005 ein Projekt statt, welches kinderphilosophische Ansätze mit motopädagogischen Konzepten verbindet und in dieser Form etwas völlig neues darstellt. Die vorliegende Arbeit befasst sich ausführlich mit den theoretischen Hintergründen, sowohl der Philosophie als auch der Motopädagogik und versucht, die gesammelten Ergebnisse trotz der mangelhaften empirischen Basis zumindest soweit in einen größeren Kontext einzuordnen, dass Tendenzen erkennbar werden. Um die Lücke zwischen dem Philosophieren mit Kindern und den motopädagogischen Ansätzen zu schließen, werden auch verschiedene Kindheits- und Sozialisationskonzepte in aller Kürze erörtert. Besonders viel Raum gewährt die Arbeit der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt, aus deren Werk einige zentrale Aspekte zum Philosophieren mit Kindern herausgegriffen wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Zentrale Aspekte der Philosophie Hannah Arendts
- Vorbemerkungen zu Hannah Arendt
- Der arendtsche Handlungsbegriff
- Ideengeschichtliche Wurzeln
- Versprechen und Verzeihen in Arendts Handlungstheorie
- Die Bedeutung des Handeln in der Vita activa und die besondere Rolle von Natalität und Pluralität
- Die Stellung des Handelns in der Trias Arbeiten, Herstellen, Handeln
- Die Domänen in der Vita activa: polis und oikos
- Philosophieren mit Kindern
- Terminologie
- Wegmarken des Philosophierens mit Kindern
- Kritik am Philosophieren mit Kindern
- Das sokratische Gespräch
- Konzepte der Kindheit
- Bemerkungen zur Sozialisation
- Das Projekt Kinder philosophieren auf der BUGA in München
- Bewegungspädagogik nach Kükelhaus
- Erfahrungsbericht
- Zielsetzung und Beschreibung der Spirale
- Vorüberlegungen und erste Erfahrungen
- Ergebnisse der Dialoge mit den Kindern
- Schluss
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Pilotprojekt „Kinder philosophieren“, das im Sommersemester 2005 an der Universität Regensburg gestartet wurde. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Philosophie in den Dienst demokratischer Wertebildung für Kinder und Jugendliche zu stellen und als umfassendes Erziehungs- und Unterrichtsprinzip zu etablieren. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Projekts, insbesondere die Philosophie Hannah Arendts und die Bewegungspädagogik nach Kükelhaus.
- Philosophie Hannah Arendts und ihre Relevanz für das Philosophieren mit Kindern
- Motopädagogische Konzepte und ihre Verbindung zum Philosophieren mit Kindern
- Theorie und Praxis des Philosophierens mit Kindern
- Kindheits- und Sozialisationskonzepte im Kontext des Projekts
- Empirische Ergebnisse des Projekts auf der BUGA 2005 in München
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit zentralen Aspekten der Philosophie Hannah Arendts. Es werden ihre Gedanken zum Handlungsbegriff, zur Vita activa und zur Bedeutung von Pluralität und Natalität im öffentlichen Raum beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem Philosophieren mit Kindern. Es werden verschiedene Konzepte und Methoden des Philosophierens mit Kindern vorgestellt, sowie Kritikpunkte und die Bedeutung des sokratischen Gesprächs erörtert. Auch die Bedeutung von Kindheits- und Sozialisationskonzepten für das Philosophieren mit Kindern wird thematisiert. Im dritten Kapitel wird das Projekt „Kinder philosophieren“ auf der BUGA 2005 in München vorgestellt. Es werden die methodischen Grundlagen des Projekts erläutert, die Verbindung von Bewegungspädagogik und Philosophieren mit Kindern beschrieben und erste Ergebnisse des Projekts dargestellt.
Schlüsselwörter
Philosophie, Hannah Arendt, Handlung, Vita activa, Pluralität, Natalität, Philosophieren mit Kindern, Bewegungspädagogik, Kükelhaus, Sozialisation, Wertebildung, Demokratie, BUGA 2005, München.
- Citar trabajo
- M. A. Andreas Wutz (Autor), 2005, Einzelaspekte der Gedankenwelt - Hannah Arendts als Impuls zum Philosophieren mit Kindern , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81611