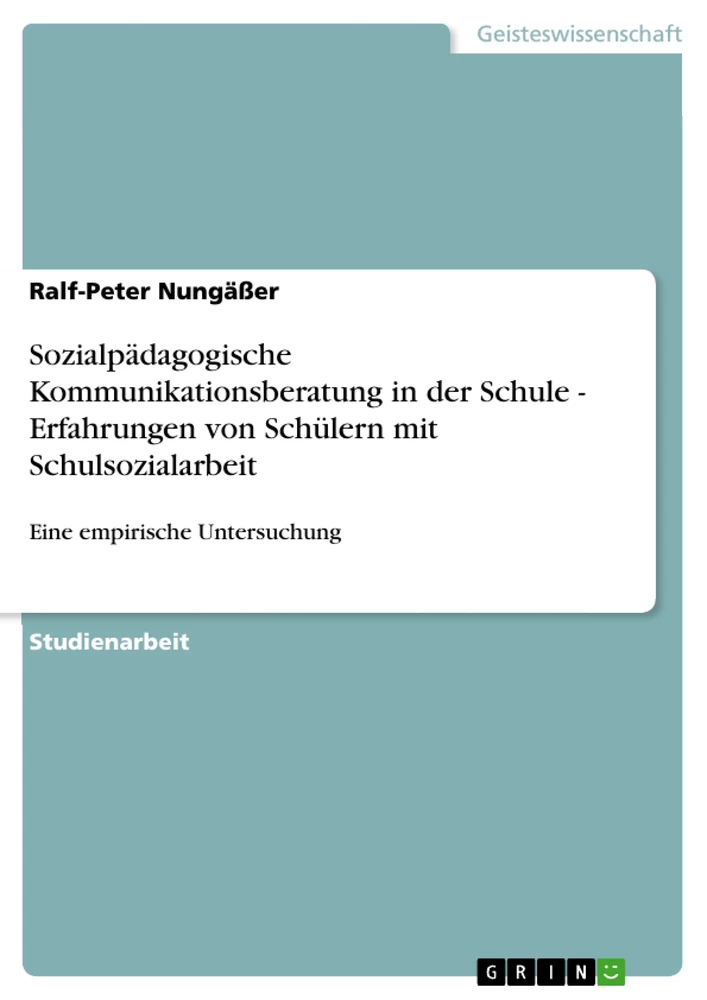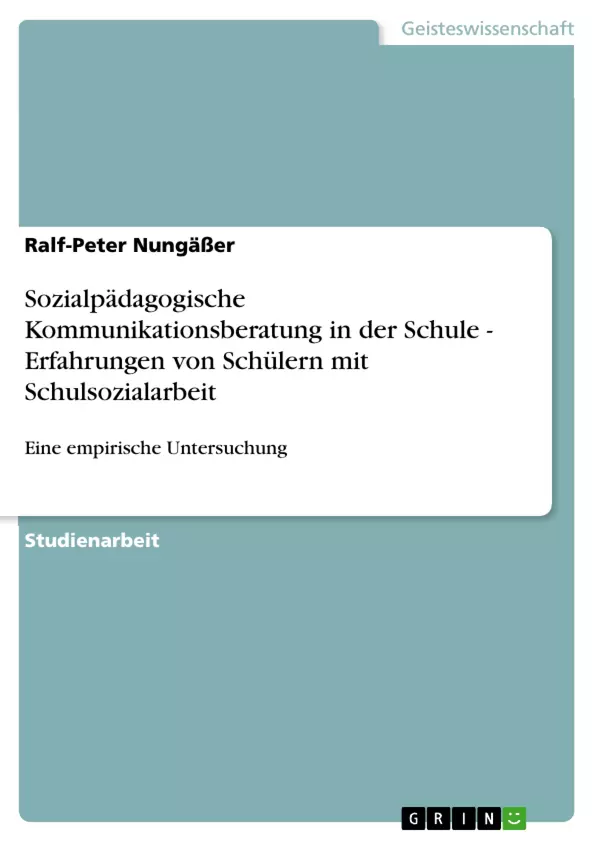Noch immer ist die praktische Verbreitung von Schulsozialarbeit dürftig. An traditionellen Regelschulen findet man sie nur in seltenen Ausnahmefällen, so z.B. an „sozialen Brennpunkten“. Allerdings ist sie mittlerweile an vielen integrierten Gesamtschulen in der BRD vertreten (1986: S.222; vgl. KREFT/MIELENZ, 1988, S.462) Wenn in diesem Zusammenhang von Schulsozialarbeit gesprochen wird, so stellt sich immer wieder die Frage nach ihrer Legitimation und Funktion: Inwieweit ist Schulsozialarbeit überhaupt fähig, konstruktiv verändernd auf die Sekundärsozialisationsinstanz Schule einzuwirken und wirkt sie nicht für Schüler widersprachig, wenn sich in ihrer Eigenschaft und Funktion lediglich in „Wundflickerei“ erschöpft anstatt die „Verletzungsursachen“ zu beseitigen? Kann und soll Schulsozialarbeit unter diesen Umständen die Pionierarbeit leisten, Kommunikationsprozesse und gestörte Kommunikationsformen zwischen Schülern und Schule (meist Lehrern) aufzuzeigen und eventuell für beide Seiten befriedigend zu beheben?
Zunächst soll in dieser Arbeit der Komplex Schule untersucht werden: Welche Bedingungen zum derzeitigen Schulsystem führten, wie das deutsche Schulsystem aufgebaut ist und welche gesellschaftliche Aufgaben sie zu erfüllen hat.
Im nächsten Kapitel soll dargestellt werden, welche Kommunikationsprozesse in der Schule vorherrschen, auf welche Art sie ablaufen und wie sie, falls sie gestört sind, zu Konflikten zwischen Schülern und Schule, insbesondere aber zu Leistungs- und Lernversagen bei Schülern führen können.
Im dritten Kapitel soll untersucht werden, wie es um das Verhältnis zwischen Schulsozialarbeit und Schule steht; welche Begründungen dazu führen, die Schulsozialarbeit so notwendig erscheinen lassen, welche Ziele und Aufgaben sie im allgemeinen vertritt und welchen schulischen Problemlagen Schüler täglich ausgesetzt sind. Hierzu soll ein Exkurs verdeutlichen, daß Schüler nicht nur schulischen Belastungen ausgesetzt sind, sondern auch außerschulische Bedingungen zu möglichen Lern- und Leistungsversagen beitragen können. Der letzte Teil dieser Arbeit will darstellen, wie Schüler ihren Schulalltag erleben und welche Erfahrungen sie mit den Angeboten der Schulsozialarbeiter/innen gemacht haben. Werden sie als hilfreich erlebt? Oder sehen sie in ihr lediglich ein notwendiges Übel, welches man durchlaufen muß, damit man, im Falle von Schulversagen, nicht ganz ins „Bodenlose“ herabsinkt? Zu diesem Zweck sollen Fragebogenerhebungen dazu dienen, relevante Schüleraussagen zu diesem Thema zu gewinnen, die am Ende statistisch-deskriptiv und im Anschluß daran interpretativ ausgewertet und dargestellt werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- 1.0 SCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND
- 1.1 Historischer Hintergrund
- 1.2 Aufbau
- 1.3 Gesellschaftliche Aufgaben
- 1.4 Probleme der Schule und Legitimierung von Schulsozialarbeit
- 2.0 SCHULISCHE KOMMUNIKATIONSFORMEN
- 2.1 Der Begriff Kommunikation
- 2.1.1 Der Systembegriff
- 2.2 Beziehungsformen
- 2.2.1 Störungen und Konflikte
- 3.0 SOZIALPÄDAGOGISCHE ARBEIT IN DER SCHULE
- 3.1 Verhältnis
- 3.2 Begründung für Schulsozialarbeit
- 3.2.1 Beziehung zwischen Lehrern und Schulsozialarbeit
- 3.2.2 Schulische Problemlagen von Schülern
- 3.3 Funktion, Aufgaben und Ziele
- 3.3.1 Bedingungen für Kommunikationshilfe
- 4.0 EXKURS: AUSSERSCHULISCHE ENTWICKLUNGSBEDINGUNGEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
- 5.0 ERFAHRUNGEN VON SCHÜLERN MIT SCHULSOZIALARBEIT
- 5.1 Erklärung der Interviewtechnik, Fragestellung und Untersuchungsgruppe
- 5.2 Statistisch-deskriptive Auswertung
- 5.2.1 Unterrichtskommunikation und Probleme
- 5.2.2 Auffälligkeit: Definition und Umgangsweise
- 5.2.3 Vorstellung der Schulsozialarbeit
- 5.2.4 Verhältnis zwischen Lehrer bzw. Schüler und Sozialarbeiter
- 5.2.5 Aufgabengebiete, Hilfsangebote und Auswirkungen der Schulsozialarbeit
- 5.3 Interpretative Auswertung - Diskussion
- 5.3.1 Unterrichtskommunikation und Auffälligkeit
- 5.3.2 Kommunikationshilfe durch Schulsozialarbeit und ihre Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen von Schülern mit Schulsozialarbeit in der Schule. Sie analysiert die Kommunikationsformen und Problemlagen in der schulischen Umgebung und beleuchtet die Funktion, Aufgaben und Ziele der Schulsozialarbeit. Des Weiteren werden die außerschulischen Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen betrachtet, die sich auf ihre Lern- und Leistungsfähigkeit auswirken können.
- Kommunikation in der Schule und deren Störungen
- Schulsozialarbeit: Funktion, Aufgaben und Ziele
- Erfahrungen von Schülern mit Schulsozialarbeit
- Außerschulische Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenhang zwischen Kommunikation, Auffälligkeit und Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das deutsche Schulsystem, seinen historischen Hintergrund, Aufbau und gesellschaftliche Aufgaben. Im Fokus steht die Entstehung und Legitimation von Schulsozialarbeit. Kapitel zwei befasst sich mit den Kommunikationsformen in der Schule, insbesondere Störungen und Konflikten. Kapitel drei analysiert die Funktion, Aufgaben und Ziele der Schulsozialarbeit sowie die Beziehung zwischen Lehrern und Schulsozialarbeit. Kapitel vier stellt die außerschulischen Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen dar, die ebenfalls Einfluss auf die Lern- und Leistungsfähigkeit nehmen. Das fünfte Kapitel analysiert die Erfahrungen von Schülern mit Schulsozialarbeit, untersucht die statistisch-deskriptiven Daten und bietet eine interpretative Auswertung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Schulsozialarbeit, Kommunikation, Schule, Schüler, Lern- und Leistungsversagen, Sozialpädagogik, Kommunikationsprozesse, Auffälligkeit, Unterrichtskommunikation, außerschulische Entwicklungsbedingungen, Erfahrungen, Fragebogen, statistisch-deskriptive Auswertung, interpretative Auswertung, Hilfsangebote, Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Schulsozialarbeit?
Schulsozialarbeit soll Kommunikationsprozesse zwischen Schülern und Lehrern verbessern, Konflikte beheben und Lern- sowie Leistungsversagen entgegenwirken.
Wie nehmen Schüler die Schulsozialarbeit wahr?
Die Arbeit untersucht mittels Fragebögen, ob Schüler diese als hilfreiche Unterstützung oder lediglich als notwendiges Übel bei Schulversagen empfinden.
Welche Rolle spielt die Kommunikation im Schulalltag?
Gestörte Kommunikationsformen sind oft die Ursache für Konflikte und Leistungsstörungen. Die Sozialpädagogik setzt hier als beratende Instanz an.
Beeinflussen außerschulische Bedingungen die Schulleistung?
Ja, die Arbeit enthält einen Exkurs zu außerschulischen Entwicklungsbedingungen, die maßgeblich zu Lernproblemen beitragen können.
Wie ist die Schulsozialarbeit in Deutschland verbreitet?
Traditionell ist sie eher an Gesamtschulen oder sozialen Brennpunkten zu finden, während sie an Regelschulen seltener vertreten ist.
- Quote paper
- Diplom-Pädagoge Ralf-Peter Nungäßer (Author), 1991, Sozialpädagogische Kommunikationsberatung in der Schule - Erfahrungen von Schülern mit Schulsozialarbeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81634