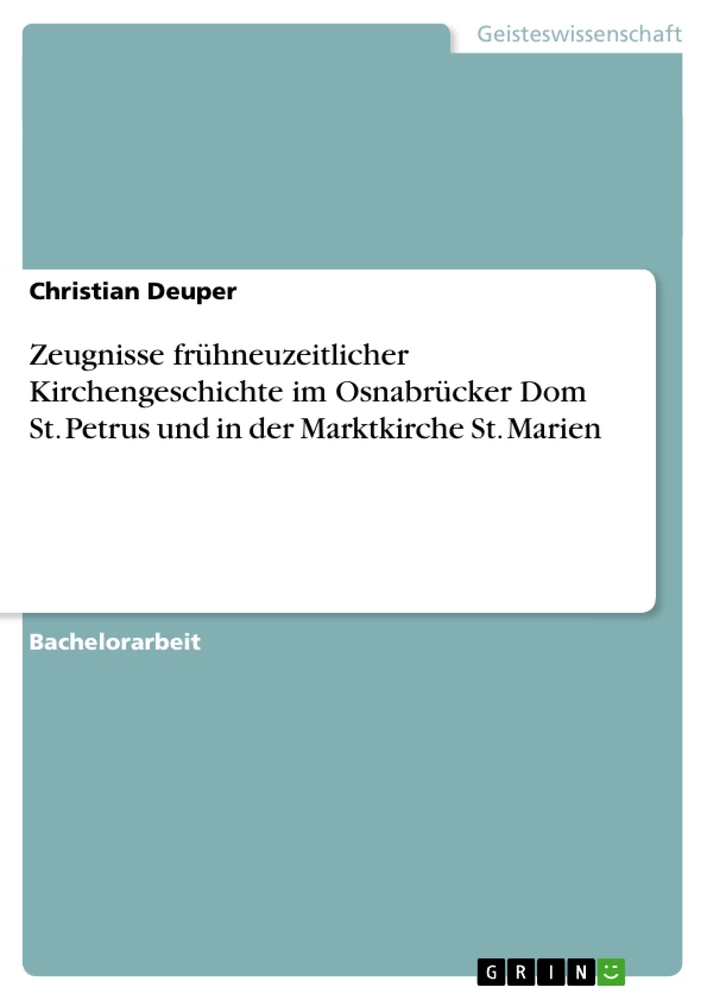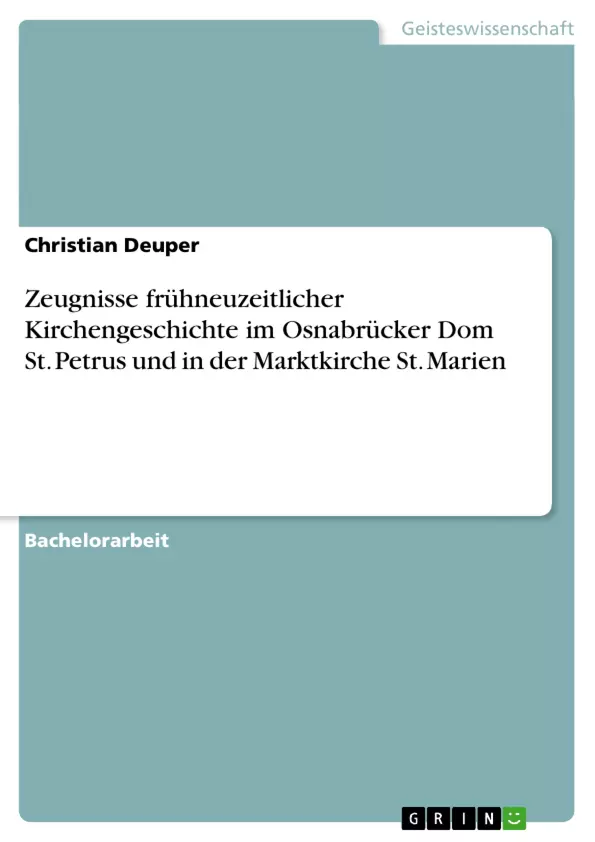Die vorliegende Dokumentation ist entstanden anlässlich einer Exkursion in den Osnabrücker Dom im Rahmen einer Vorlesung zur Kirchengeschichte der Frühen Neuzeit. Dabei stellte sich die Frage, ob in den romanischen bzw. gotischen Hauptkirchen Osnabrücks – dem römisch-katholischen Dom und der evangelisch-lutherischen Marienkirche – Zeugnisse des 17. und 18. Jahrhunderts zu finden sind. Es sind in der Tat nur wenige, die Ausstattung ist in beiden Kirchen wesentlich älter.
Diese Arbeit stellt zunächst kurz die abwechslungsreiche Baugeschichte der beiden Kirchen dar (Kap. 2). Darauf folgt der eigentliche Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung: die Betrachtung der ausgewählten Kunstgegenstände. Dies sind für den Dom ein Epitaph (Kap. 3.1.1), die Kanzel (Kap. 3.1.2) und eine Kreuzigungsgruppe (Kap. 3.1.3), für die Marienkirche drei Epitaphien (Kap. 3.2 ). Es liegt hierbei keine dezidiert kunstgeschichtliche Analyse vor – dieser Befund wird nur summarisch aus der Literatur erarbeitet. Stattdessen wird der hinter der Darstellung liegende theologische Aussagegehalt vorgestellt. Da es sich in allen Fällen um Abbildungen biblischer Szenen handelt, legen die Ausführungen ein gewisses Gewicht auf den Bereich der exegetischen Untersuchung des Abgebildeten bzw. der Zuordnung der zu einem allegorischen Bild zusammengefügten Perikopen, wobei aber nicht der Raum gegeben ist, den exegetischen Methoden in ihrer Ausführlichkeit nachzugehen. Neben der In- terpretation der biblischen Texte wird zuweilen ein Blick auf ihre Wirkungsgeschichte und ihre theologiegeschichtliche Verwendung geworfen. Dabei begegnen neben Darstellungen Christi biblische Personen wie Petrus, Paulus, Johannes der Täufer oder Simson, Hiob und David. In Kap. 4 werden dann zwei wichtige Aspekte, die im Zusammenhang der Analysen aufkommen, kurz kirchenhistorisch betrachtet: reformatorische Eschatologie (Kap. 4.1) und Angelologie (Kap. 4.2). Epitaphien werden als Erinnerung an Verstorbene gestiftet und weisen in ihrem Bildprogramm meist auf eschatologische Zusammenhänge; Engel finden sich als schmückendes Beiwerk oder auch als Bildelement an vielen kirchlichen Kunstgegenständen. Kapitel 5 fasst den Ertrag der Überlegungen zusammen und zeigt weiterführende Perspektiven auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abriss der Baugeschichte
- Dom St. Petrus, Osnabrück
- Marktkirche St. Marien, Osnabrück
- Dokumentation und theologische Erörterung: Aspekte der Frühen Neuzeit
- Dom
- Epitaph für Balduin Voß
- Kanzel
- Calvarienberg
- Marktkirche St. Marien
- Epitaph für Laurentius Schrader und Christine Hermeling
- Epitaph für Adolph Upringrod
- Epitaph für Anna Gravia
- Dom
- Frömmigkeitsgeschichte
- Sterben und Tod im 17. Jahrhundert
- Angelologie in der Barockzeit
- Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dokumentation entstand im Rahmen einer Exkursion in den Osnabrücker Dom und befasst sich mit der Frage, ob in den Osnabrücker Hauptkirchen Zeugnisse des 17. und 18. Jahrhunderts zu finden sind. Die Arbeit untersucht ausgewählte Kunstgegenstände in Dom und Marienkirche und stellt ihren theologischen Aussagegehalt vor.
- Die Baugeschichte des Osnabrücker Domes und der Marienkirche
- Die Interpretation der biblischen Szenen auf den Kunstgegenständen
- Die Wirkungsgeschichte und theologiegeschichtliche Verwendung der Kunstgegenstände
- Reformatorische Eschatologie und Angelologie in der Barockzeit
- Die Bedeutung von Epitaphien als Erinnerung an Verstorbene
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der Arbeit dar und skizziert den Fokus auf die Untersuchung von Kunstgegenständen in Dom und Marienkirche.
- Kapitel 2 bietet einen Abriss der Baugeschichte beider Kirchen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf den Dom St. Petrus und die Marktkirche St. Marien gelegt wird.
- Kapitel 3 befasst sich mit ausgewählten Kunstgegenständen des 17. und 18. Jahrhunderts im Dom und in der Marienkirche. Für den Dom werden das Epitaph für Balduin Voß, die Kanzel und die Kreuzigungsgruppe analysiert. Für die Marienkirche werden drei Epitaphien untersucht.
- Kapitel 4 widmet sich der Frömmigkeitsgeschichte und betrachtet zwei Themen: Sterben und Tod im 17. Jahrhundert sowie Angelologie in der Barockzeit.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Kunstgegenständen in Dom und Marienkirche, insbesondere Epitaphien, Kanzel und Kreuzigungsgruppe, und analysiert deren theologischen Aussagegehalt. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Frühe Neuzeit, Kirchengeschichte, Epitaphien, Kunstgeschichte, Theologie, Eschatologie, Angelologie, Osnabrück, Dom St. Petrus, Marktkirche St. Marien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Epoche steht im Fokus der Untersuchung im Osnabrücker Dom?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Zeugnisse der Frühen Neuzeit, insbesondere des 17. und 18. Jahrhunderts.
Welche Kunstgegenstände im Dom St. Petrus werden analysiert?
Analysiert werden ein Epitaph für Balduin Voß, die Kanzel und eine Kreuzigungsgruppe (Calvarienberg).
Was ist die theologische Bedeutung von Epitaphien?
Epitaphien dienen als Erinnerung an Verstorbene und enthalten oft Bildprogramme, die auf eschatologische Themen (Tod und Auferstehung) hinweisen.
Welche Themen der Frömmigkeitsgeschichte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die reformatorische Eschatologie sowie die Angelologie (Lehre von den Engeln) in der Barockzeit.
Gibt es in der Marienkirche ebenfalls Zeugnisse aus dieser Zeit?
Ja, in der evangelisch-lutherischen Marktkirche St. Marien werden drei Epitaphien (u.a. für Laurentius Schrader) theologisch untersucht.
- Arbeit zitieren
- Christian Deuper (Autor:in), 2007, Zeugnisse frühneuzeitlicher Kirchengeschichte im Osnabrücker Dom St. Petrus und in der Marktkirche St. Marien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81640