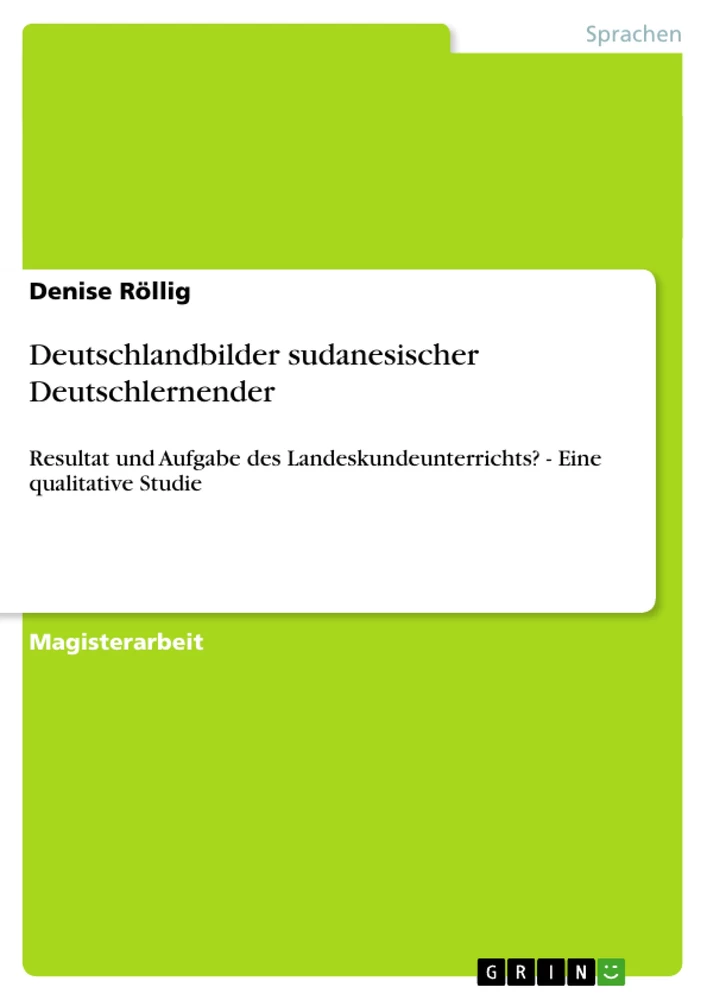Eine der Aufgaben und Herausforderungen dieser Arbeit ist es, deutschen Lesern Ansichten von Menschen aus einem Land nahe zu bringen, das trotz eines dort seit Jahrzehnten wütenden Bürgerkrieges bis vor kurzem im Rest der Welt weitgehend unbekannt war und meist unerwähnt blieb. Erst die traurigen Nachrichten über den Konflikt in der Region Darfur und die gleichzeitigen Bemühungen um Frieden auch zwischen Nord und Süd lenkten in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf diesen größten Staat Afrikas.
Gegenstand der in dieser Arbeit vorgestellten Meinungen sudanesischer Studierender ist die Bundesrepublik Deutschland. Es sollen also Sichtweisen junger Menschen aus einem der ärmsten Länder der Welt auf einen der größten Industrie-staaten vorgestellt werden. So unterschiedlich die beiden Regionen und somit die dort jeweils vorherrschenden Lebensbedingungen auch sein mögen – ob und wie verschieden letztendlich die Menschen sein mögen, wird noch zu untersuchen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Deutschlandbilder – Theorien und Hintergründe
- 1.1 Wissenschaftliche Prämissen
- 1.2 Das Konzept von ‚fremd’ und ‚eigen’ – ein (Selbst-)betrug
- 1.3 Die konstruktivistische Wahrnehmungstheorie
- 1.4 Wie nimmt das Individuum eine andere Nation wahr?
- 1.5 Stereotype, Vorurteile, Mythen, Nationalcharakter oder: Wie Erzählungen erfunden und verbreitet werden
- 2. Die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
- 2.1 Ziele, Gegenstände und Organisation der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- 2.2 Was soll vermittelt werden?
- 2.3 Der Dialog mit der islamisch geprägten Welt
- 3. Deutschlandbilder konkret
- 3.1 Exkurs: Deutschlandbilder der Deutschen
- 3.2 Deutschlandbilder weltweit
- 4. Geschichte, Gegenwart und Probleme der Landeskunde
- 4.1 Verschiedene Konzepte der Landeskunde im Fach Deutsch als Fremdsprache
- 4.2 Der Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen
- 4.3 Cultural Studies als Alternative zur Landeskunde
- 4.4 Das Konzept der anthropologisch-phänomenologischen Landeskunde bei Inge C. Schwerdtfeger
- 5. Der bildungspolitisch-soziale Hintergrund der Deutschlernenden in Khartum
- 5.1 Staat und Gesellschaft
- 5.2 Bildungspolitik
- 5.3 Die Deutsche Abteilung der Universität Khartum
- 5.4 Das Deutsche Kulturinstitut
- 6. Erläuterung der Forschungsmethode
- 6.1 Die Entscheidung für einen qualitativen Ansatz
- 6.2 Kriterien für die Interviewpartner
- 6.3 Überlegungen zum Interviewleitfaden
- 6.4 Der Interviewleitfaden
- 6.5 Durchführung, Transkription und Übersetzung der Interviews
- 6.6 Die Art und Weise der Analyse
- 7. Darstellung und Analyse der Interviews
- 7.1 Die Gespräche mit Studierenden der Universität Khartum
- 7.2 Die Gespräche mit Deutschlernenden am Deutsch-Sudanesischen Kulturinstitut
- 8. Folgerungen aus den empirischen Resultaten
- 8.1 Unterschiede in den Aussagen der Befragten
- 8.2 Die Aussagen der befragten Personen zu ausgewählten Themenbereichen
- 8.3 Stereotypen und Vorurteile
- 8.4 Quellen für die Aussagen der Befragten
- 8.5 Empfehlungen für die Landeskunde
- 9. Ausblick
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Deutschlandbilder sudanesischer Deutschlernender und analysiert die Rolle der Landeskunde in diesem Kontext. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Entstehung und Gestaltung dieser Bilder zu gewinnen und daraus Empfehlungen für die Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht im Sudan abzuleiten. Die Arbeit fokussiert auf die individuellen Erfahrungen, Motivationen und Perspektiven der Deutschlernenden sowie die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in Sudan.
- Die Konstruktion von Deutschlandbildern bei sudanesischen Deutschlernenden
- Die Bedeutung der Landeskunde im DaF-Unterricht im Sudan
- Der Einfluss von persönlichen Erfahrungen und kulturellen Einflüssen auf Deutschlandbilder
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen im Kontext der Landeskunde
- Empfehlungen für eine effektive und kultursensible Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht in Sudan
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit, mit Fokus auf die Konstruktion von Nationenbildern, die Rolle der Wahrnehmung und die Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen. Kapitel 2 beleuchtet die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und ihre Ziele im Hinblick auf die Gestaltung eines positiven Deutschlandbildes im Ausland. Kapitel 3 beschreibt konkrete Deutschlandbilder, sowohl aus der Sicht der Deutschen als auch aus der Sicht von Menschen in anderen Ländern. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Geschichte und den verschiedenen Ansätzen der Landeskunde im Fach Deutsch als Fremdsprache, inklusive einer kritischen Analyse des Umgangs mit Stereotypen und Vorurteilen. Kapitel 5 schildert die bildungspolitischen und sozialen Rahmenbedingungen der Deutschlernenden in Khartum und behandelt die Besonderheiten der beiden Institutionen, die dort Deutsch vermitteln: die Universität Khartum und das Deutsch-Sudanesische Kulturinstitut. Kapitel 6 beschreibt die Forschungsmethode, die in dieser Arbeit angewendet wird, und analysiert die Stärken und Schwächen des narrativen Interviews. Kapitel 7 stellt die Ergebnisse der 16 fokussierten Interviews mit sudanesischen Deutschlernenden dar und analysiert diese in Einzelbetrachtungen. Das abschließende Kapitel 8 untersucht die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit und leitet daraus Empfehlungen für die Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht im Sudan ab.
Schlüsselwörter
Deutschlandbilder, Landeskunde, Deutsch als Fremdsprache, Sudan, Qualitative Forschung, Narrative Interviews, Stereotype, Vorurteile, Kulturtransfer, Bildungspolitik, Ausländerfeindlichkeit, Rolle der Frau, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Cultural Studies.
Häufig gestellte Fragen
Welche Deutschlandbilder haben sudanesische Studierende?
Die Bilder sind oft geprägt von einer Mischung aus Stereotypen (Fleiß, Technik, Pünktlichkeit) und persönlichen Erfahrungen aus dem Deutschunterricht sowie Medienberichten über Politik und Wirtschaft.
Welche Rolle spielt die Landeskunde im DaF-Unterricht im Sudan?
Landeskunde dient nicht nur der Informationsvermittlung, sondern auch dem kulturellen Dialog. Sie hilft den Lernenden, deutsche Konzepte besser zu verstehen und eigene Vorurteile zu reflektieren.
Wie entstehen Nationenbilder laut der Wahrnehmungstheorie?
Nationenbilder werden konstruiert. Das Individuum nimmt Informationen selektiv wahr und ordnet sie in vorhandene Schemata (Stereotype und Mythen) ein, um die Komplexität der Fremde zu reduzieren.
Was sind die Ziele der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik?
Sie möchte ein realistisches und positives Bild von Deutschland vermitteln, den interkulturellen Dialog fördern (besonders mit der islamisch geprägten Welt) und die deutsche Sprache weltweit verankern.
Welche Institutionen vermitteln Deutsch in Khartum?
Wichtige Anlaufstellen sind die Deutsche Abteilung der Universität Khartum sowie das Goethe-Institut (Deutsches Kulturinstitut).
- Citation du texte
- Denise Röllig (Auteur), 2004, Deutschlandbilder sudanesischer Deutschlernender, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81659