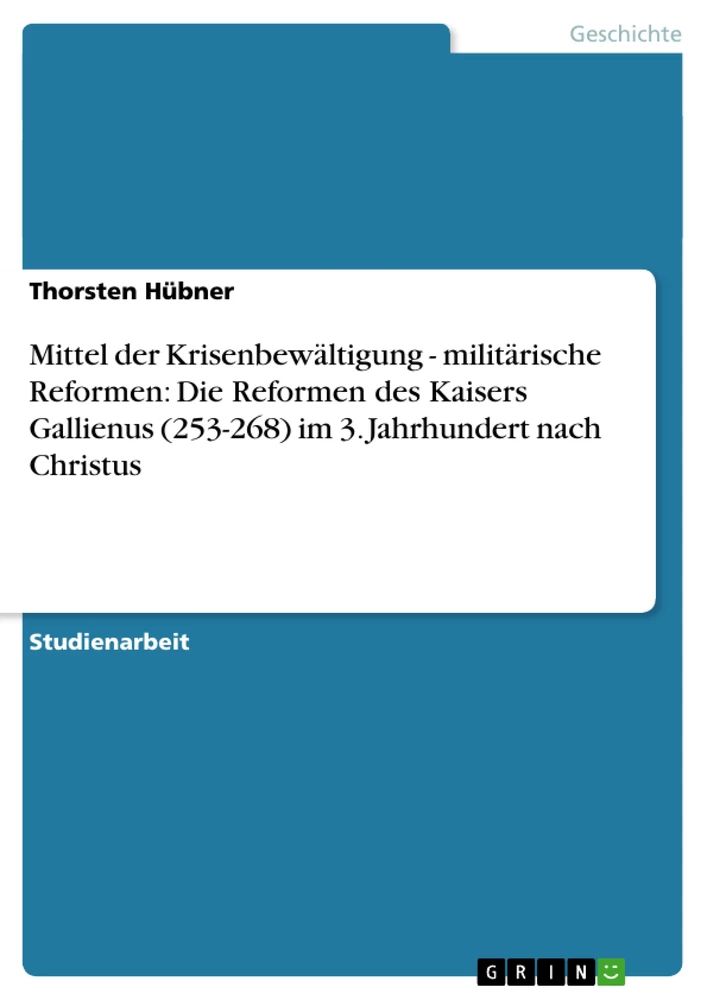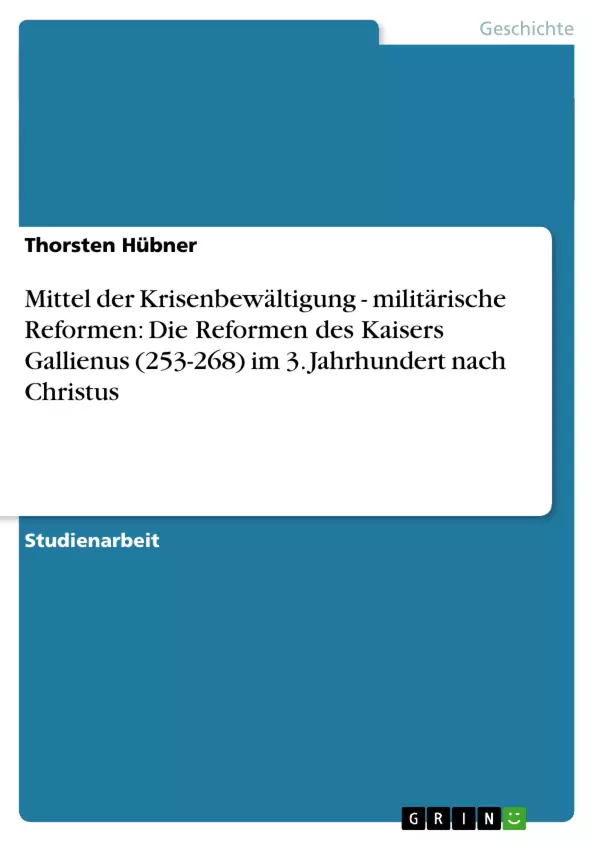Kubakrise, Ölkrise und Asienkrise - für den Historiker gibt es anscheinend verschiedene Gründe, bestimmten Prozessen in der Geschichte, seien sie nah oder fern, eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen und sie als "Krisen" zu bezeichnen. Das Konzept der Krise hat in der Geschichtswissenschaft Konjunktur. Neben den vielen kleinen Krisen, die in der Weltgeschichte auftraten, gibt es derer drei die einer Epoche ihren Namen gaben: die Krise des 3. Jahrhunderts, die Krise des Spätmittelalters (14.Jahrhundert) und die Krise des 17. Jahrhunderts. Wenn von der "Reichskrise des 3. Jahrhunderts" die Rede ist, wird darunter in der Regel die Epoche von 235-284 n.Chr. verstanden. Diese Epoche der römischen Geschichte scheint von einem beispiellosen Niedergang gekennzeichnet zu sein, so daß aus diesen Niedergang schließlich von Althistorikern eine "Weltkrise" oder eine "totale Systemkrise" des römischen Reiches gefolgert wurde, die alle Teile des antiken Lebens erfaßt hat. Es gibt aber eine Reihe von Forschern , die die Vorstellung von einer "Weltkrise" nicht teilen bzw. die Evidenz der Krise in Frage stellen und zugleich neue Perspektiven aufzeigen. Der Niedergang im 3. Jahrhundert stellt für sie einen allmählichen Transformationsprozeß bzw. einen beschleunigten Wandel dar, der räumlich und zeitlich stark differenziert werden muß. Sie gehen nicht von einem vereinfachenden Globalmodell einer "Weltkrise" aus.
Man begegnet in der Epoche der sogenannten "Reichskrise des 3. Jahrhundert" allerdings bestimmten Situationen, die das Krisenkonzept rechtfertigen. Damit ist die Periode von 250 bis 260 n.Chr. gemeint. In diesem Zeitraum wurde die Situation an den Reichsgrenzen des Imperium Romanum mehr als kritisch. Das Zusammentreffen von äußerer Bedrohung (Germanen und Neuperser) und innenpolitischer Instabilität führten zu einer allgemeinen Desorganisation, neben der Instabilität stellte sich eine 15 jährige Herrschaftskontinuität während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus (253-268 n.Chr.) ein, die wohl längste in der Epoche der Krise bzw. der sogenannten "Soldatenkaiser" . Dies erscheint merkwürdig! Auf dem Höhepunkt der militärischen Krise des römischen Reiches hält sich ein Kaiser über 15 Jahre lang und trotzt jeglichen Usurpationsversuchen an denen viele seiner Vorgänger im Amt zugrunde gegangen wären.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Krisenbegriff in der Historiographie
- 1.1. Die Semantik des Begriffs Krise
- 1.2. Bedingungen und Merkmale historischer Krisen
- 1.2.1. Die Bedingungen
- 1.2.2. Die Merkmale
- 2. Die Regierung des Kaisers Valerian (253-260 (?) n.Chr.)
- 3. Die Regentschaft des Gallienus (253-268 n.Chr.)
- 3.1. Biographie
- 3.2. Die Germanenkriege Galliens und der Höhepunkt der militärischen Krise
- 3.3. Die militärischen und administrativen Reformen des Kaisers Gallienus als Mittel zur Bewältigung der Krise
- 3.3.1. Die militärischen Reformen
- 3.3.1.1. Die Heeresreform in den Quellen
- 3.3.1.2. Der Begriff vexillium und die althistorische Debatte um die Reiterreform Galliens
- 3.3.1.3. Die Equites Illyricorum
- 3.3.1.4. Die Equites singulares augusti und die Protectores divini lateris
- 3.3.1.5. Die Equites legionis
- 3.3.2. Die administrativen Reformen - Aurelius Victor zur Trennung von Militär- und Zivilgewalt
- 3.3.1. Die militärischen Reformen
- 3.4. Die religionspolitischen Maßnahmen
- 3.5. Der Erfolg der Reformen
- 4. Die Reformen des Gallienus vor dem Hintergrund der Frage von Krise oder Wandel im 3. Jahrhundert nach Christus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die militärischen Reformen des Kaisers Gallienus (253-268 n.Chr.) im Kontext der sogenannten Reichskrise des 3. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Reformen als Mittel der Krisenbewältigung zu analysieren und deren Erfolg im Hinblick auf die Frage nach Krise oder Wandel in dieser Epoche zu bewerten. Die Arbeit hinterfragt dabei die gängige Darstellung einer umfassenden „Weltkrise“ und berücksichtigt alternative Perspektiven.
- Der Krisenbegriff in der antiken und modernen Geschichtsschreibung
- Die militärische und politische Situation im Römischen Reich unter Gallienus
- Die militärischen Reformen des Gallienus und ihre Umsetzung
- Die administrativen und religionspolitischen Maßnahmen Gallienus
- Bewertung der Reformen und deren langfristige Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „Reichskrise“ des 3. Jahrhunderts ein und diskutiert den vielschichtigen und umstrittenen Begriff der „Krise“ in der Geschichtswissenschaft. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Bewertung der Reformen des Kaisers Gallienus im Kontext der Krise oder eines möglichen Wandels im 3. Jahrhundert und skizziert den Aufbau der Arbeit.
1. Der Krisenbegriff in der Historiographie: Dieses Kapitel analysiert die Semantik des Begriffs „Krise“ und dessen Entwicklung in der Geschichtsschreibung. Es werden verschiedene Interpretationen des Begriffs beleuchtet, von der medizinischen Metapher bis hin zum modernen, oft inflationären Gebrauch. Das Kapitel legt den Grundstein für eine differenzierte Betrachtung der „Reichskrise“ und definiert die Kriterien, die in der Arbeit zur Beurteilung der Situation im 3. Jahrhundert angewendet werden.
2. Die Regierung des Kaisers Valerian (253-260 (?) n.Chr.): Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Regierungszeit von Valerian, dem Vater Gallienus, und skizziert die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war. Es legt den Kontext für die Regierungszeit seines Sohnes und die Notwendigkeit von Reformen dar. Das Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte und den Ausgangspunkt der Krisensituation, die Gallienus dann bewältigen musste.
3. Die Regentschaft des Gallienus (253-268 n.Chr.): Dieses Kapitel stellt die umfangreichste Analyse der Arbeit dar. Es umfasst die Biographie Gallienus, die Germanenkriege als Höhepunkt der militärischen Krise, sowie die detaillierte Darstellung der militärischen und administrativen Reformen. Es untersucht die einzelnen Reformen, ihre Quellenlage und ihre Bedeutung im Kontext der militärischen und politischen Lage. Der Fokus liegt auf der Synthese von militärischen und administrativen Maßnahmen als Reaktion auf die Krise. Das Kapitel beleuchtet auch die religionspolitischen Maßnahmen Gallienus und bewertet den Erfolg seiner Politik.
4. Die Reformen des Gallienus vor dem Hintergrund der Frage von Krise oder Wandel im 3. Jahrhundert nach Christus: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Reformen Gallienus im Kontext der Debatte um „Krise“ oder „Wandel“ im 3. Jahrhundert. Es integriert die vorherigen Kapitel und bietet eine abschließende Bewertung der Reformen und deren Bedeutung für die weitere Entwicklung des Römischen Reiches. Die umfassende Bewertung des Erfolgs der Maßnahmen im Hinblick auf die übergreifende Frage der Krise oder des Wandels steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Reichskrise des 3. Jahrhunderts, Kaiser Gallienus, Heeresreform, militärische Reformen, administrative Reformen, Krisenbegriff, Wandel, Germanenkriege, Römisches Reich, Historiographie, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Militärische und administrative Reformen des Kaisers Gallienus im Kontext der Reichskrise des 3. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die militärischen und administrativen Reformen des römischen Kaisers Gallienus (253-268 n. Chr.) im Kontext der sogenannten „Reichskrise“ des 3. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Bewertung dieser Reformen als Mittel der Krisenbewältigung und ihrer Bedeutung für die Frage nach Krise oder Wandel in dieser Epoche.
Welche Aspekte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht den Krisenbegriff in der antiken und modernen Geschichtsschreibung, die militärische und politische Lage unter Gallienus, seine militärischen und administrativen Reformen (inkl. detaillierter Analyse der Heeresreform), seine religionspolitischen Maßnahmen und schließlich die langfristigen Auswirkungen seiner Politik. Die Arbeit hinterfragt die gängige Darstellung einer umfassenden „Weltkrise“ und berücksichtigt alternative Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse des Krisenbegriffs in der Historiographie, ein Kapitel zur Regierung Valerians und ein umfangreiches Kapitel zur Regierungszeit Gallienus mit detaillierter Darstellung seiner Reformen. Abschließend bewertet ein Kapitel die Reformen im Kontext der Debatte um Krise oder Wandel im 3. Jahrhundert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf antike Quellen, wie z.B. die Schriften von Aurelius Victor, und analysiert diese im Hinblick auf die militärischen und administrativen Reformen Gallienus. Die Quellenlage zu den einzelnen Reformen wird detailliert untersucht und kritisch bewertet. Die Arbeit bezieht auch die althistorische Debatte um den Begriff „vexillium“ und die Reiterreform Galliens mit ein.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die Reformen des Gallienus tatsächlich als erfolgreiche Krisenbewältigung betrachtet werden können oder ob sie eher als Teil eines umfassenderen Wandels im Römischen Reich zu verstehen sind. Die Arbeit hinterfragt den oft verwendeten Begriff der „Reichskrise“ kritisch und prüft alternative Interpretationen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Reichskrise des 3. Jahrhunderts, Kaiser Gallienus, Heeresreform, militärische Reformen, administrative Reformen, Krisenbegriff, Wandel, Germanenkriege, Römisches Reich, Historiographie, Quellenkritik, vexillium, Equites Illyricorum, Equites singulares augusti, Protectores divini lateris, Equites legionis.
Wie wird der Krisenbegriff in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zum Krisenbegriff analysiert dessen Semantik und Entwicklung in der Geschichtsschreibung. Verschiedene Interpretationen werden beleuchtet, um eine differenzierte Betrachtung der „Reichskrise“ zu ermöglichen. Die Arbeit definiert Kriterien zur Beurteilung der Situation im 3. Jahrhundert und wendet diese konsequent an.
Welche Rolle spielt die Regierung Valerians?
Das Kapitel über Valerian bietet einen kurzen Überblick über seine Regierungszeit und die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war. Es dient dazu, den Kontext für die Regierungszeit Gallienus und die Notwendigkeit seiner Reformen zu schaffen. Es beleuchtet die Vorgeschichte und den Ausgangspunkt der Krisensituation.
Wie wird der Erfolg der Reformen bewertet?
Der Erfolg der Reformen wird im letzten Kapitel anhand der gesammelten Ergebnisse und im Kontext der Debatte um "Krise" oder "Wandel" umfassend bewertet. Die langfristigen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Entwicklung des Römischen Reiches werden berücksichtigt.
- Citation du texte
- Thorsten Hübner (Auteur), 2002, Mittel der Krisenbewältigung - militärische Reformen: Die Reformen des Kaisers Gallienus (253-268) im 3. Jahrhundert nach Christus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8169