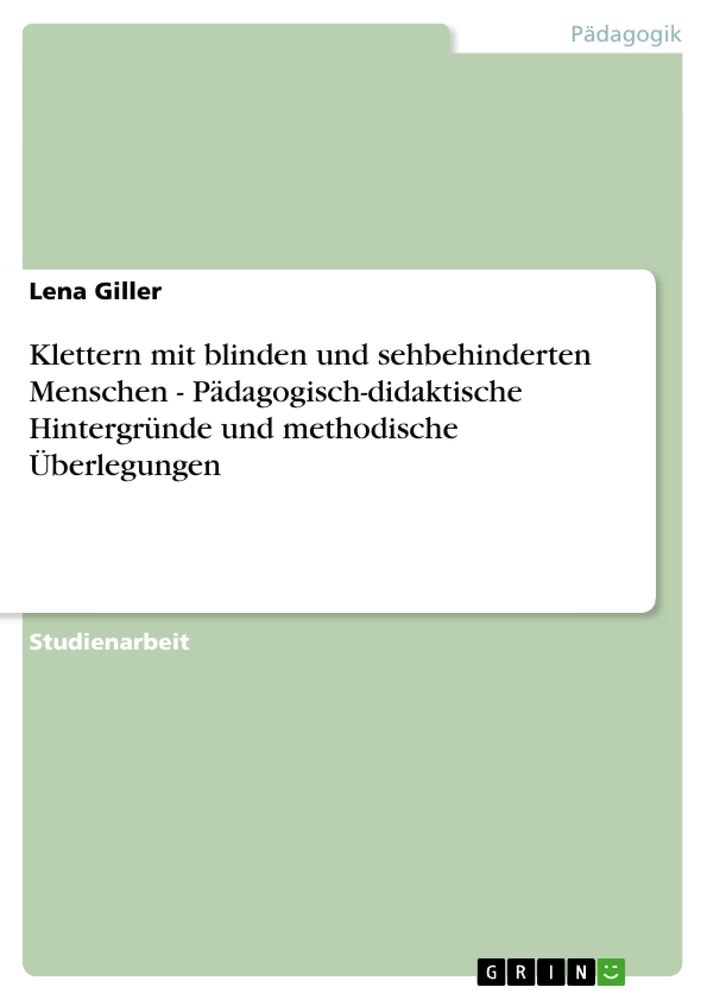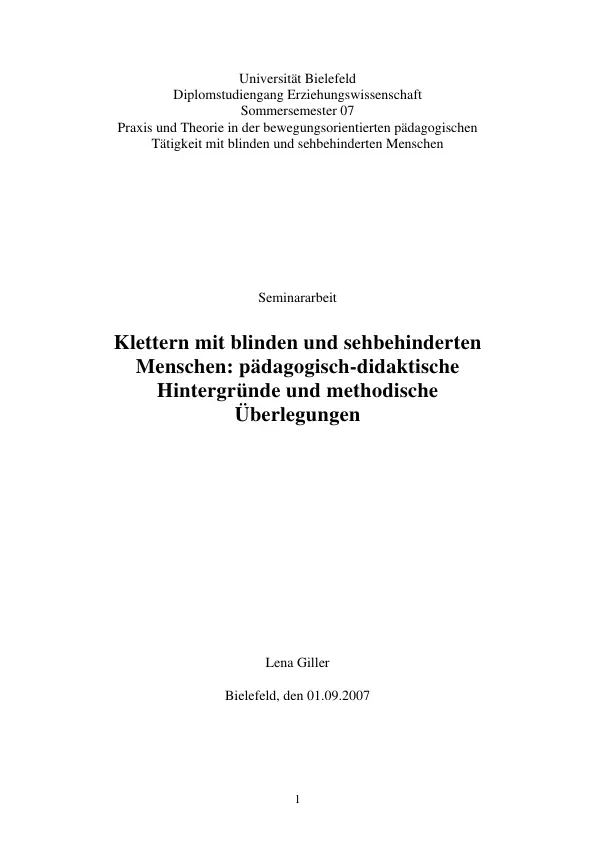Sportliche Aktivitäten für Sehgeschädigte verbinden viele Menschen mit unüberwindbaren Hindernissen und Schwierigkeiten oder empfinden es sogar als unvorstellbar. Vor diesem Hintergrund scheint Klettern unvereinbar mit einer Sehschädigung, da gerade diese Sportart mit Risiken verbunden ist und der kleinste Fehler zu schweren Verletzungen führen kann. Wie sollen Personen, die im Alltag größtenteils auf Hilfestellungen angewiesen sind, sich alleine an einer Kletterwand oder sogar an einem Bergfels orientieren? Wie sollen sie ohne vollständiges Augenlicht den Partner risikolos sichern können?
In dieser Arbeit möchte ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass Klettern nur für Sehende möglich ist und zeigen, dass gerade diese Sportart für blinde oder sehbehinderte Menschen sehr geeignete ist. Genauso setzte ich mich aber auch mit den Schwierigkeiten und eventuellen Grenzen auseinander.
Einführend in die Thematik differenziere ich zwischen einer medizinisch orientierten Klassifikation und einer eher pädagogisch orientierten Definition. Unterschieden wird hierbei zwischen den Begriffen Sehbeeinträchtigung, Sehbehinderung, hochgradige Sehbehinderung und Blindheit. Diese Differenzierung empfinde ich als sehr wichtig, da eine Sehschädigung fälschlicher weise häufig gleichgesetzt wird mit einer völligen Blindheit. Hierbei wird völlig außer Acht gelassen, dass verschiedene Formen einer Sehschädigung auch unterschiedliche Anforderungen an die Pädagogik stellen.
Im Hauptteil meiner Arbeit befasse ich mich mit didaktisch-methodischen Aspekten des Kletterns bei blinden und sehgeschädigten Menschen. Hierbei ist die Vermittlung von Sicherungstechniken unerlässlich. Erst wenn diese Techniken problemlos beherrscht werden, sollten weitere Klettertechniken vermittelt werden. An einer Schule für Sehgeschädigte Kinder wurde die Unterrichtseinheit Klettern durchgeführt, bei der die Schüler an Kletterstationen unterschiedliche Bewegungsabläufe kennen lernen konnten. Ich habe diese Unterrichtseinheit für meine Arbeit genutzt, um beispielhaft darstellen zu können, welche methodischen Überlegungen beim Vermitteln des Kletterns sinnvoll sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Medizinisch orientierte Klassifikationen
- Pädagogisch orientierte Klassifikationen
- Klettern mit sehgeschädigten Menschen:
- Vorteile des Kletterns
- Grenzen beim Klettern mit blinden und sehbehinderten Menschen
- Methodisch-didaktische Überlegungen des Vermittelns
- Unterrichtseinheit Sicherungstechniken
- Selbstsicherung
- Partnersicherung
- Unterrichtseinheit Klettern
- Unterrichtseinheit Sicherungstechniken
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Vorurteil zu widerlegen, dass Klettern nur für sehende Menschen möglich ist. Sie argumentiert, dass Klettern, trotz der Risiken, eine sehr geeignete Sportart für blinde und sehbehinderte Menschen sein kann. Gleichzeitig werden die Schwierigkeiten und Grenzen dieser Sportart für diese Personengruppe beleuchtet.
- Differenzierung zwischen medizinischen und pädagogischen Klassifikationen von Sehschädigungen.
- Vorteile des Kletterns für sehgeschädigte Menschen.
- Spezifische Herausforderungen und Grenzen beim Klettern mit blinden und sehbehinderten Menschen.
- Methodisch-didaktische Überlegungen zur Vermittlung von Sicherungstechniken und Klettertechniken.
- Praktische Umsetzung in einer Unterrichtseinheit Klettern an einer Schule für sehgeschädigte Kinder.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Kletterns für sehgeschädigte Menschen vor und erläutert den Fokus der Arbeit, der auf der Widerlegung des Vorurteils einer Unvereinbarkeit von Klettern und Sehschädigung liegt. Die Begriffsklärung differenziert zwischen medizinischen und pädagogischen Definitionen von Sehschädigungen und beleuchtet die Bedeutung dieser Unterscheidung für die pädagogische Praxis. Das Kapitel über Klettern mit sehgeschädigten Menschen analysiert die Vorteile dieser Sportart und die spezifischen Herausforderungen, die sich aufgrund der Sehschädigung ergeben. Die methodisch-didaktischen Überlegungen konzentrieren sich auf die Vermittlung von Sicherungstechniken und Klettertechniken und stellen ein Praxisbeispiel an einer Schule für sehgeschädigte Kinder vor.
Schlüsselwörter
Sehschädigung, Sehbehinderung, Blindheit, Klettern, Sicherungstechnik, Partnersicherung, Selbstsicherung, methodisch-didaktische Überlegungen, Unterrichtseinheit, Pädagogik, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Ist Klettern für blinde Menschen sicher möglich?
Ja, unter Einhaltung spezieller Sicherungstechniken und mit geschulten Partnern ist Klettern für blinde und sehbehinderte Menschen eine sehr geeignete Sportart.
Welche Vorteile bietet Klettern für sehgeschädigte Menschen?
Es fördert das Körpergefühl, die Orientierung, das Vertrauen in andere und das Selbstbewusstsein durch das Überwinden physischer Hindernisse.
Wie orientieren sich blinde Kletterer an der Wand?
Die Orientierung erfolgt primär taktil durch das Ertasten von Griffen und Tritten sowie durch akustische Hinweise des Sicherungspartners.
Was sind die pädagogischen Klassifikationen von Sehschädigungen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Sehbeeinträchtigung, Sehbehinderung, hochgradiger Sehbehinderung und Blindheit, da jede Form andere Anforderungen an die Didaktik stellt.
Welche Sicherungstechniken sind besonders wichtig?
Die Vermittlung von Selbst- und Partnersicherung ist unerlässlich und muss absolut sicher beherrscht werden, bevor komplexe Kletterbewegungen erlernt werden.
- Quote paper
- Lena Giller (Author), 2007, Klettern mit blinden und sehbehinderten Menschen - Pädagogisch-didaktische Hintergründe und methodische Überlegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81762