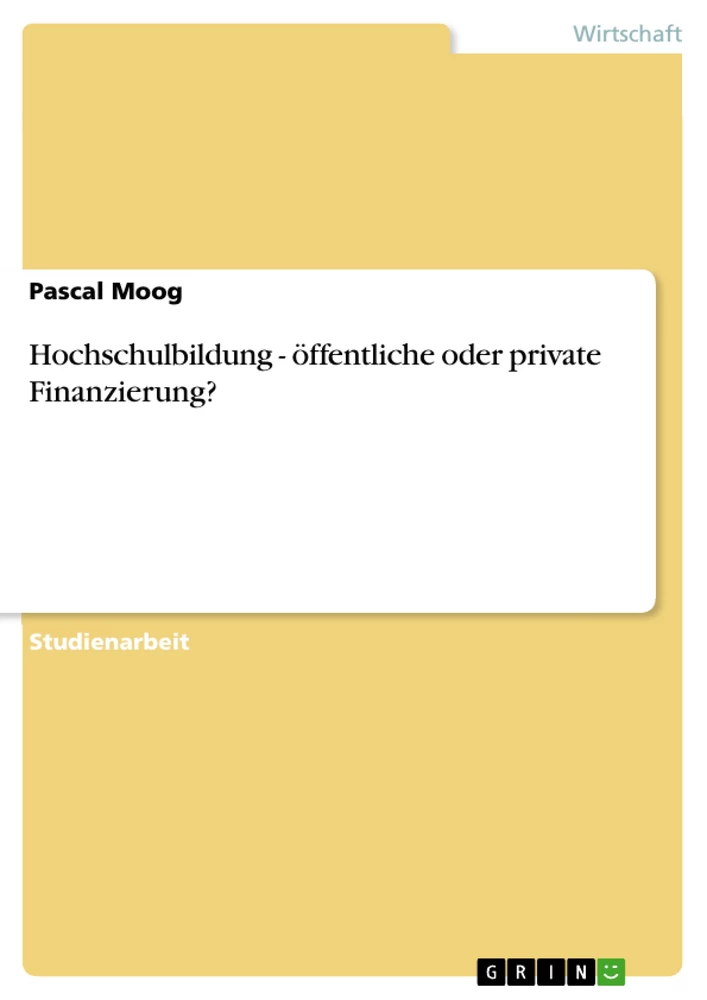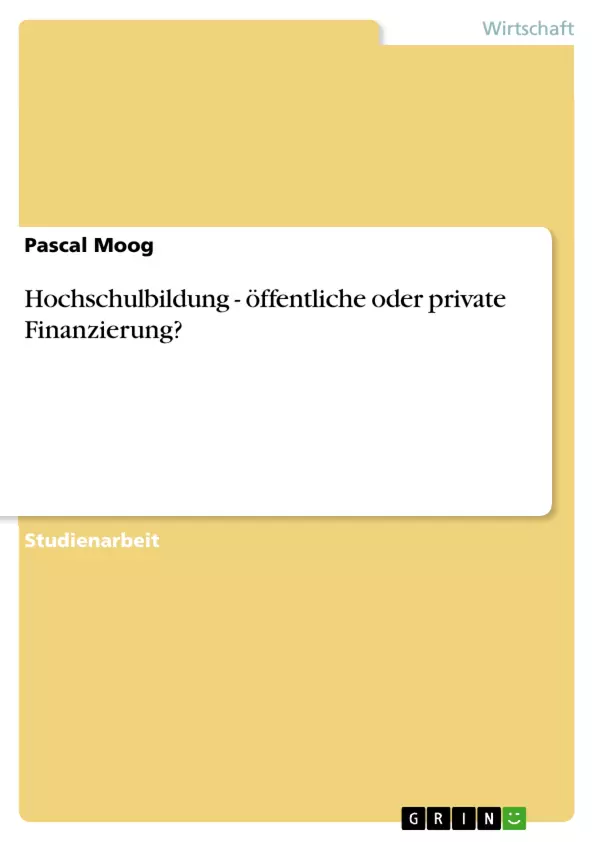„Die Krankenschwester finanziert das Studium des Chefarztes“. Dieses These bezüglich der bisher in Deutschland gängigen Studienfinanzierung aus Steuereinnahmen spiegelt die allgemeine Auffassung von einer „Umverteilung von arm zu reich“ wider. Seit mehreren Jahren ist eine heftige Debatte um die öffentliche Bereitstellung von Hochschulbildung entbrannt, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26.01.2005, welches das bis dato existierende Verbot von Studiengebühren aufhob und die Entscheidungshoheit an die Landesregierungen zurück übertrug, nochmals an Brisanz zugelegt hat. Die von Jahr zu Jahr finanziell schlechtere Lage der deutschen Hochschulen, die aufgrund der begrenzten öffentlichen Mittelzuweisungen durch die staatliche Subventionierung zu enormen Sparmaßnahmen greifen mussten, führte in Verbindung mit steigenden Studierendenzahlen zu spürbaren Qualitätseinbußen insbesondere bei der Lehre. Als Begründung für die nun in den meisten Bundesländern eingeführten Studiengebühren, die beileibe kein unumstrittenes Allerheilmittel darstellen, wird deshalb neben einer erwarteten Effizienzsteigerung der Lehre auch eine finanzielle Verbesserung der Lage der Hochschulen angeführt.
Hochschulbildung ist auf der einen Seite ein Investitionsgut, das der Erzielung des zukünftigen Einkommens dient, auf der anderen Seite aber auch ein Konsumgut, aus dem der Gebildete persönlichen Nutzen in privaten, ästhetischen oder politischen Lebensbereichen ziehen kann. Im Rahmen dieser Seminararbeit soll deshalb ökonomisch untersucht werden, ob Hochschulbildung aus verteilungspolitischer und effizienzorientierter Sichtweise besser öffentlich oder privat finanziert werden sollte. Hierbei werden auch entsprechende vorliegende internationale Studien, größtenteils für den deutschsprachigen Raum, näher betrachtet. Neben der Möglichkeit der Studiengebühren werden andere Alternativen der angebotsorientierten und nachfrageorientierten Bildungsfinanzierung aufgezeigt. Der Spezialfall der privaten Hochschulen wird dabei gesondert behandelt.
2. Die Grundstruktur der Finanzierung der Hochschulbildung in Deutschland
In vielen Bundesländern werden seit kurzem Studiengebühren auch für das Erststudium erhoben. Andere Bundesländer folgen in naher Zukunft. Vor Einführung der Studiengebühren hatte die Hochschulbildungsfinanzierung in Deutschland eine einfache Grundstruktur. Das Lehrangebot wurde überwiegend...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Die Grundstruktur der Finanzierung der Hochschulbildung in Deutschland
- Gutscharakter von Hochschulbildung
- Effizienzaspekte
- Verteilungsaspekte
- Definition Längsschnitt- und Querschnittanalyse
- Empirische Studien
- Studien in den USA
- Studien für den deutschsprachigen Raum
- Spezielle Hochschulfinanzierungssysteme
- Spezialfall: Private Hochschulen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die ökonomischen Aspekte der Finanzierung von Hochschulbildung in Deutschland und analysiert, ob eine öffentliche oder private Finanzierung aus verteilungspolitischer und effizienzorientierter Sichtweise sinnvoller ist. Dabei werden auch internationale Studien, vor allem für den deutschsprachigen Raum, berücksichtigt.
- Analyse des Gutscharakters von Hochschulbildung
- Bewertung von Effizienzargumenten für eine öffentliche Finanzierung
- Untersuchung von Verteilungsaspekten der Hochschulfinanzierung
- Behandlung verschiedener Modelle der Hochschulfinanzierung
- Spezialfall: Die Rolle privater Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung stellt die Problematik der Finanzierung von Hochschulbildung in Deutschland dar und erläutert die zunehmende Debatte um Studiengebühren. Sie skizziert die Forschungsfrage der Seminararbeit, die sich mit der Frage der optimalen Finanzierungsform beschäftigt.
- Die Grundstruktur der Finanzierung der Hochschulbildung in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die traditionelle Finanzierungsstruktur der Hochschulen in Deutschland, die auf einer Aufteilung zwischen staatlichen und privaten Mitteln basiert. Die Einführung von Studiengebühren und die Auswirkungen auf die Kostenbeteiligung von Studierenden werden analysiert.
- Gutscharakter von Hochschulbildung: Kapitel 3 widmet sich der Frage, welcher Art von Gut Hochschulbildung zuzuordnen ist. Es werden die verschiedenen Gutskategorien (öffentliches Gut, privates Gut, gemischtes Gut, meritorisches Gut) definiert und anhand von Kriterien auf Hochschulbildung angewendet.
- Effizienzaspekte: Dieses Kapitel beleuchtet die effizienzorientierten Argumente für einen staatlichen Eingriff in den Bildungsmarkt. Es untersucht positive externe Effekte der Hochschulbildung, die als Begründung für eine öffentliche Finanzierung dienen können.
- Verteilungsaspekte: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Untersuchung der Verteilungsaspekte der Hochschulfinanzierung. Es werden die Begriffe Längsschnitt- und Querschnittanalyse definiert und empirische Studien aus den USA und dem deutschsprachigen Raum betrachtet.
- Spezielle Hochschulfinanzierungssysteme: Kapitel 6 befasst sich mit verschiedenen Modellen der Hochschulfinanzierung und diskutiert alternative Ansätze zur traditionellen Finanzierung.
Schlüsselwörter
Hochschulbildung, Finanzierung, öffentliche Finanzierung, private Finanzierung, Studiengebühren, Effizienz, Verteilung, externe Effekte, Marktversagen, Gutskategorien, internationale Studien, deutschsprachiger Raum.
Häufig gestellte Fragen
Sollte Hochschulbildung öffentlich oder privat finanziert werden?
Die Seminararbeit untersucht diese Frage aus effizienzorientierter und verteilungspolitischer Sicht unter Berücksichtigung internationaler Studien.
Was änderte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2005?
Es hob das Verbot von Studiengebühren auf und übertrug die Entscheidungshoheit über deren Einführung an die Landesregierungen.
Ist Hochschulbildung ein öffentliches oder ein privates Gut?
Die Arbeit analysiert den Gutscharakter und zeigt auf, dass sie sowohl Merkmale eines Investitionsgutes als auch eines Konsumgutes besitzt.
Führen Studiengebühren zu einer besseren Qualität der Lehre?
Ein Argument für Gebühren ist die erwartete Effizienzsteigerung und die finanzielle Verbesserung der Hochschulen bei steigenden Studierendenzahlen.
Was bedeutet die These „Die Krankenschwester finanziert den Chefarzt“?
Sie beschreibt die Kritik an der rein steuerfinanzierten Bildung als eine Umverteilung von Geringverdienern zu zukünftigen Besserverdienern.
- Arbeit zitieren
- Pascal Moog (Autor:in), 2007, Hochschulbildung - öffentliche oder private Finanzierung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81793