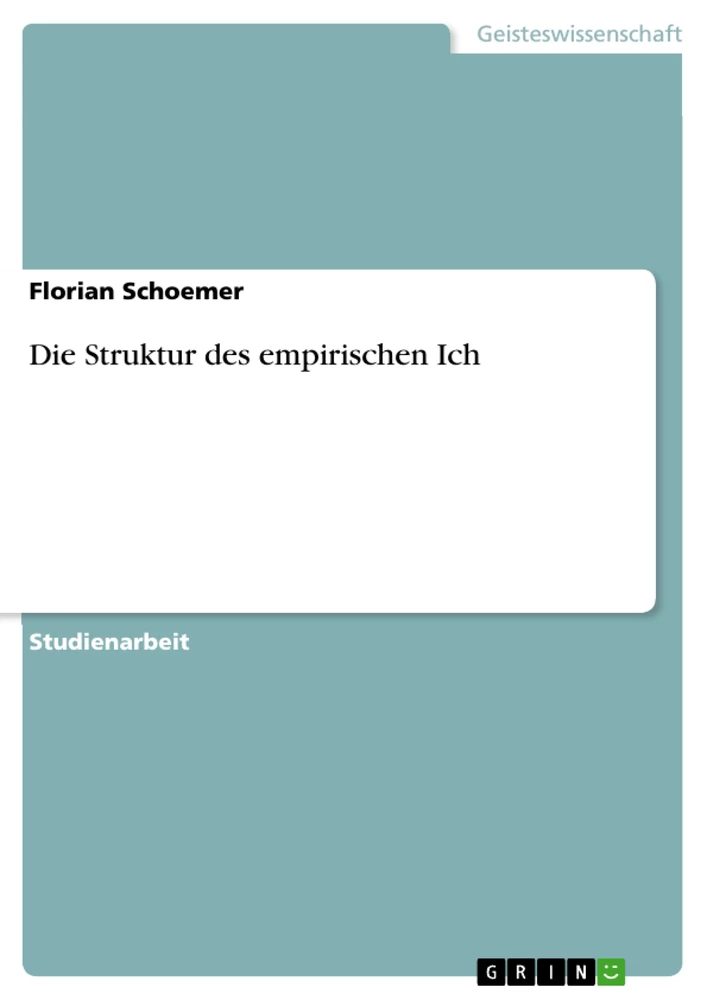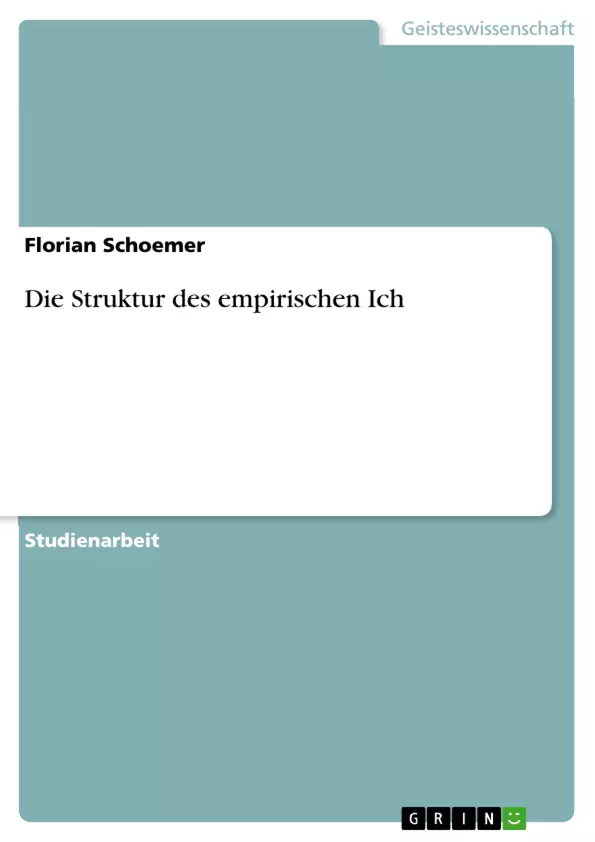Im Rahmen der Einarbeitungszeit für diese Seminararbeit habe ich mich mit einem Kuriosum der Menschheitsgeschichte und vor allem der Philosophie beschäftigt. Die Rede ist vom Ego oder Ich als Träger der grundeigenen, individuellen Wesenheit und dem Ich, über das sich jede Person mit dem ihr eigenen Körper identifiziert.
Denn jeder Mensch, der sich als Individuum versteht, tut dies über eine innere Gliederung, die Struktur seines Ich, die ihm diese Individualität verschafft. Jedes Denken, jede Kommunikation, schlicht und ergreifend jede Handlung vollzieht sich im Lichte dieses Ich, das sich im Kontakt mit der äußeren Realität von dieser als Subjekt, oder Ich differenziert.
Das Ich identifiziert sich mit der zentralen Instanz unserer Persönlichkeit, es bezieht sich auf das Selbst, die eigene Person im Gegensatz zum Äußeren, unterschiedenem, dem Objekt. Es ruft ein Ichbewußtsein wach, das einerseits die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens darstellt, obwohl andererseits niemand in der Lage ist, sein Ego und dessen innere Struktur genau zu bezeichnen.
Dieses uns nicht zugängliche, Spekulationen und Interpretationen offenlassende Dasein des Ich, hat enorme Auswirkungen auf die Philosophie des Abendlandes. Denn, so Kant, ,, das empirische Ich kann sich selbst nur erfahren, weil es anderes, Äußeres erfährt."2
Diese Aussage, die ich hier als Aufhänger des westlichen Denkens bezeichnen möchte, impliziert eine Unterscheidung zwischen dem Ich und der Welt, den Dualismus von Subjekt und Objekt. Genau auf dieser Differenzierung des Subjekts von der restlichen äußeren Realität ( Objekte ) basiert jede westliche Epistemologie.
Im Gegensatz dazu stehen die Vorstellungen des Zen-Buddhismus, der versucht dem empirischen Ich entgegenzuwirken.
Die folgenden Seiten zielen darauf ab, mit dem Hintergrund des westlichen, logisch-analytischen Denkens, den konträren philosophischen Lösungsansatz des Zen und seine Vorstellung von der Wirklichkeit herauszustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Struktur des empirischen Ich
- Was ist Zen?
- Die Welt ist ein einziger Geist
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Struktur des empirischen Ichs und setzt sich mit den unterschiedlichen philosophischen Ansätzen des Westens und des Zen-Buddhismus auseinander. Dabei wird der Dualismus von Subjekt und Objekt im westlichen Denken beleuchtet und der Ansatz des Zen, der die Einheit von Geist und Welt postuliert, kontrastiert.
- Struktur des empirischen Ichs
- Dualismus von Subjekt und Objekt
- Westliches Denken vs. Zen-Buddhismus
- Erkenntnistheorie und Selbstbewußtsein
- Anti-Intellektualismus des Zen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit stellt das empirische Ich als zentrales Thema vor und erläutert seine Bedeutung im Kontext des westlichen Denkens. Es wird auf den Dualismus von Subjekt und Objekt sowie die Rolle des Ich-Bewusstseins eingegangen.
- Die Struktur des empirischen Ich: Dieses Kapitel beleuchtet die Konzeption des Ichs als Einheitsgrund der Akte eines geistigen Individuums und die Rolle der Erfahrung für die Erkenntnis des Ichs. Es wird auf Kants Auffassung vom empirischen Ich und die Unterscheidung zwischen Ich und Welt eingegangen.
- Was ist Zen?: Der Abschnitt widmet sich der Philosophie des Zen-Buddhismus und beschreibt seinen Ansatz, der dem Dualismus des westlichen Denkens entgegenwirkt. Es wird auf die Bedeutung des meditativen Systems im Zen und die Abkehr von der logischen Erklärung der Welt eingegangen.
Schlüsselwörter
Empirisches Ich, Subjekt, Objekt, Dualismus, Zen-Buddhismus, westliches Denken, Erkenntnis, Selbstbewußtsein, Anti-Intellektualismus, Meditation, Wirklichkeit, Einheit von Geist und Welt.
- Quote paper
- Florian Schoemer (Author), 1997, Die Struktur des empirischen Ich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/821