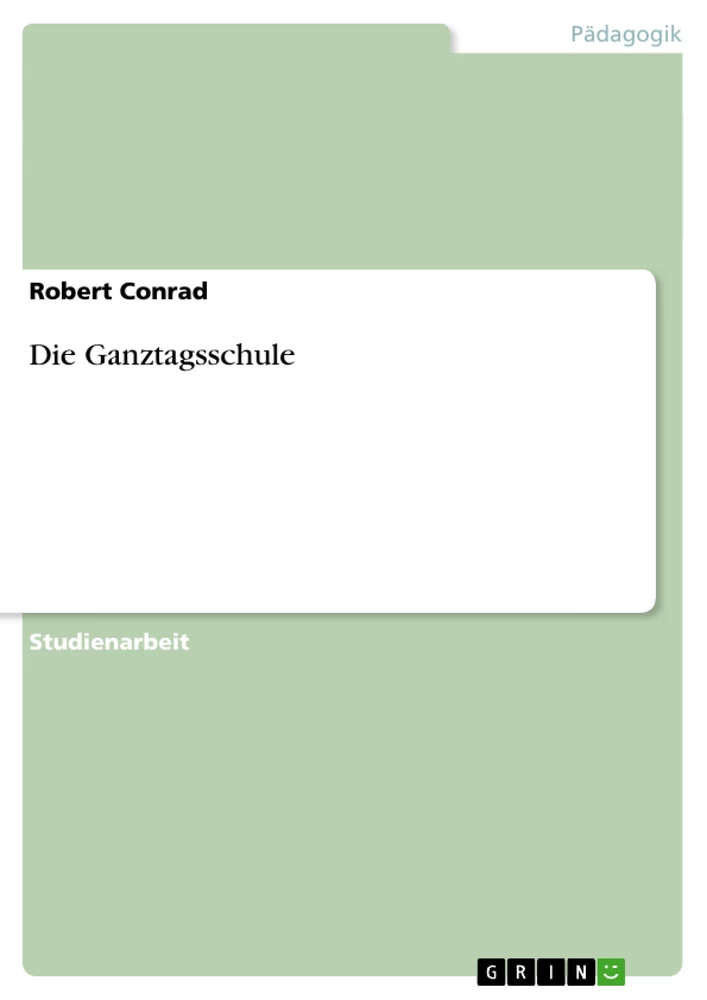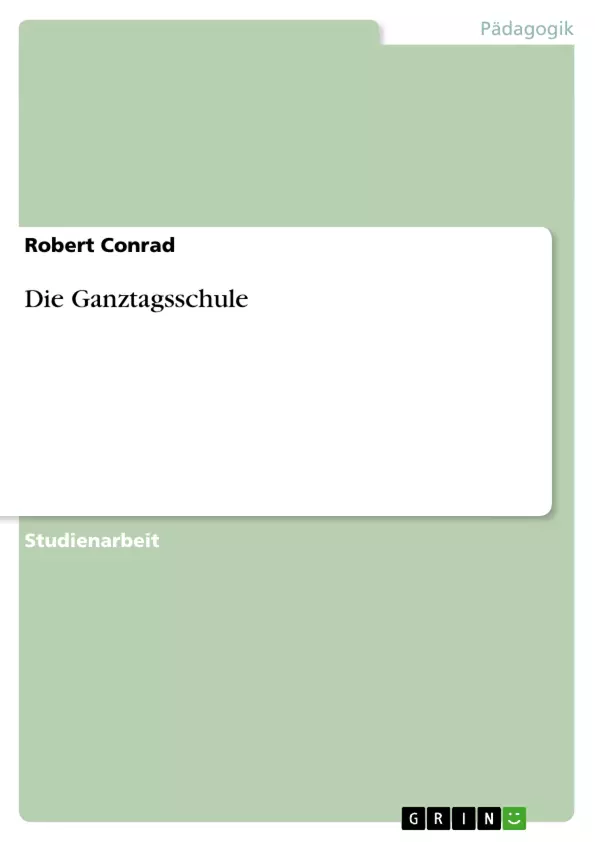Heinz Günter Holtappels
Wieviel Schule brauchen wir?
1 Mehr oder weniger Schule?
Zur Neubestimmung der Funktionen der Schule
1.1 Argumente zur Verschulungskritik
Bezogen auf herkömmliche Stundenschulen, aber auch auf einige der bestehenden Ganztagsschulen, lassen sich folgende Verschulungskriterien festhalten:
[...]
Inhalt
1 Mehr oder weniger Schule?
Zur Neubestimmung der Funktion der Schule
2 Ein scheinbares Paradoxon: Ganztagsschule als Antwort auf die Entschulungsdebatte
3 Ganztagsschule durch Öffnung von Schule
4 Fazit
5 Thesen und Fragen
6 Literatur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Heinz Günter Holtappels
Wieviel Schule brauchen wir?
1 Mehr oder weniger Schule?
Zur Neubestimmung der Funktionen der Schule
1.1 Argumente zur Verschulungskritik
Bezogen auf herkömmliche Stundenschulen, aber auch auf einige der bestehenden Ganztagsschulen, lassen sich folgende Verschulungskriterien festhalten:
- Lerninhalte sind oft nicht wirklichkeitsbezogen /-relevant (343)
es wird Stoff vermittelt, der in der Alltagswelt kaum angewendet wird
- starrer Zeitrhythmus (343)
Unterrichtsstunden im strengen 45 Minuten Takt
- Monofunktionalität von Schulräumen (343)
in den Unterrichtssälen wird nur Unterrichtet, die Schüler verlassen in den Pausen den Unterrichtssaal
- zusammenhangloses Lernen (343)
die einzelnen Lehrinhalte werden ohne Zusammenhang vermittelt
- Leistungsdruck (343)
Hausaufgaben, Referate, Arbeiten, Noten und Zeugnisse fordern permanent Leistung, die sich sowohl negativ auf die Psyche des Schülers als auch auf sein Sozialverhalten auswirken können
- wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schüler (343)
der Schüler steht am Ende der Schulhierarchie und hat daher „brav“ die Anweisungen seiner Lehrer zu befolgen
- Zwangscharakter (Anwesenheitspflicht) (344)
im Gegensatz zur Universität herrscht Anwesenheitspflicht, Schüler können Schulstunden, die sie nicht interessieren, oder über deren Inhalt sie bereits bescheid wissen, nicht fernbleiben
- hierarchischer Charakter (345)
wie im letzten Referat (22.05.2001 „Die Schule als eine besondere soziale Organisation“) bereits erwähnt, ist die Schule Teil eines komplizierten hierarchisch-organisierten bürokratischen Apparates, indem die Lehrer kaum eigenständig handeln können, da von oben einseitig bestimmt wird
- Öffentlichkeitscharakter (Privatsphäre wird eingeschränkt; permanente soziale Kontrolle) (345)
Schüler haben von Schulbeginn (morgens 8 Uhr) bis Schulschluss (13 Uhr) nicht die Möglichkeit sich zurückzuziehen, da sie permanent von Mitschülern und Lehrern umgeben und damit sozial kontrolliert werden.
Eine Bewertung dieser Aspekte wird dann in Form des Beitrags der Ganztagsschule zur Entschulung auf Seite 7 dargestellt.
1.2 Argumente für das Fortbestehen der Schule
1.2.1 Bildungs- und qualifikationstheoretische Aspekte:
- Kinder und Jugendliche werden durch die Medien über das gesellschaftliche Wissen frühzeitig und schonungslos aufgeklärt (346)
- Chancen und Risiken dieses Umstandes (346):
- Inhalte können gut aufbereitet sein (besser als in der Schule)
- Inhalten können schlecht aufbereitet sein (z. B. durch versteckten Botschaften, wie Werbung, Politik oder nicht altersgemäßem Niveau ð Verwirrung, Fehlinterpretation von Seiten der Jugendlichen)
- Schule kann orientierend, interpretierend, ordnend und systematisch Stoff aufarbeiten
- Schule kann Informationsüberflutung mit Überblickswissen kompensieren (z. B. durch Medienerziehung) (346/347)
- Vermittlung von Wissen, das von Seiten der Familie nicht unbedingt vermittelt wird (z. B. bestimmte sozialisierende Aspekte)
- als zukunftsrelevante Bildungsinhalten gelten daher (Mertens 1974, 1988) (347):
- Friedens-
- Umwelt-
- Medien-
- Gesundheitserziehung
- Vorbereitung auf Erziehungsaufgaben
- Umgang mit Informationssystemen
- Umgang mit Rechtsvorschriften
Wobei diese Bildungsinhalte teilweise heute schon in gewissem Umfang in den Schulen vermittelt werden.
- Schlüsselqualifikationen: (347)
- logisches, analytisches und schlussfolgerndes Denken
- strukturierende und konzeptionelle Fähigkeiten
- antizipatorische Fähigkeiten
- dispositives und kontextuelles Denken
- Medienkunde
- Fachsprachenkunde
- Verstehen technischer Pläne
- Umgang mit Bibliotheken
1.2.2 Sozialisationstheoretische und sozial-integrative Aspekte:
- fördert soziale Integration (349)
- bietet Kontaktmöglichkeiten (349)
- Kommunikation (350)
- Interaktion (bietet das TV nicht) (R. C.)
- Kooperation (350)
- Partizipation (350)
- Ausbildung einer Identität (349)
- erlernen von Rollenverhalten (350)
- Selbstständigkeit (lernen) (350)
Es scheint, als ob keine andere Institution außer der Schule geeigneter wäre Kindern und Jugendlichen dieses umfassende Bildungswissen zu vermitteln.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Welche Kritikpunkte gibt es an der herkömmlichen "Stundenschule"?
Kritisiert werden der starre 45-Minuten-Rhythmus, mangelnder Wirklichkeitsbezug der Inhalte, hoher Leistungsdruck und wenig Mitbestimmung der Schüler.
Kann die Ganztagsschule zur "Entschulung" beitragen?
Ja, durch die Öffnung der Schule und flexiblere Strukturen kann der Zwangscharakter gemildert und ein lebensnäheres Lernen ermöglicht werden.
Welche gesellschaftlichen Funktionen erfüllt die moderne Schule?
Schule dient der Vermittlung von Orientierungswissen, der sozialen Integration, der Ausbildung von Identität und der Vorbereitung auf das Berufsleben.
Was sind zukunftsrelevante Bildungsinhalte?
Dazu zählen Friedens-, Umwelt-, Medien- und Gesundheitserziehung sowie der kompetente Umgang mit Informationssystemen.
Wie fördert Schule die soziale Integration?
Sie bietet Kontaktmöglichkeiten, Raum für Kommunikation, Interaktion und das Erlernen von Kooperation sowie Rollenverhalten.
- Citation du texte
- Robert Conrad (Auteur), 2001, Die Ganztagsschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8227