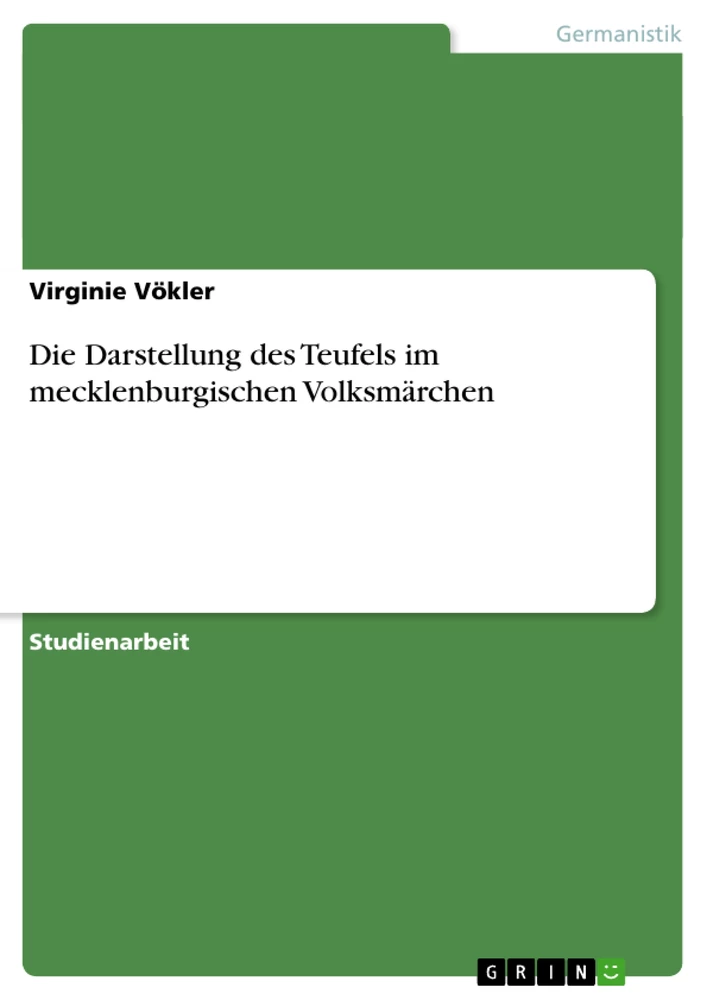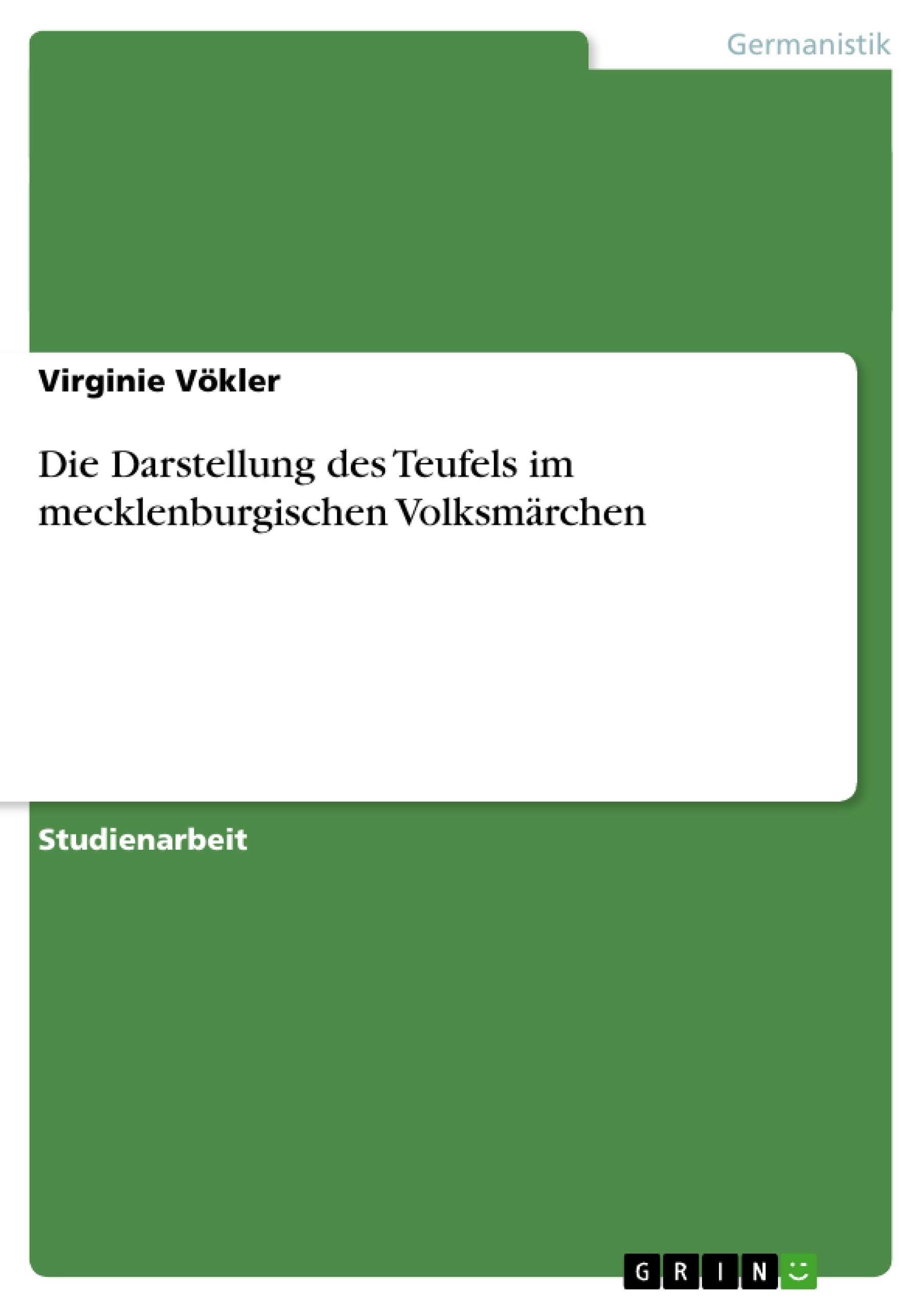Märchen verfügen, im Gegensatz zu anderen literarischen Gattungen, über den Vorzug, dass das Wunderbare und Sonderliche keiner weiteren Erklärung bedarf. Die Faszination Märchen ist wohl im deutschsprachigen Raum stark durch die Grimmsche Märchensammlung geprägt. Allerdings geht die Märchenforschung weit darüber hinaus, da diese Sammlung zum einen keine vollständige Sammlung aller Märchen und ihrer Varianten darstellt, zum anderen wurden die traditionellen Volksmärchen oftmals mit dichterischer Freiheit aufgepeppt. Die Ursprünglichkeit der Volksmärchen ist wohl in den verschiedenen regionalen Sammlungen besser erhalten und zeigt mehr von ihrer Charakteristik als überlieferte mündliche Erzählung. In meiner Abhandlung möchte ich mich näher mit den Volksmärchen Mecklenburg-Vorpommerns auseinander setzten. Hierbei soll der Teufel in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen gerückt werden, der auf Grund seines eigenen übernatürlichen Charakter im Zaubermärchen auftritt. Zaubermärchen sind neben Tiermärchen und Novellenmärchen ein Untertyp des Märchens, die eine Wunderwelt für sich beanspruchen, die nicht hinterfragt wird. Um das Auftreten und die Darstellung des Teufels im mecklenburgischen Volksmärchen weiter zu klassifizieren, möchte ich zunächst auf dessen Darstellung im christlichen Weltbild, sowie im Volksglauben eingehen. Darüber hinaus soll die generelle Vorstellung und Verarbeitung des Teufelmotivs im Märchen allgemein untersucht und gegebenenfalls Übereinstimmungen oder auch Unterschiede mit den traditionellen Bildern des Teufels aufgezeigt werden. Dies soll dann zu einer genaueren Analyse des teuflischen Aspektes ganz speziell in mecklenburgischen Volksmärchen führen. Wobei ich auf typische, dem Teufel zugeschriebene, Motive eingehen werde. Es soll die Frage geklärt werden, ob er tatsächlich immer die Figur des Widersachers gegen das Gute spielt oder ob er diese ihm durch das Christentum auferlegte Rolle durchaus mal ablegen kann. Hierbei soll aufgewiesen werden, ob die polaren Gegensätzen von Gut und Böse zum Tragen kommen, außerdem ob das Auftreten des Teufel auch eine glückliche Wendung für den Helden des Märchens, der durch scheinbar unlösbare Aufgaben in einen Konflikt geraten ist, sein kann. Auch auf das Motiv des Seelenfangens durch den Teufel soll in meinen Ausführungen eingegangen werden, wobei der Teufelspakt als solcher nicht außer Acht gelassen werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Teufel im Traditionellen Weltbild
- 2.1 Der Teufel im Christentum
- 2.2 Der Teufel im Volkslauben
- 3. Der Teufel im Märchen
- 3.1 Der Teufel im Zaubermärchen
- 3.2 Der Teufel im Mecklenburgischen Volksmärchen
- 4. Schluss: Der Teufel bleibt doch Teufel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit der Darstellung des Teufels in mecklenburgischen Volksmärchen. Sie untersucht, wie der Teufel in der traditionellen Vorstellungswelt, im Christentum und im Volksglauben, dargestellt wird und wie diese Bilder in Märchen verarbeitet werden. Die Analyse konzentriert sich auf die typischen Motive, die dem Teufel zugeschrieben werden, und beleuchtet, ob er immer die Rolle des Widersachers gegen das Gute spielt, oder ob er diese Rolle ablegen kann.
- Die Darstellung des Teufels im christlichen Weltbild
- Die Darstellung des Teufels im Volksglauben
- Die Verarbeitung des Teufelmotivs im Märchen
- Die Rolle des Teufels im mecklenburgischen Volksmärchen
- Die Frage, ob der Teufel immer den Widersacher gegen das Gute spielt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Faszination des Märchens und die Bedeutung regionaler Sammlungen für die Erforschung der Ursprünglichkeit von Volksmärchen heraus. Die Abhandlung konzentriert sich auf mecklenburgische Volksmärchen, wobei der Teufel im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Um die Darstellung des Teufels zu klassifizieren, werden zunächst sein Auftreten im christlichen Weltbild und im Volksglauben beleuchtet.
2. Der Teufel im Traditionellen Weltbild
2.1 Der Teufel im Christentum
Im christlichen Glauben verkörpert der Teufel das personifizierte Böse. Als gefallener Engel, der gegen Gott rebellierte, wird er als Widersacher Gottes und als Verfasser von Lügen angesehen. Der Dualismus, der das christliche Weltbild prägt, stellt den Menschen vor die Wahl zwischen Gut und Böse.
2.2 Der Teufel im Volkslauben
Dieser Abschnitt beleuchtet die Darstellung des Teufels im Volksglauben, wobei die Bedeutung des Teufels im Kontext der Hexenverfolgung besonders hervorgehoben wird. Die Hexenverfolgung basierte auf dem Vorwurf des Paktes mit dem Teufel und der Teufelsbuhlschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Teufel im Volksmärchen dargestellt?
Im Gegensatz zum rein bösen Bild des Christentums tritt der Teufel im Märchen oft als übernatürliches Wesen auf, das überlistet werden kann oder dem Helden sogar (unfreiwillig) hilft.
Was ist das Besondere an mecklenburgischen Volksmärchen?
Sie bewahren oft eine größere Ursprünglichkeit als die Sammlungen der Brüder Grimm und spiegeln regionale Besonderheiten und den lokalen Volksglauben wider.
Spielt der Teufel immer die Rolle des Bösewichts?
Nicht zwingend. Er kann auch die Rolle eines strengen Richters oder eines Helfers in der Not einnehmen, der dem Helden durch scheinbar unlösbare Aufgaben hilft.
Was bedeutet das Motiv des 'Teufelspakts'?
Dabei verschreibt der Held dem Teufel seine Seele im Austausch für Reichtum oder Hilfe, versucht jedoch im Verlauf des Märchens, den Teufel durch List um seinen Lohn zu bringen.
Welchen Einfluss hatte die Hexenverfolgung auf das Teufelsbild?
Der Volksglaube während der Hexenverfolgung prägte ein Bild des Teufels, das eng mit dem Bösen und dem Verrat an der Gemeinschaft verknüpft war, was sich teils in den Märchen wiederfindet.
- Quote paper
- M.A. Virginie Vökler (Author), 2007, Die Darstellung des Teufels im mecklenburgischen Volksmärchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82329