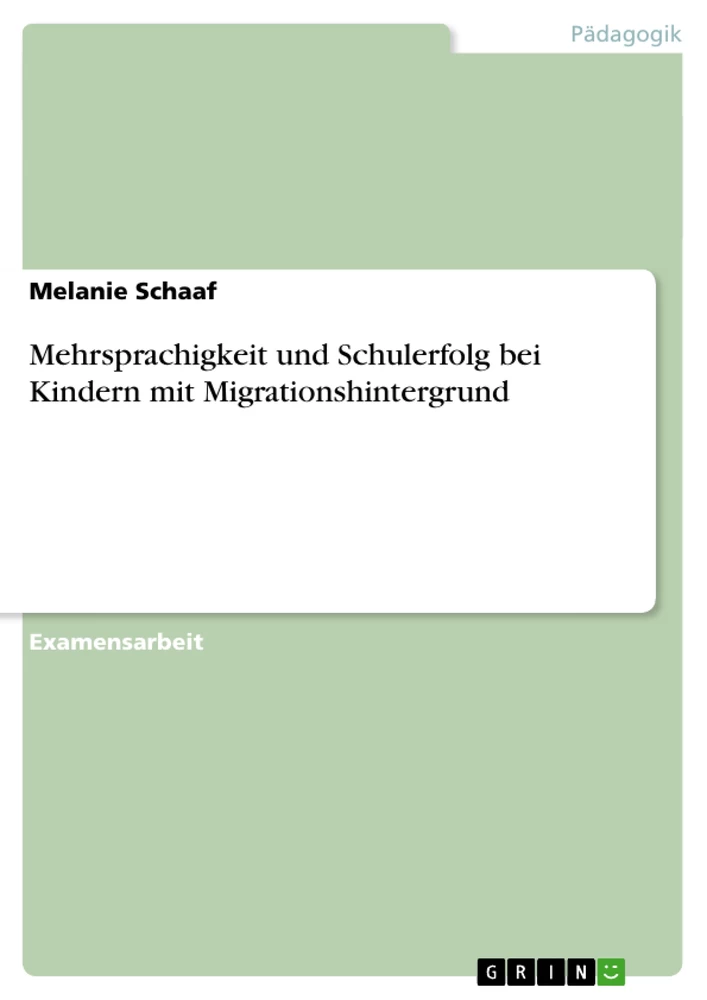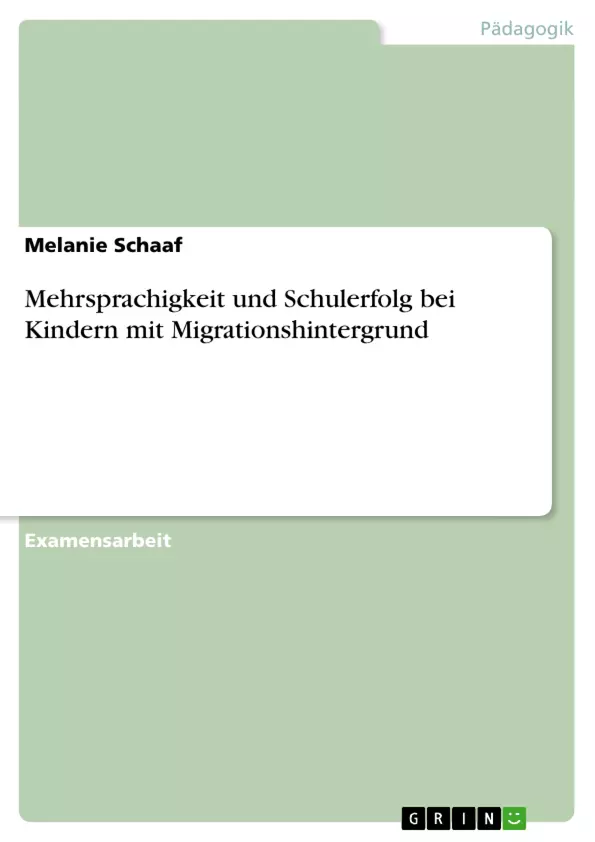Die Zuwanderung verschiedener Bevölkerungsgruppen bereichert die deutsche Schule durch eine sprachliche, soziale und kulturelle Vielfalt. Trotz dieser erfreulichen Heterogenität der Schülerschaft sind nicht alle Schülergruppen gleichberechtigt an den Bildungsabschlüssen in Deutschland beteiligt, wie die PISA-Studie gezeigt hat. Der Schulerfolg in Deutschland hängt primär von der sozialen Herkunft und den sprachlichen Kompetenzen auf dem für den jeweiligen Bildungsgang entsprechenden sprachlichen Niveau (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001:379) ab.
Durch die Kopplung der sozialen Schichtzugehörigkeit und der sprachlichen Kompetenz an den Schulerfolg werden Schüler mit Migrationshintergrund doppelt benachteiligt. Wenn man bedenkt, über welchen Zeitraum Migrantenkinder bereits am Unterricht in Regelschulen teilnehmen, ist es erstaunlich, dass sie statistisch immer noch den geringsten Schulerfolg in Deutschland haben. Dies liegt nicht an der Migration an sich, denn diese haben die Kinder in der Regel nicht selbst vollzogen. Kinder mit Migrationshintergrund sind Nachkommen der Einwanderer, welche zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Zuge der Arbeiteranwerbung ab 1955 in die Bundesrepublik Deutschland kamen.
Der Erwerb der Sprache im Zielland der Migration ist die Voraussetzung zur Teilhabe am öffentlichen Leben in der aufnehmenden Gesellschaft. Seit dem 1. Januar 2005 zeigt das neue Zuwanderungsgesetz erstmalig einen Perspektivenwechsel, denn der Gesetzgeber erklärt das Erlernen der deutschen Sprache als zentrales Ziel der Integrationsmaßnahmen.
Der Spracherwerb der Migrantenkinder ist durch die migrationsspezifischen Lebensumstände geprägt, so dass diese Schüler in der Regel mehrsprachig in das deutsche Schulsystem eintreten.
Der Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Schulerfolg wird in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Kompetenz in mehreren Sprachen grundsätzlich als positiv zu betrachten ist. Der statistisch belegte schlechtere Schulerfolg von Migrantenkindern wirft aber die Frage auf, welche benachteiligenden Faktoren dazu führen, dass Mehrsprachige ihre sprachlichen Kompetenzen gerade im deutschen Schulsystem nicht gewinnbringend nutzen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wanderungen in die Bundesrepublik Deutschland
- Aussiedler und Spätaussiedler
- Asylsuchende und Flüchtlinge
- Arbeitsmigranten
- Geschichte der Arbeitsmigration nach dem zweiten Weltkrieg
- Der politische Rahmen des Aufenthalts in Deutschland
- Familienzusammenführung
- Folgen und Reaktionen der Zuwanderung
- Mehrsprachigkeit
- Funktionen der Sprache
- Begriffsbestimmung Mehrsprachigkeit
- Spracherwerbstypen
- Erstsprache
- Zweitsprache
- Mehrsprachigkeit durch Erst- und Zweitspracherwerb
- Der Prozess des Spracherwerbs
- Spezifische Phänomene bei Mehrsprachigen: Dominanz und Code-Switching
- Der Einfluss der Erstsprache auf folgende Spracherwerbsprozesse
- Der Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund
- Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund
- Schüler mit Migrationshintergrund in historischer Perspektive
- Was ist Schulerfolg?
- Schulerfolg von Schülern mit Migrationshintergrund
- Wirkung außerschulischer Faktoren auf die Bildungschancen
- Die sozio-ökonomische Situation von Familien mit Migrationshintergrund
- Stellung auf dem Arbeitsmarkt und Entlohnung
- Wohnsituation
- Schichtspezifische Bildungsentscheidungen
- Auswirkung des Migrationshintergrundes auf die Bildungsvorraussetzungen
- Auswirkung der sozialen Herkunft auf die sprachliche Kommunikation
- Der Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und sprachlichen Bildungsvoraussetzungen bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Benachteiligung von Mehrsprachigen durch die Schriftsprache der Bildungsinstitution Schule
- Die zeitliche Investition in den Erwerb der Zweitsprache
- Der Unterschied zwischen der lebensweltlichen Gebrauchssprache und dem Unterrichtsdeutsch
- Lesekompetenz durch schriftsprachliche Sozialisation
- Der Schrifterwerb unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit
- Zusammenfassung
- Bildungsbenachteiligung durch die Fixierung auf Deutsch als Unterrichtssprache
- Struktur des Bildungssystems als Erklärungsfaktor
- Die Rolle des Lehrers
- Differenzierte Kompetenzen im Deutschen als Bildungsvoraussetzung
- Die monolinguale Orientierung der Unterrichtssprache
- Zusammenfassung
- Die Sprachkompetenz als Instrument der Selektion im dreigliedrigen Schulsystem
- Einschulung
- Überweisung an eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen
- Übergang in die Sekundarstufe
- Benachteiligung mehrsprachiger Schüler durch frühe Selektion
- Tendenzen der Zuweisung zu unteren Bildungsabschlüssen
- Haupt- oder Gesamtschule als Schulen für Schüler mit geringeren Kompetenzen in der Zweitsprache Deutsch
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die diese Schülergruppe im deutschen Bildungssystem aufgrund ihrer sozialen Herkunft, sprachlichen Kompetenzen und der spezifischen Anforderungen der Schule erlebt.
- Die Auswirkungen von Migrationshintergrund auf die Bildungschancen von Kindern
- Der Einfluss der sozio-ökonomischen Situation von Familien mit Migrationshintergrund auf den Bildungserfolg ihrer Kinder
- Die Rolle der Sprache im Bildungsprozess und die besonderen Herausforderungen für mehrsprachige Schüler
- Die Benachteiligung von mehrsprachigen Schülern durch die Fokussierung auf Deutsch als Unterrichtssprache
- Die Bedeutung der Sprachkompetenz als Instrument der Selektion im deutschen Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die statistisch belegte Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Sie stellt die Kernfrage der Arbeit: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Mehrsprachigkeit und Schulerfolg bei diesen Schülern?
- Wanderungen in die Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Einwanderungswellen in die Bundesrepublik Deutschland, die unterschiedliche Migrationsmotive und die Integrationsprozesse der jeweiligen Gruppen.
- Mehrsprachigkeit: Hier werden verschiedene Aspekte der Mehrsprachigkeit beleuchtet, darunter Funktionen der Sprache, Begriffsbestimmungen und Spracherwerbstypen.
- Der Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Bedingungen des Spracherwerbs für Kinder mit Migrationshintergrund, die in der Regel mehrsprachig in das deutsche Schulsystem eintreten.
- Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund: Hier wird der Begriff Schulerfolg definiert und der Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund im historischen Kontext betrachtet.
- Wirkung außerschulischer Faktoren auf die Bildungschancen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der sozio-ökonomischen Situation von Familien mit Migrationshintergrund auf die Bildungschancen ihrer Kinder, inklusive der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Wohnsituation und schichtspezifische Bildungsentscheidungen.
- Der Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und sprachlichen Bildungsvoraussetzungen bei Kindern mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den sprachlichen Bildungsvoraussetzungen von Kindern mit Migrationshintergrund.
- Die Benachteiligung von Mehrsprachigen durch die Schriftsprache der Bildungsinstitution Schule: Dieses Kapitel thematisiert die besonderen Herausforderungen, die mehrsprachige Schüler im Kontext der Schriftsprache der Schule erleben. Es beleuchtet den Unterschied zwischen der lebensweltlichen Umgangssprache und dem Unterrichtsdeutsch sowie die Rolle des Schrifterwerbs unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit.
- Bildungsbenachteiligung durch die Fixierung auf Deutsch als Unterrichtssprache: Dieses Kapitel beleuchtet die Bildungsbenachteiligung, die durch die monolinguale Orientierung des deutschen Schulsystems entsteht.
- Die Sprachkompetenz als Instrument der Selektion im dreigliedrigen Schulsystem: Dieses Kapitel zeigt, wie die Sprachkompetenz im deutschen Schulsystem als Instrument der Selektion eingesetzt wird, insbesondere im Kontext der Einschulung, Überweisung an Förderschulen und des Übergangs in die Sekundarstufe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Wichtige Themen sind die Auswirkungen von Migrationshintergrund, die sozio-ökonomische Situation von Familien mit Migrationshintergrund, die Rolle der Sprache im Bildungsprozess, die Benachteiligung von mehrsprachigen Schülern durch die Fokussierung auf Deutsch als Unterrichtssprache sowie die Sprachkompetenz als Instrument der Selektion im deutschen Schulsystem.
- Citation du texte
- Melanie Schaaf (Auteur), 2006, Mehrsprachigkeit und Schulerfolg bei Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82373