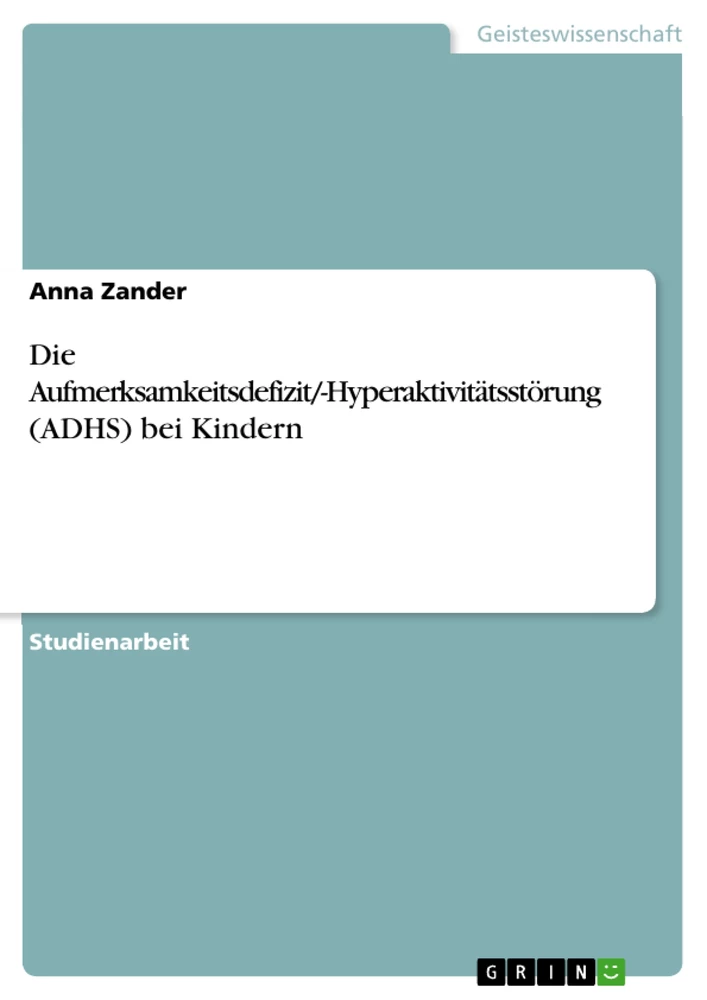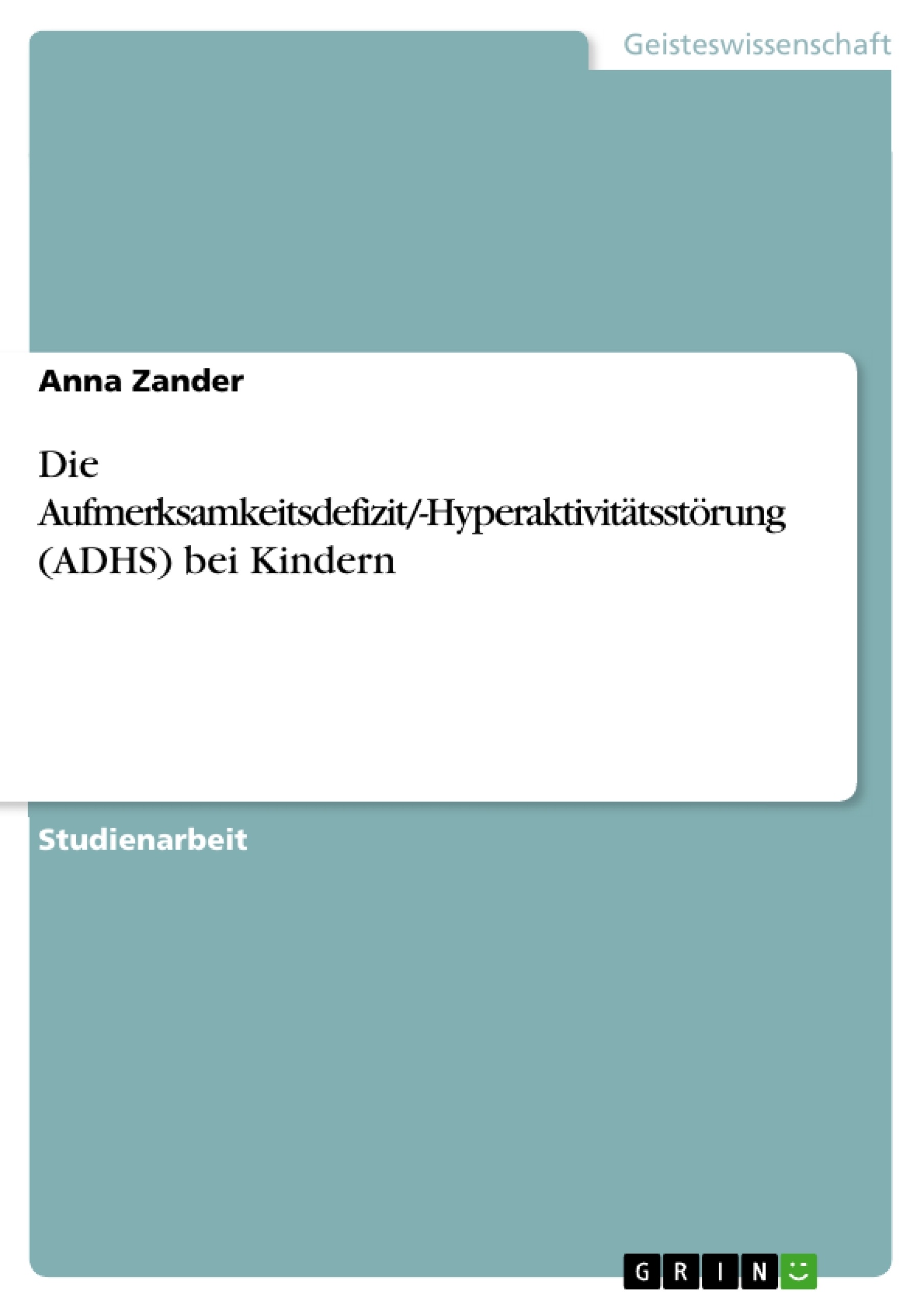ADS ist die deutsche Bezeichnung für das Syndrom und entstand aus der Übersetzung des englischen Begriffes „attention deficit dissorder (abgekürzt:ADD, gekoppelt mit Hyperaktivität:ADHD).
In der Schweiz wird vornämlich von dem hyperkinetischen Syndrom (HKS) gesprochen. In der Ratgeberliteratur wird ADHS auch als „Zappelphilipp- Syndrom“ bezeichnet.
In Amerika ist ADS seit 1987 im Katalog für psychische Störungen der American Psychiatric Association (APA) mit aufgenommen. In der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und Gesundheitsprobleme“ (ICD 10= international classification of diseases) der WHO wird die unter Punkt F90.0 aufgeführte: „Einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung“ diagnostiziert, oder, wenn Störungen des Sozialverhaltens wie Aggressivität oder oppositionelles Verhalten hinzukommen, Punkt F90.1 die„Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“ festgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Terminologie
- 2. Das Erscheinungsbild
- 3. Soziales Umfeld
- 3.1 Elternhaus
- 3.2 Schule
- 4. Die Diagnose
- 5. Thesen
- 5.1 Die Dopaminmangelthese
- 5.2 Gerald Hüther
- 5.3 Henning Köhler
- 6. Therapieansätze
- 6.1 Die medikamentöse Behandlung am Beispiel von Ritalin
- 6.2 Anthroposophische bzw. heilpädagogische Therapien
- 7. Die Diskussion
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Störung zu liefern, verschiedene Aspekte wie Terminologie, Erscheinungsbild, soziales Umfeld, Diagnose und Therapieansätze zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt auch kontroverse Diskussionen um die Ursachen und Behandlung von ADHS.
- Definition und verschiedene Facetten von ADHS
- Erscheinungsbild und Auswirkungen auf das soziale Umfeld
- Diagnosemethoden und kontroverse Theorien zu den Ursachen
- Verschiedene Therapieansätze
- Diskussion um die gesellschaftliche Wahrnehmung von ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Terminologie: Dieses Kapitel klärt die verschiedenen Bezeichnungen für ADHS (ADS, hyperkinetisches Syndrom, Zappelphilipp-Syndrom) und deren internationale Klassifizierung (ICD-10). Es differenziert zwischen den Subtypen der Störung (überwiegend unaufmerksam, überwiegend hyperaktiv-impulsiv, Mischtypus) und beleuchtet die hohe Prävalenz von ADHS bei Kindern und Jugendlichen, wobei ein höheres Auftreten bei Jungen festgestellt wird. Die kontroverse Debatte um die Ursachen von ADHS, von organischer Erkrankung bis hin zu soziokulturellen Faktoren, wird angedeutet.
2. Das Erscheinungsbild: Das Kapitel beschreibt die charakteristischen Merkmale von ADHS, darunter emotionale und Handlungsimpulsivität, motorische Unruhe, Schwierigkeiten mit der Kraftdosierung, Aufgedrehtheit und Waghalsigkeit. Es diskutiert widersprüchliche Beschreibungen des emotionalen Profils betroffener Kinder, von emotionaler Unreife bis hin zu Mitgefühl und Gerechtigkeitssinn. Extreme Stimmungsschwankungen werden als integraler Bestandteil des Syndroms dargestellt, gepaart mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden, das zu Wutausbrüchen führen kann. Der Einfluss der sozialen Interaktion und die Bedeutung der Erwachsenenrolle bei der Interpretation des kindlichen Verhaltens werden hervorgehoben. Die Beschreibung der Impulsivität als zunächst positive Eigenschaft, die erst durch soziale Spannungen negativ konnotiert wird, ist ein wichtiger Aspekt.
3. Soziales Umfeld: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von ADHS auf das familiäre und schulische Umfeld. Die Herausforderungen für Eltern und Lehrer werden thematisiert, insbesondere die Belastung durch den erhöhten Aufmerksamkeitsbedarf der Kinder. Die Bedeutung der elterlichen Reaktion auf das Verhalten des Kindes und deren Einfluss auf das Selbstbild des Kindes wird hervorgehoben.
4. Die Diagnose: Dieses Kapitel befasst sich mit den diagnostischen Verfahren für ADHS. (Ein detaillierter Inhalt fehlt im bereitgestellten Text).
5. Thesen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien zu den Ursachen von ADHS. Die Dopaminmangelthese wird vorgestellt, sowie die Perspektiven von Gerald Hüther und Henning Köhler, die alternative Erklärungsansätze bieten. (Detaillierte Inhalte fehlen im bereitgestellten Text).
6. Therapieansätze: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Therapieansätze für ADHS, darunter medikamentöse Behandlungen (am Beispiel von Ritalin) und nicht-medikamentöse Ansätze wie anthroposophische und heilpädagogische Therapien. (Detaillierte Inhalte fehlen im bereitgestellten Text).
7. Die Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die verschiedenen Perspektiven und Kontroversen rund um das Thema ADHS. (Ein detaillierter Inhalt fehlt im bereitgestellten Text).
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), ADS, hyperkinetisches Syndrom, Diagnose, Therapie, Ritalin, Dopaminmangelthese, Soziales Umfeld, Schule, Elternhaus, Impulsivität, Unruhe, Stimmungsschwankungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern. Sie behandelt die Terminologie, das Erscheinungsbild der Störung, den Einfluss des sozialen Umfelds (Elternhaus und Schule), Diagnosemethoden, verschiedene Theorien zu den Ursachen (inklusive der Dopaminmangelthese und der Perspektiven von Gerald Hüther und Henning Köhler), und verschiedene Therapieansätze (medikamentös und nicht-medikamentös). Die Arbeit diskutiert auch kontroverse Aspekte und die gesellschaftliche Wahrnehmung von ADHS.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Facetten von ADHS, Erscheinungsbild und Auswirkungen auf das soziale Umfeld, Diagnosemethoden und kontroverse Theorien zu den Ursachen, verschiedene Therapieansätze (z.B. Ritalin, anthroposophische und heilpädagogische Therapien), und die gesellschaftliche Diskussion um ADHS.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: 1. Terminologie, 2. Das Erscheinungsbild, 3. Soziales Umfeld (3.1 Elternhaus, 3.2 Schule), 4. Die Diagnose, 5. Thesen (5.1 Dopaminmangelthese, 5.2 Gerald Hüther, 5.3 Henning Köhler), 6. Therapieansätze (6.1 Medikamentöse Behandlung am Beispiel von Ritalin, 6.2 Anthroposophische bzw. heilpädagogische Therapien), 7. Die Diskussion, 8. Zusammenfassung.
Welche Theorien zu den Ursachen von ADHS werden diskutiert?
Die Hausarbeit behandelt die Dopaminmangelthese sowie alternative Erklärungsansätze von Gerald Hüther und Henning Köhler. Detaillierte Inhalte zu diesen Theorien fehlen jedoch im bereitgestellten Text-Auszug.
Welche Therapieansätze werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt medikamentöse Behandlungen (am Beispiel von Ritalin) und nicht-medikamentöse Ansätze wie anthroposophische und heilpädagogische Therapien. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Therapien fehlen im vorliegenden Text-Auszug.
Wie wird das Erscheinungsbild von ADHS beschrieben?
Das Erscheinungsbild von ADHS wird durch emotionale und Handlungsimpulsivität, motorische Unruhe, Schwierigkeiten mit der Kraftdosierung, Aufgedrehtheit und Waghalsigkeit charakterisiert. Die Arbeit betont auch widersprüchliche Beschreibungen des emotionalen Profils, extreme Stimmungsschwankungen und ein starkes Gerechtigkeitsempfinden.
Welche Auswirkungen auf das soziale Umfeld werden beschrieben?
Die Hausarbeit beleuchtet die Herausforderungen für Eltern und Lehrer im Umgang mit Kindern mit ADHS und hebt die Bedeutung der elterlichen Reaktion auf das kindliche Verhalten und dessen Einfluss auf das Selbstbild des Kindes hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), ADS, hyperkinetisches Syndrom, Diagnose, Therapie, Ritalin, Dopaminmangelthese, Soziales Umfeld, Schule, Elternhaus, Impulsivität, Unruhe, Stimmungsschwankungen.
Gibt es einen detaillierten Inhalt zu allen Kapiteln?
Nein, der bereitgestellte Text enthält nur zusammenfassende Beschreibungen einiger Kapitel. Detaillierte Informationen fehlen für die Kapitel "Die Diagnose", "Thesen", "Therapieansätze" und "Die Diskussion".
- Arbeit zitieren
- Anna Zander (Autor:in), 2005, Die Aufmerksamkeitsdefizit/-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82436