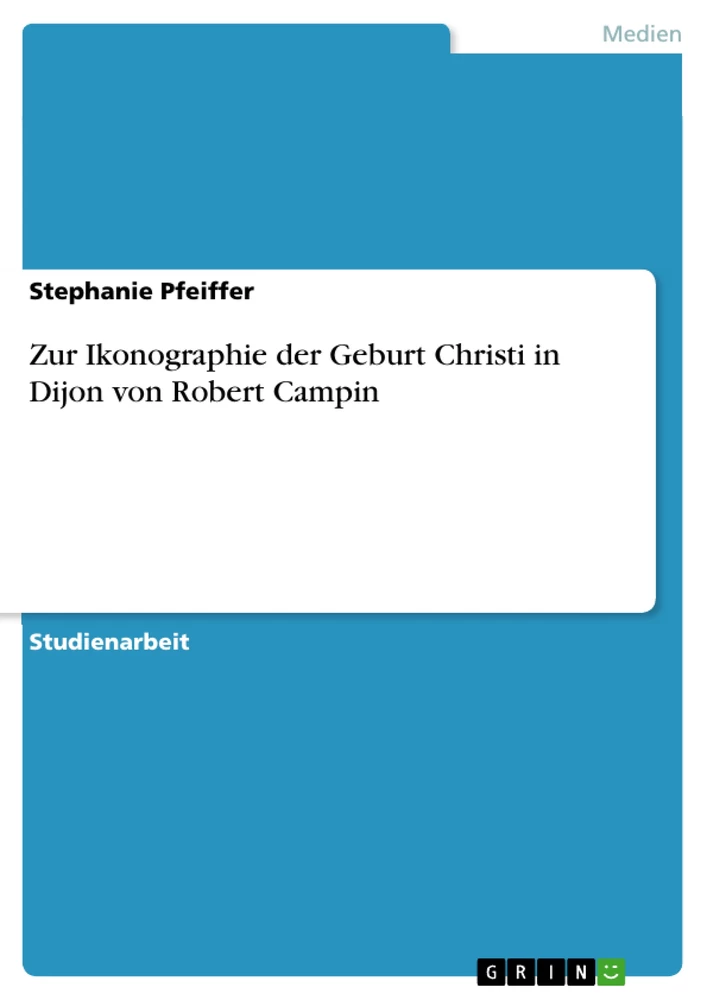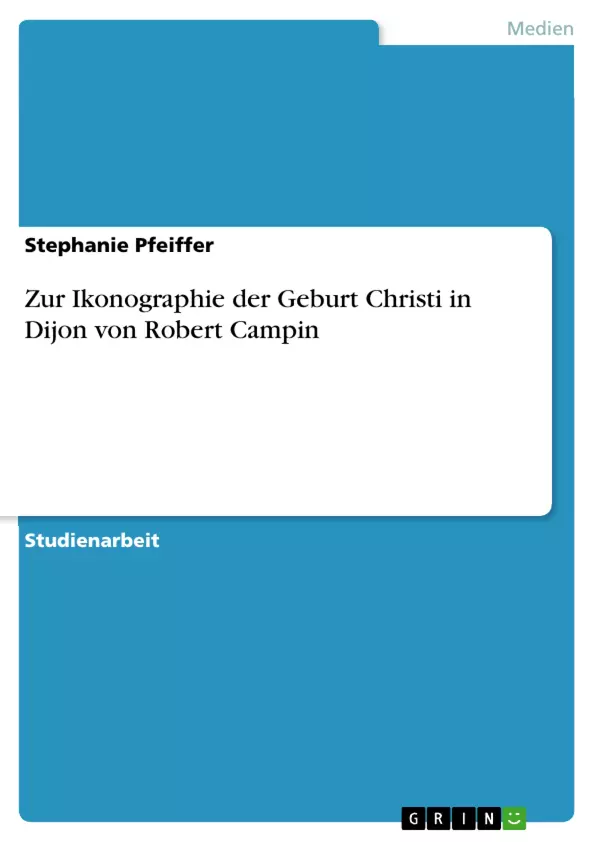aus der Einleitung:
Die Besonderheit der von Robert Campin gemalten Darstellung der Geburt Christi (1420 - 1425 ) aus dem Musée des Beaux Arts in Dijon ist die gleichzeitige Darstellung verschiedener Überlieferungen, die in Zusammenhang mit eben dieser stehen. So vereint Robert Campin verschiedene Bildtraditionen, deren Motive aus den apokryphen Evangelien des Proto-Jakobus und des Pseudo-Matthäus, der Legenda Aurea des Jacobus de Voragine oder den Revelationes der heiligen Birgitta von Schweden stammen. Meine Arbeit hat zum Ziel, diese Textvorlagen und ihre Umsetzung in der Geburt Christi näher darzulegen.
Ausgehend von einer Bildschreibung werden die im Bild vorkommenden Figuren und Handlungen im Zusammenhang mit den entsprechenden Textvorlagen erläutert. Dabei soll natürlich auch auf Abweichungen von den Textvorlagen aufmerksam gemacht werden. Zunächst werde ich auf die Geburtsszenerie eingehen und deren Anordnung und Ausgestaltung im Zusammenhang mit den zur Meditationsliteratur gehörigen Revelationes erläutern. Daran schließt die nähere Betrachtung der Hebammenepisode sowie deren apokrypher Textvorlagen an. Dass die campinsche Darstellung der Geburt Christi in der Auswahl der Textquellen als eine Art ikonographisches Pasticcio erscheint, zeigen des Weiteren die aus dem Neuen Testament übernommenen Hirten und Engel, sowie Ochs und Esel, die erstmals im apokryphen Evangelium des Pseudo-Matthäus erwähnt wurden.
Im Anschluss an die ikonographischen Erläuterungen der Hauptszenen soll das Augenmerk auf weitere kleinere Deutungszusammenhänge gelenkt werden, wie beispielsweise die Lichtquellen im Bild, den Stall und die Landschaft. Dies geschieht abschließend jedoch nicht ohne eine gewisse Kritik an teilweise schwer nachvollziehbaren Interpretationen in der Forschungsliteratur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ikonographie der Geburt Christi in Dijon
- Bildbeschreibung
- Die Darstellung der Geburt Christi
- Die Hebammenepisode
- Hirten, Engel, Ochs und Esel
- Weitere Deutungen
- Die Lichtquellen
- Der Stall
- Landschaft und Landschaftsidentifikation
- Kritik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ikonographie der Geburt Christi in Dijon, ein Gemälde von Robert Campin. Ziel ist die Erläuterung der verschiedenen Bildtraditionen, die in diesem Werk vereint sind, und deren Bezug zu apokryphen Evangelien, der Legenda Aurea und den Revelationes der heiligen Birgitta von Schweden. Die Analyse fokussiert auf die Umsetzung der Textvorlagen im Bild und zeigt Abweichungen auf.
- Analyse der Bildkomposition und ihrer ikonographischen Elemente.
- Vergleich der Darstellung mit entsprechenden Textvorlagen (apokryphe Evangelien, Legenda Aurea, Revelationes).
- Deutung der verschiedenen Figuren und Handlungen im Bild.
- Untersuchung der Abweichungen von den Textvorlagen.
- Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen in der Forschungsliteratur.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Analyse der ikonographischen Besonderheiten von Robert Campins "Geburt Christi" in Dijon. Das Gemälde vereint verschiedene Bildtraditionen aus apokryphen Evangelien, der Legenda Aurea und den Revelationes der heiligen Birgitta von Schweden. Die Arbeit untersucht die Umsetzung dieser Textvorlagen im Bild und zeigt Abweichungen auf. Der Fokus liegt auf der Geburtsszenerie, der Hebammenepisode und weiteren Details, um die ikonographische Komplexität des Werkes zu beleuchten. Die Analyse wird mit einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen in der Forschungsliteratur abgeschlossen.
Die Ikonographie der Geburt Christi in Dijon: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte ikonographische Analyse des Gemäldes. Die Bildbeschreibung beschreibt die zentrale Geburtsszene und die flankierenden Episoden, inklusive der detaillierten Darstellung von Maria, Josef, den Hebammen, Hirten, Engeln und den Tieren. Die Analyse setzt die einzelnen Elemente in Beziehung zu ihren textlichen Vorlagen (apokryphe Evangelien, Legenda Aurea etc.) und untersucht sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen. Die Bedeutung der Lichtquellen, des Stalls und der Landschaftsdarstellung wird ebenfalls erörtert, gefolgt von einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen in der Literatur. Die Kapitel unterstreichen die Vielschichtigkeit der ikonographischen Quellen und die eigenständige künstlerische Umsetzung durch Campin.
Schlüsselwörter
Robert Campin, Geburt Christi, Ikonographie, Apokryphe Evangelien, Legenda Aurea, Revelationes der heiligen Birgitta von Schweden, Bildanalyse, Dijon, Meditationsliteratur, Marienbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur ikonographischen Analyse der Geburt Christi in Dijon von Robert Campin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ikonographie der Geburt Christi in Dijon, ein Gemälde von Robert Campin. Sie untersucht die verschiedenen Bildtraditionen, die in diesem Werk vereint sind, und deren Bezug zu apokryphen Evangelien, der Legenda Aurea und den Revelationen der heiligen Birgitta von Schweden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Umsetzung der Textvorlagen im Bild zu erläutern und Abweichungen aufzuzeigen. Die Analyse fokussiert auf die Bildkomposition, die ikonographischen Elemente, den Vergleich mit Textvorlagen, die Deutung der Figuren und Handlungen sowie die kritische Auseinandersetzung mit bestehender Forschungsliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Ikonographie der Geburt Christi in Dijon und eine Zusammenfassung. Das Hauptkapitel beinhaltet eine detaillierte Bildbeschreibung, eine Analyse der Darstellung der Geburt Christi, der Hebammenepisode, der Figuren (Hirten, Engel, Ochs und Esel) und weitere Deutungen (Lichtquellen, Stall, Landschaft). Es schließt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen.
Welche Textvorlagen werden untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung der Geburt Christi mit entsprechenden Textvorlagen aus apokryphen Evangelien, der Legenda Aurea und den Revelationen der heiligen Birgitta von Schweden.
Welche Aspekte werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst die Bildkomposition, die einzelnen ikonographischen Elemente (Figuren, Handlungen, Symbole), die Lichtquellen, den Stall, die Landschaft und den Vergleich mit den Textvorlagen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Hebammenepisode gewidmet.
Wie werden Übereinstimmungen und Abweichungen behandelt?
Die Arbeit untersucht sowohl die Übereinstimmungen als auch die Abweichungen zwischen der Darstellung im Gemälde und den Textvorlagen. Diese Abweichungen werden im Kontext der künstlerischen Umsetzung und der Interpretation durch Campin diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Robert Campin, Geburt Christi, Ikonographie, Apokryphe Evangelien, Legenda Aurea, Revelationes der heiligen Birgitta von Schweden, Bildanalyse, Dijon, Meditationsliteratur, Marienbild.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Die Arbeit beleuchtet die Vielschichtigkeit der ikonographischen Quellen und die eigenständige künstlerische Umsetzung durch Campin. Sie bietet eine detaillierte Interpretation des Gemäldes im Kontext seiner Zeit und seiner textlichen Vorlagen.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Pfeiffer (Autor:in), 2005, Zur Ikonographie der Geburt Christi in Dijon von Robert Campin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82473