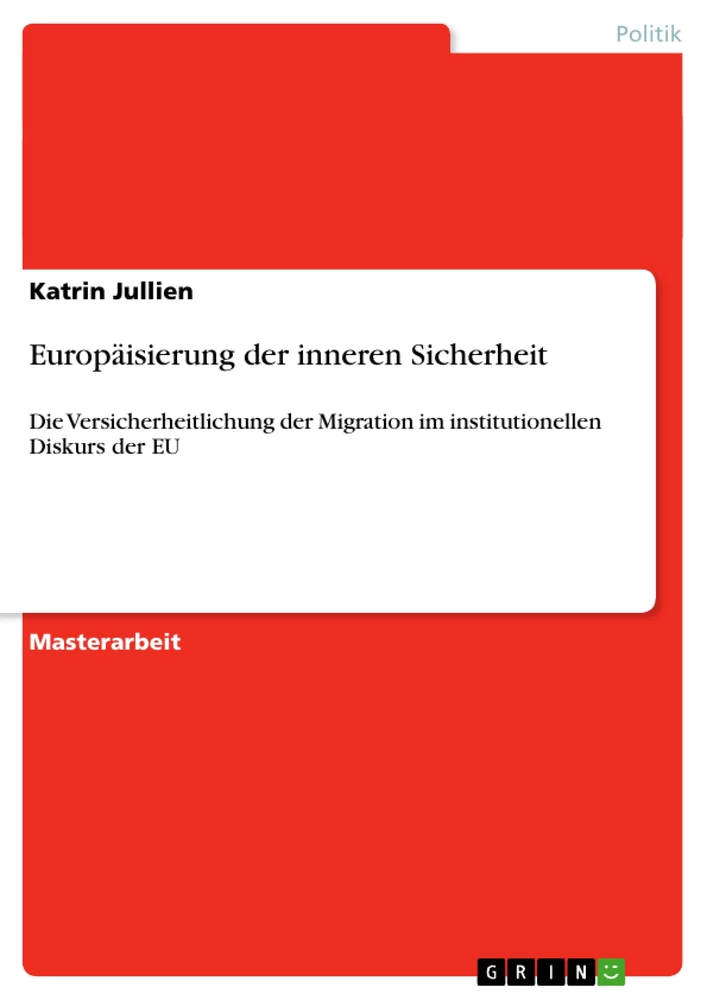Diese Arbeit untersucht die Versicherheitlichung der Migration im institutionellen Diskurs der EU. Ausgehend von der Frage, warum die europäischen policy-maker vor allem die illegale Migration als Problem für die innere Sicherheit betrachten, werden zwei Erklärungen für dieses Phänomen geboten. Die politischen „Problemlöser“, die Migration vor allem aufgrund ihrer Verbindung zu Kriminalität und Terrorismus als Sicherheitsproblem sehen, werden der Erklärung der ‚Securitisierer“ gegenübergestellt, die Versicherheitlichung als soziales Konstrukt begreifen. Nach einer Bewertung dieser beiden Erklärungen komme ich zu dem Ergebnis, dass der proklamierte Zusammenhang zwischen Sicherheit und Migration nicht überzeugend wirkt, woraus ich folgere, dass weniger Bedrohungen als die interessensgeleitete, starke Präsenz der Justiz- und Innenminister in diesem Feld ein Verständnis für die Versicherheitlichung der Migration liefern kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sicherheit - eine theoretische Annäherung
- 2.1 Sicherheitskonzepte im Kalten Krieg
- 2.2 Sicherheit nach dem Kalten Krieg
- 2.3 Sicherheit und Identität
- 2.4 Versicherheitlichung der Migration
- 3. Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene
- 3.1 Intergouvernementale Kooperation
- 3.1.1 Von TREVI zum Weißbuch der Kommission,,Vollendung des Binnenmarktes”
- 3.1.2 Schengener Abkommen und Durchführungsübereinkommen
- 3.1.3 Dubliner Übereinkommen
- 3.2 Vergemeinschaftung durch den Amsterdamer Vertrag 1997
- 3.3 Programm von Tampere 1999-2004
- 3.4. Haager Programm 2004-2009
- 3.1 Intergouvernementale Kooperation
- 4. Versicherheitlichung der Migration in den Dokumenten der EU
- 4.1 Versicherheitlichung des Binnenmarktes
- 4.2 Ein Raum der Sicherheit
- 4.3 Migration und der 11. September
- 5. Migration als Sicherheitsproblem vs. Versicherheitlichung der Migration zur Macht-ausweitung
- 5.1 Die,,Problemlöser“
- 5.1.1 Sicherheitspolitisierung des Kampfes gegen die Migration
- 5.1.1.1 Illegale Migration und Kriminalität
- 5.1.1.2 Illegaler Grenzübertritt als krimineller Akt
- 5.1.1.3. Illegale Migration als Massenbewegung
- 5.1.2,,Illegale Migranten können potentielle Terroristen sein“
- 5.1.3 Zusammenfassung
- 5.1.1 Sicherheitspolitisierung des Kampfes gegen die Migration
- 5.2 Die,,Securitisierer“
- 5.2.1 Dominanz der Mitgliedstaaten im Migrationsdiskurs
- 5.2.2 Erweiterung des Handlungsrahmens
- 5.2.3 Zusammenfassung
- 5.1 Die,,Problemlöser“
- 6. Bewertung
- 6.1 Identitätsdiskurs verstärkt Sicherheitsdiskurs
- 6.2 Neue Bedrohungen – neue Maßnahmen?
- 6.2.1 Migrationströme an der südlichen Außengrenze der EU
- 6.2.2 Terrorismus
- 6.3 Mehr Macht durch technische Überwachung?
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Versicherheitlichung der Migration im institutionellen Diskurs der EU. Sie untersucht, warum illegale Migration von europäischen Entscheidungsträgern als ein Problem für die innere Sicherheit betrachtet wird. Die Arbeit beleuchtet zwei Erklärungen für dieses Phänomen: Die „Problemlöser“, die Migration aufgrund ihrer Verbindung zu Kriminalität und Terrorismus als Sicherheitsbedrohung wahrnehmen, und die „Securitisierer“, die Versicherheitlichung als ein soziales Konstrukt begreifen. Die Arbeit bewertet diese beiden Erklärungen und analysiert, ob der proklamierte Zusammenhang zwischen Sicherheit und Migration tatsächlich überzeugend ist.
- Versicherheitlichung der Migration im institutionellen Diskurs der EU
- Die Rolle illegaler Migration in der Sicherheitspolitik der EU
- Erklärungen für die Versicherheitlichung von Migration
- Der Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität/Terrorismus
- Die Rolle von „Problemlösern“ und „Securitisierern“ im Migrationsdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Konzept der „effektiven Migrationssteuerung“ vor und zeigt auf, dass die EU legale und illegale Migration unterschiedlich behandelt. Sie stellt die Frage, warum die EU ein Problem mit illegaler Migration hat und warum ihr so viel Gewicht beigemessen wird.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet eine theoretische Annäherung an den Sicherheitsbegriff, indem es Sicherheitskonzepte im Kalten Krieg und danach beleuchtet. Es untersucht den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Identität und führt den Begriff der Versicherheitlichung im Kontext von Migration ein.
- Kapitel 3: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene. Es analysiert die intergouvernementale Kooperation, die Vergemeinschaftung und die wichtigsten Programme, die im Laufe der Jahre die Migrationspolitik geprägt haben.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die Versicherheitlichung der Migration in den Dokumenten der EU, indem es die Themen des Binnenmarktes, des Raumes der Sicherheit und der Migration im Kontext des 11. Septembers beleuchtet.
- Kapitel 5: Das Kapitel vergleicht zwei Perspektiven auf die Versicherheitlichung der Migration: die „Problemlöser“, die Migration als Sicherheitsbedrohung durch Kriminalität und Terrorismus sehen, und die „Securitisierer“, die Versicherheitlichung als ein soziales Konstrukt begreifen.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel bietet eine Bewertung der beiden Erklärungen und stellt fest, dass der proklamierte Zusammenhang zwischen Sicherheit und Migration nicht überzeugend ist.
Schlüsselwörter
Versicherheitlichung, Migration, innere Sicherheit, EU, illegale Migration, Kriminalität, Terrorismus, „Problemlöser“, „Securitisierer“, Identitätsdiskurs, Sicherheitspolitik, Migrationssteuerung, Asylpolitik, Grenzschutz, Schengen-Raum, Dubliner Übereinkommen, Europäische Kommission.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Versicherheitlichung der Migration"?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Migration im politischen Diskurs primär als Bedrohung für die innere Sicherheit (Kriminalität, Terrorismus) dargestellt wird.
Wer sind die "Problemlöser" im Migrationsdiskurs?
Politiker und Akteure, die Migration als faktisches Sicherheitsproblem sehen und technische oder polizeiliche Lösungen zur Kontrolle fordern.
Was besagt die Theorie der "Securitisierer"?
Diese Theorie sieht Versicherheitlichung als soziales Konstrukt; Migration wird zur Bedrohung erklärt, um Machtbefugnisse auszuweiten und Ressourcen zu sichern.
Welchen Einfluss hatte der 11. September auf die EU-Migrationspolitik?
Nach den Terroranschlägen wurde die Verknüpfung von illegaler Migration und Terrorismus im EU-Diskurs massiv verstärkt, was zu schärferen Sicherheitsmaßnahmen führte.
Was ist das Schengener Abkommen?
Ein Abkommen zur Abschaffung der Binnengrenzkontrollen in Europa, das gleichzeitig eine verstärkte Sicherung der Außengrenzen ("Festung Europa") erforderte.
- Citation du texte
- Katrin Jullien (Auteur), 2007, Europäisierung der inneren Sicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82515