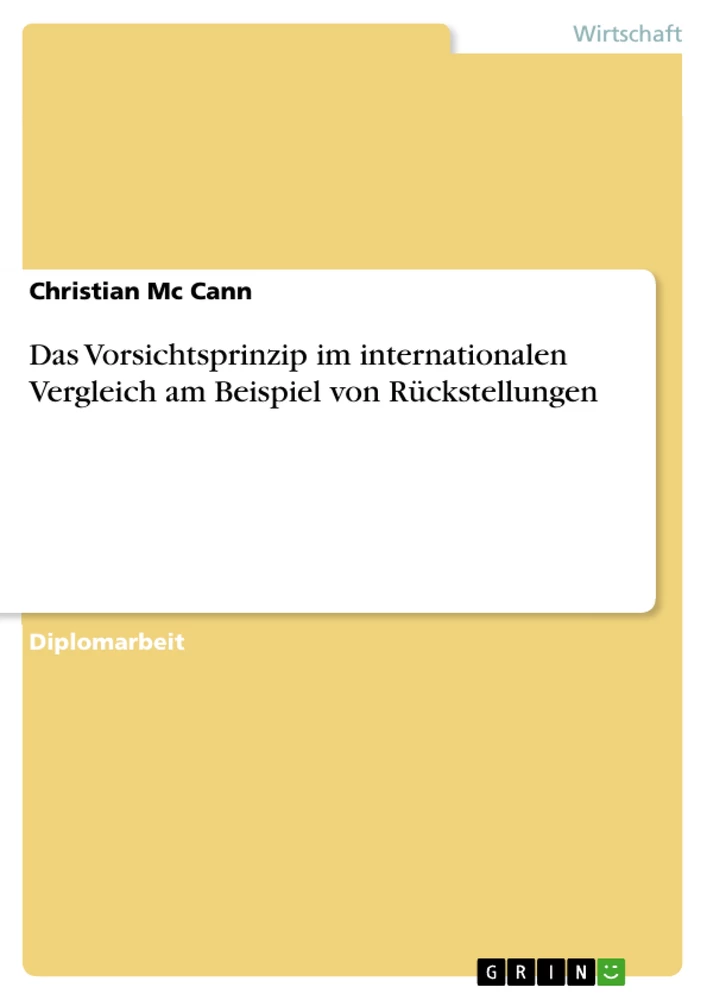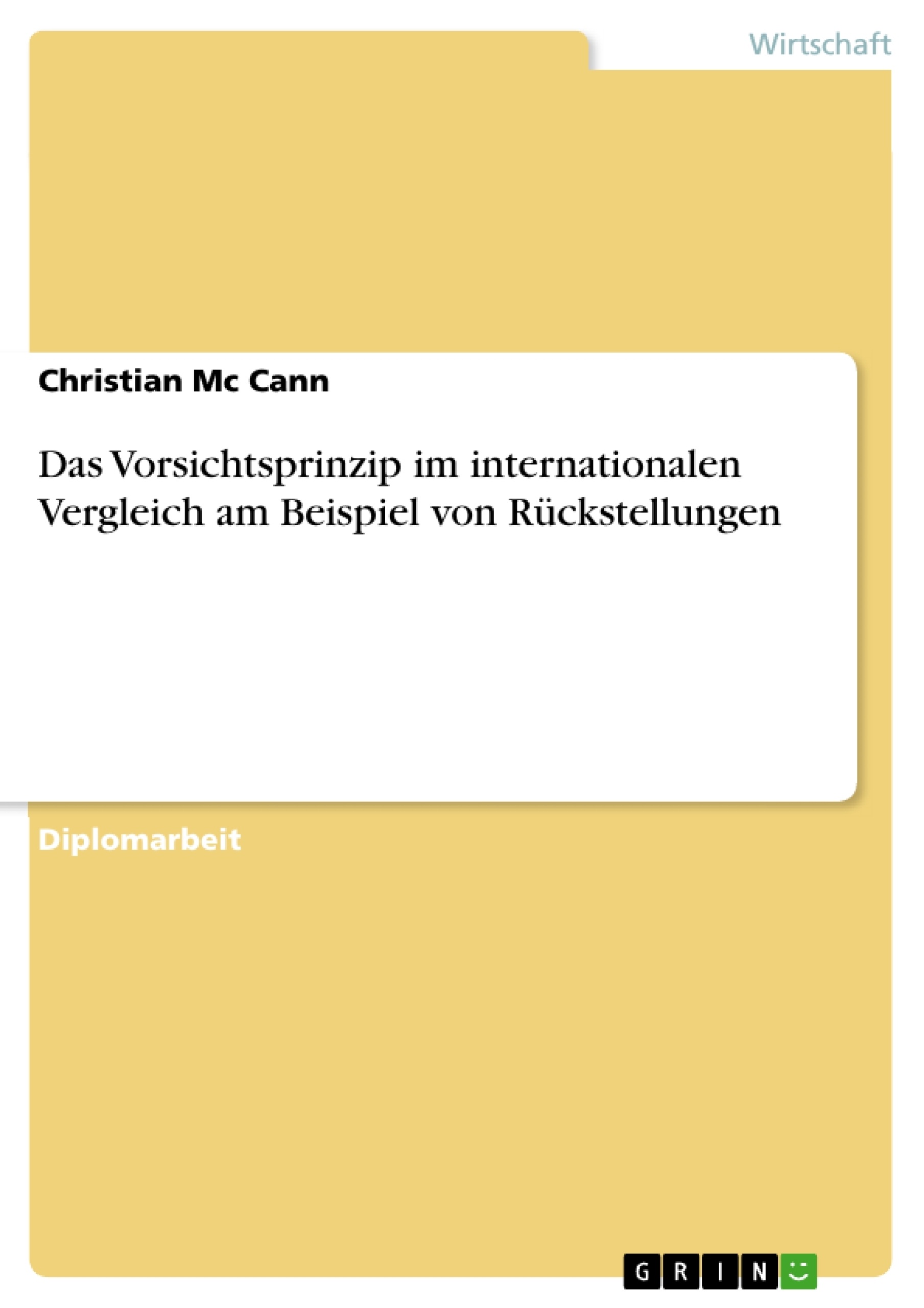Mit der Verabschiedung der Verordnung Nr. 1606/2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards wurden alle kapitalmarktorientierten Unternehmen in der Europäischen Union verpflichtet, ab 2005 ihren Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards aufzustellen […].
Der Einfluss der International Financial Reporting Standards auf die deutsche Bilanzierungspraxis wuchs durch diese Verordnung und deren Umsetzung durch den Gesetzgeber mit dem Bilanzrechtsformgesetz deutlich an, ebenso die kontrovers geführten Diskussionen darüber, welches Rechnungslegungssystem denn besser geeignet ist, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.
In Deutschland wird der handelsrechtliche Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt […].
Das dominierende Ziel der deutschen Rechnungslegung ist der Gläubigerschutz. Dieser soll bei kapitalmarktorientierten Unternehmen vor allem durch eine vorsichtige Gewinnermittlung und -ausschüttung realisiert werden. Aus dem Rechnungslegungszweck des Gläubigerschutzes hat sich das Vorsichtsprinzip abgeleitet, welches im deutschen Handelsrecht eine exponierte Stellung einnimmt. Unter dem Vorsichtsprinzip subsumieren sich zwei weitere Grundprinzipien mit ihren Folgeprinzipien welche später ausführlicher behandelt werden.
Das Vorsichtsprinzip ist auch unter den IFRS bekannt, ihm wird allerdings weit weniger Bedeutung beigemessen als in Deutschland, da das primäre Rechnungslegungsziel nicht der Gläubigerschutz, sondern das der entscheidungsrelevanten Informationsvermittlung ist.
In dieser Arbeit werden zuerst die Grundlagen der beiden Rechnungslegungssysteme erklärt, um darauf aufbauend die unterschiedliche Handhabung des Vorsichtsprinzips zu betrachten. Dazu vergleicht der Autor dieser Arbeit die Vorschriften in Deutschland mit denen der IFRS, um hierbei Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Am Beispiel von Rückstellungen wird dann anschaulich erklärt, welche Auswirkung die unterschiedlichen Interpretationen des Vorsichtsprinzips auf den Ausweis dieser Bilanzposition im Jahresabschluss hat.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- RECHNUNGSLEGUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN
- PFLICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG
- Einzelabschluss
- Konzernabschluss
- RECHNUNGSLEGUNGSZWECKE
- NORMENSETZENDE INSTITUTIONEN
- Gesetzgeber
- Gerichte
- Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
- Fachliteratur
- Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.
- INTERNATIONALISIERUNG DER RECHNUNGSLEGUNG
- GRÜNDE FÜR INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNG
- INTERNATIONALISIERUNG UND HARMONISIERUNG IN DEUTSCHLAND
- INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
- GRUNDLAGEN UND ENTWICKLUNG DER IFRS
- ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN
- DIE ENTWICKLUNG EINES STANDARDS
- DIE GRUNDSÄTZE ORDNUNGSGEMÄßER BUCHFÜHRUNG
- ENTWICKLUNG DER GOB
- ELEMENTE DER GRUNDSÄTZE ORDNUNGSGEMÄßER BUCHFÜHRUNG
- Dokumentationsgrundsätze
- Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung
- DAS VORSICHTSPRINZIP
- DAS VORSICHTSPRINZIP IN DEUTSCHLAND
- Grundlagen
- Das Realisationsprinzip
- Die Grundsätze der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach
- Das Imparitätsprinzip
- Folgeprinzipien
- Das Vorsichtsprinzip als Instrument der Kapitalerhaltung
- DAS VORSICHTSPRINZIP NACH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
- Grundlagen
- Framework
- Basisannahmen (,, Underlying Assuptions\")
- Qualitative Rechnungslegungsgrundsätze (,,Qualitative Characteristics“)
- Einschränkungen bei der Informationsvermittlung („, Constraints\")
- UNTERSCHIEDE AUFGRUND DES VORSICHTSPRINZIPS
- Informationsfunktion und getreue Darstellung
- Vorsichtsprinzip
- Realisationsprinzip
- Imparitätsprinzip
- Anschaffungs- und Herstellkostenprinzip
- ERGEBNIS DES VERGLEICHS
- RÜCKSTELLUNGEN
- RÜCKSTELLUNGEN NACH HGB
- Begriff der Rückstellung
- Arten von Rückstellungen
- Statische und Dynamische Bilanzauffassung
- Abgrenzung der Rückstellung von anderen Posten der Bilanz
- Ausweis von Rückstellungen
- ANSATZ VON RÜCKSTELLUNGEN NACH HANDELSRECHT
- Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- Aufwandsrückstellungen
- BEWERTUNG VON RÜCKSTELLUNGEN NACH HANDELSRECHT
- Bandbreiten
- Das Höchstwertprinzip bei Rückstellungen
- Einzel- und Sammelrückstellungen
- Abzinsung
- Kostensteigerungen
- Die Bewertung von Drohverlustrückstellungen
- RÜCKSTELLUNGEN NACH IFRS
- ANSATZ VON RÜCKSTELLUNGEN NACH IFRS
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- Aufwandsrückstellungen
- Eventualschulden und Eventualforderungen
- BEWERTUNG VON RÜCKSTELLUNGEN NACH IFRS
- Bestmögliche Schätzung
- Abzinsung
- Kostensteigerung
- Einzel- und Sammelrückstellung
- ABSCHLIEBENDER VERGLEICH VON ANSATZ UND BEWERTUNG
- AUSBLICK
- EXPOSURE DRAFT 37
- DIE MODERNISIERUNG DES HANDELSRECHTS
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Vorsichtsprinzip im internationalen Vergleich am Beispiel von Rückstellungen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ausprägungen des Vorsichtsprinzips in Deutschland und nach International Financial Reporting Standards (IFRS) zu analysieren und die Auswirkungen auf die Bilanzierung von Rückstellungen zu untersuchen.
- Entwicklung und Bedeutung des Vorsichtsprinzips im internationalen Kontext
- Vergleich der Vorsichtsprinzip-Anwendungen in Deutschland (HGB) und IFRS
- Analyse der Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IFRS
- Untersuchung der Auswirkungen des Vorsichtsprinzips auf die Informationsfunktion des Jahresabschlusses
- Bewertung der Relevanz und Aktualität des Vorsichtsprinzips in der modernen Rechnungslegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, wobei die Pflicht zur Rechnungslegung, die Rechnungslegungszwecke und die normsetzenden Institutionen beleuchtet werden. Im Anschluss wird die Internationalisierung der Rechnungslegung und die Entwicklung der IFRS erläutert.
Kapitel 6 analysiert das Vorsichtsprinzip, das eine zentrale Rolle in der Rechnungslegung spielt. Zunächst werden die Grundlagen des Vorsichtsprinzips in Deutschland (HGB) dargestellt, gefolgt von einer ausführlichen Betrachtung der IFRS-Grundlagen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Vergleich des Vorsichtsprinzips in Deutschland und nach IFRS im Kontext der Rückstellungen. Kapitel 7 behandelt die Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IFRS, wobei die Unterschiede in Ansatz und Bewertung deutlich herausgestellt werden.
Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Vorsichtsprinzips gegeben, wobei der Exposure Draft 37 und die Modernisierung des Handelsrechts im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit zentralen Themen der Rechnungslegung, insbesondere mit dem Vorsichtsprinzip und der Bilanzierung von Rückstellungen im internationalen Vergleich. Dabei werden die Standards des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der International Financial Reporting Standards (IFRS) gegenübergestellt. Die Arbeit beleuchtet wichtige Konzepte wie Bilanzierung, Kapitalerhaltung, Informationsfunktion, Rechnungslegungszwecke und Normsetzung. Die Analyse des Vorsichtsprinzips und seiner Auswirkungen auf die Rechnungslegung von Rückstellungen stellt einen zentralen Aspekt der Arbeit dar.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen HGB und IFRS beim Vorsichtsprinzip?
Im HGB dominiert der Gläubigerschutz durch vorsichtige Gewinnermittlung. Bei den IFRS steht die entscheidungsrelevante Information für Investoren im Vordergrund, weshalb das Vorsichtsprinzip dort eine deutlich geringere Rolle spielt.
Wie werden Rückstellungen nach HGB bewertet?
Nach HGB gilt der Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei kommt oft das Höchstwertprinzip zum Tragen, um den Gläubigerschutz zu wahren.
Wie unterscheidet sich der Ansatz von Rückstellungen nach IFRS?
IFRS verlangt für den Ansatz eine „bestmögliche Schätzung“ des Erwartungswerts. Zudem werden zukünftige Ereignisse und Kostensteigerungen anders berücksichtigt als im eher statischen HGB-Modell.
Was versteht man unter dem Imparitätsprinzip?
Das Imparitätsprinzip (im HGB zentral) besagt, dass vorhersehbare Verluste bereits berücksichtigt werden müssen, wenn sie erkennbar sind, während Gewinne erst ausgewiesen werden dürfen, wenn sie realisiert sind.
Werden Rückstellungen nach IFRS abgezinst?
Ja, nach IFRS ist eine Abzinsung von langfristigen Rückstellungen zwingend vorgeschrieben, wenn der Zinseffekt wesentlich ist. Im HGB gab es hierzu durch das BilMoG ebenfalls Angleichungen.
- Quote paper
- Dipl.-Betriebswirt (FH) Christian Mc Cann (Author), 2007, Das Vorsichtsprinzip im internationalen Vergleich am Beispiel von Rückstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82544