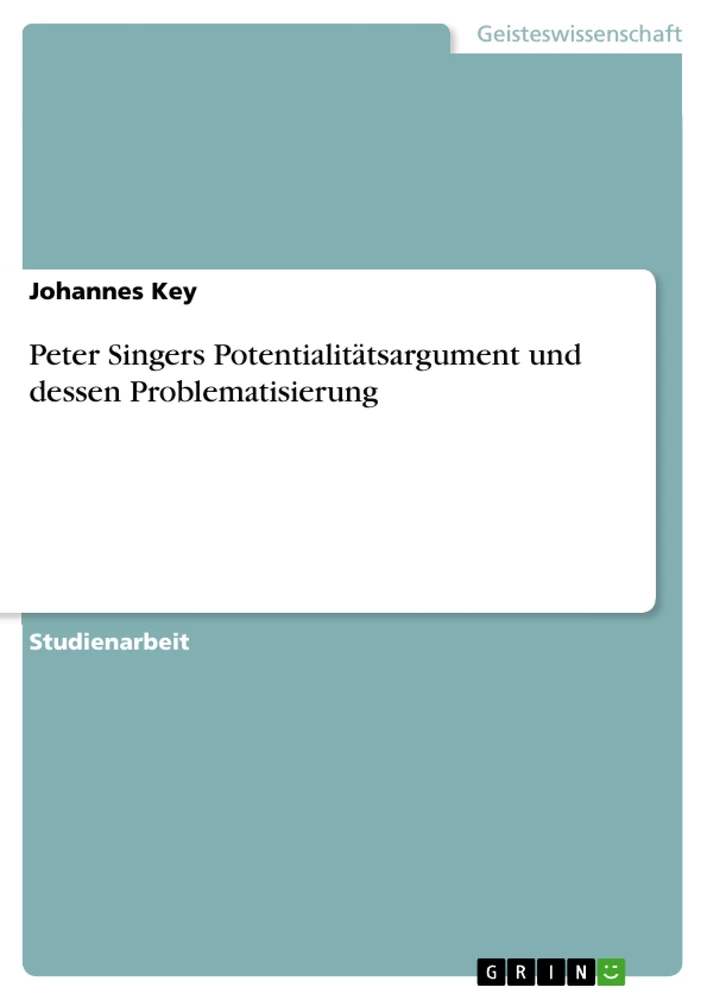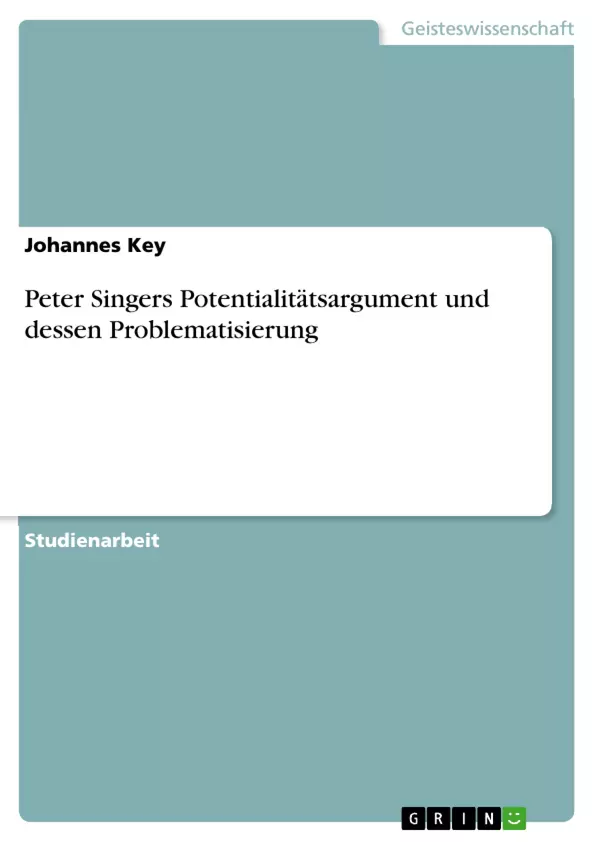Peter Singer versucht zu zeigen, dass die bloße Potentialität ein rationales, selbstbewusstes Wesen zu werden nicht als Grund gelten kann, diesem einen Lebensschutz zu zusprechen. Er verfolgt also das Ziel das Potentialitätsargument (P-Argument) zu entkräften, da eben nur aktuale Personen durch ihre Personen-Eigenschaften ein Lebensrecht haben.
Oberflächlich gesehen ist Singers Argumentation lückenhaft. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass er vieles impliziert [z.B. einen bestimmten Begriff von Potentialität, der genauer betrachtet werden soll], das nicht explizit erwähnt wird. Ich werde in der Arbeit die teilweise grob dargestellten Schritte rekonstruieren resp. Einwände gegen sie anführen.
Eine umfassende Kritik seines Utilitarismus, der sich auch als grundlegend für die Bewertung von potentiellen Personen erweist, ist hier nicht möglich. Ich werde stattdessen an entsprechenden Stellen die Probleme markieren, die eine solche Ethik mit sich bringt.
Zum Schluss dieser Arbeit führe ich ein Argument an, dass m. E. die Probleme des P-Arguments löst und realistische Schlussfolgerungen bieten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen
- Singers Ausführungen zum P-Argument und Einwände
- Das Kronprinzessinproblem
- Der Embryo oder Fetus als bloßes Mittel
- Das Gametenproblem oder das Reductioargument
- Das Abgrenzungsproblem der Potentialität
- Possibilität
- Probabilität
- Dispositionelle Möglichkeit
- Aktives inhärentes Potential
- Zusammenfassung und weitere Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Peter Singers Kritik am Potentialitätsargument (P-Argument) und versucht, dessen Argumentation zu rekonstruieren und Einwände dagegen zu formulieren. Singers Ziel ist es, zu zeigen, dass bloße Potentialität ein rationales, selbstbewusstes Wesen zu werden, nicht als Grund für Lebensschutz gelten kann. Er argumentiert, dass nur aktuelle Personen durch ihre persönlichen Eigenschaften ein Lebensrecht haben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Problematik des P-Arguments, insbesondere auf die Frage, ob die bloße Möglichkeit, ein bestimmtes Merkmal zu entwickeln, ausreichend ist, um diesem Wesen moralischen Schutz zu gewährleisten.
- Rekonstruktion und Kritik von Singers Argumentation gegen das Potentialitätsargument
- Die Rolle von Potentialität bei der Bewertung des moralischen Status von Embryonen und Feten
- Die Unterscheidung zwischen aktualen und potentiellen Personen
- Probleme einer konsequentialistischen Ethik in Bezug auf potentielle Personen
- Entwicklung eines alternativen Arguments zur Lösung der Problematik des P-Arguments
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Peter Singer argumentiert, dass die bloße Potentialität, ein rationales, selbstbewusstes Wesen zu werden, nicht als Grund für Lebensschutz gelten kann. Er möchte das Potentialitätsargument entkräften, da nur aktuelle Personen durch ihre Eigenschaften ein Lebensrecht haben. Die Arbeit untersucht Singers Argumentation, rekonstruiert dessen Schritte und formuliert Einwände dagegen.
Vorüberlegungen
Es werden zwei Beurteilungskriterien für das Potentialitätsargument vorgestellt: (1) Das Argument soll unabhängig von der Statusfrage menschlicher Embryonen und Feten akzeptabel und plausibel sein. (2) Bewertungen, die absurd sind, sollten nicht zu deren konsequentialistischen Akzeptanz nötigen. Diese Kriterien sollen eine ausgewogene und kohärente Diskussion ermöglichen.
Singers Ausführungen zum P-Argument und Einwände
Singers Argumentation wird anhand eines Syllogismus dargestellt, der die beiden problematischen Prämissen des P-Arguments zeigt. Vor allem die erste Prämisse, die von einem Übergang von aktualen zu potentiellen Wesen ausgeht, ist kritisch zu betrachten. Singer selbst räumt ein, dass keine Regel existiert, die potentiellen Wesen den gleichen Wert oder Rechte wie aktuelle Wesen zuspricht.
Das Kronprinzessinproblem
Dieses Problem veranschaulicht, dass ein potentieller König nicht die gleichen Rechte wie der regierende König hat. Dies unterstreicht die problematische Annahme, dass bloße Potentialität automatisch den gleichen moralischen Status wie tatsächliche Eigenschaften verleiht.
Der Embryo oder Fetus als bloßes Mittel
Hier wird Singers Ansicht dargestellt, dass ein Embryo oder Fetus als bloßes Mittel für das Erreichen eines Ziels (z.B. die Geburt eines Kindes) betrachtet werden kann. Dies wirft die Frage auf, ob ein Wesen, das nur als Mittel zum Zweck dient, einen Anspruch auf Lebensschutz hat.
Das Gametenproblem oder das Reductioargument
Dieser Einwand bezieht sich auf die logischen Konsequenzen des Potentialitätsarguments. Wenn man das Argument konsequent durchführt, müsste man auch Gameten (Eizellen und Spermien) einen moralischen Status zusprechen, da sie ebenfalls das Potential haben, ein menschliches Wesen zu werden. Dies zeigt die absurden Folgen des P-Arguments.
Das Abgrenzungsproblem der Potentialität
Es werden verschiedene Arten von Potentialität betrachtet, um die Problematik des P-Arguments weiter zu beleuchten. Dazu gehören Possibilität, Probabilität, dispositionelle Möglichkeit und aktives inhärentes Potential. Die Unterscheidung zwischen diesen Potentialitätsformen ist wichtig, um den Gültigkeitsbereich des P-Arguments zu präzisieren.
- Quote paper
- Johannes Key (Author), 2005, Peter Singers Potentialitätsargument und dessen Problematisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82552