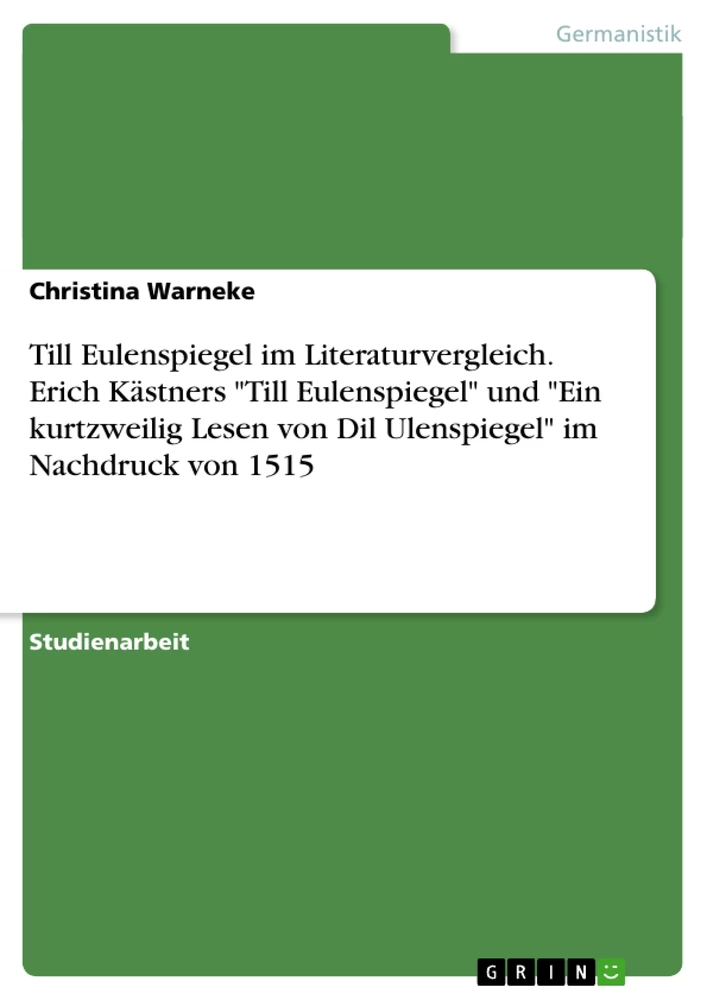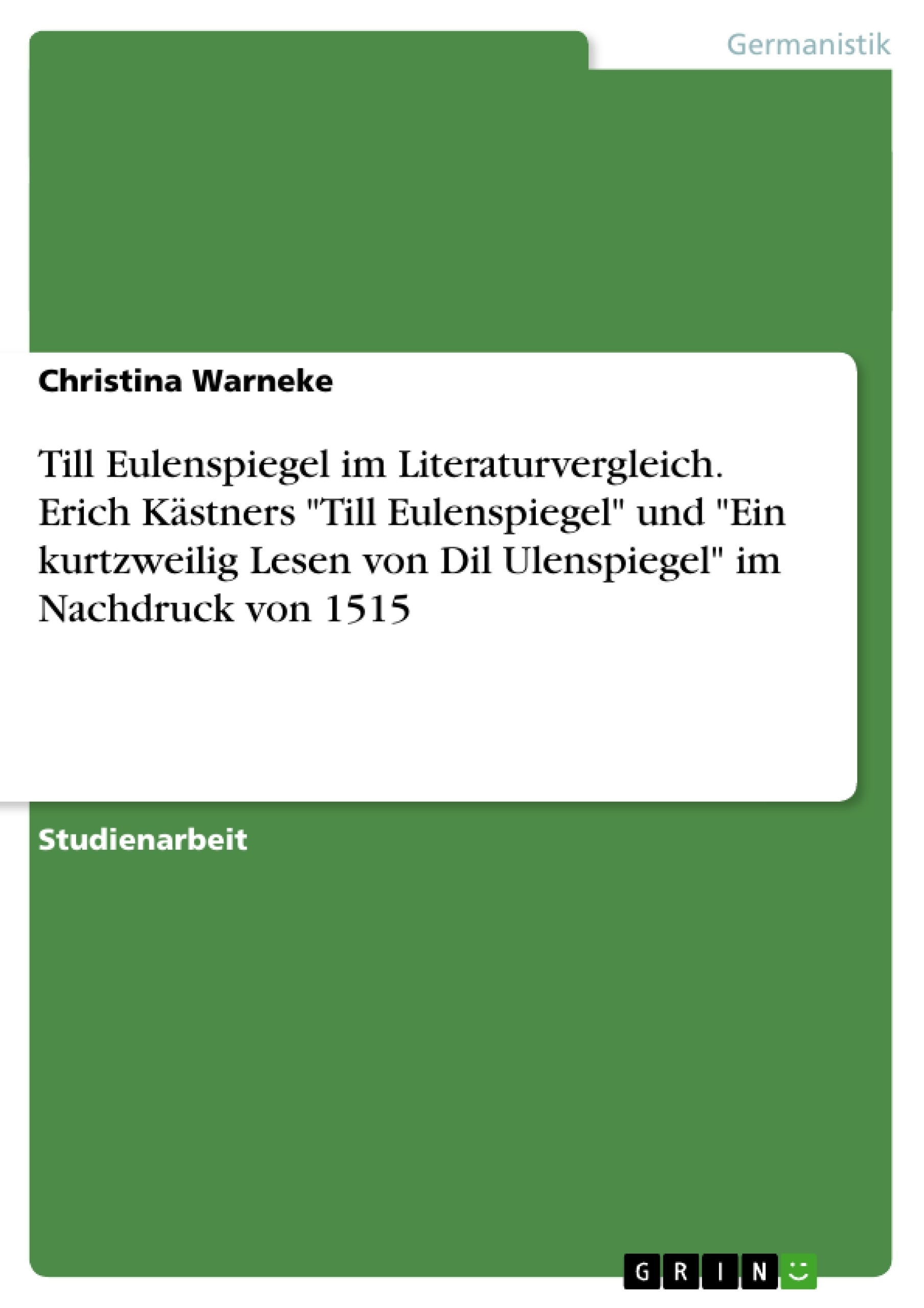Bei dem Namen Till Eulenspiegel denken die meisten Menschen wohl an einen Narren, an jemanden, der die Leute an der Nase herum führt und sie auf den Arm nimmt. Eulenspiegel wird von einigen als jemand gesehen, der mit seinen Mitmenschen das macht, was sie verdient haben, dass er sie so behandelt, wie sie es scheinbar wollen. Andere halten ihn für einen Gauner und Halunken. Die einen können über seine Streiche lachen, die anderen halten ihn für unmöglich. So bekannt Eulenspiegel ist, so unterschiedlich sind wohl auch die Meinungen über ihn. Obwohl die Geschichten von diesem Schalk sehr alt sind, sind sie bis heute bekannt geblieben. Eulenspiegel ist noch immer präsent. In Bernburg ist dies besonders zu beobachten. Dort steht der Eulenspiegelturm, im ganzen Ort wimmelt es von Eulenspiegel-Statuen. Doch damit nicht genug: jedes Jahr findet im Bernburg ein Kabarett-Festival statt. Verliehen wird dort an den beliebtesten Kabarettisten der „Till“. Es gibt Museen, die sich Eulenspiegel widmen und auch im Internet ist Eulenspiegel präsent. Er hat sogar seine eigene Webseite gefunden.
Bei einer Figur, die sich solcher Beliebtheit erfreut, liegt der Schluss nahe, sich ihr eingehender zu widmen. In dieser Arbeit sollen zwei verschiedene Eulenspiegel-Erzählungen verglichen werden. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede zu entdecken?
Als Vorlage dienen „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“ nach dem Druck von 1515 und „Till Eulenspiegel“ von Erich Kästner aus dem Jahre 1938. Sie sollen im weiteren Text nur „Dil Ulenspiegel“ und „Till Eulenspiegel“ bezeichnet werden. Neben diesen beiden Quellen dienen auch Werke zur Literaturtheorie als Grundlage.
Die Texte und Drucke werden vorgestellt und beschrieben. Daraufhin sollen Struktur und der Aufbau der Drucke miteinander verglichen werden. Ebenfalls stellt sich die Frage nach der Textgattung und nach den Autoren. Neben diesem Gerüst wird der Inhalt betrachtet. Die Texte werden dargestellt, analysiert und interpretiert. Wie gestaltet sich der Inhalt, wie sind die Abbildungen gestaltet, wie werden Sprache und Stilmittel eingesetzt? Beide Fassungen werden inhaltlich verglichen. Auf der dritten Ebene stehen die über das Inhaltliche hinausgehenden Kategorien: wer sind die Adressaten, was ergibt sich aus der Kategorie der Intertextualität, gibt es noch weitergehende Interpretationsmöglichkeiten?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Struktur und Aufbau
- 2.1. Vergleich des Aufbaus
- 2.2. Textgattung
- 2.3. Die Autoren
- 3. Inhalt
- 3.1. Vergleich des Inhalts
- 3.2. Sprache und Stilmittel
- 3.3. Abbildungen
- 4. Zusammenhänge und Darstellung
- 4.1. Adressaten
- 4.2. Intertextualität
- 5. Intention und andere Wissenschaften
- 5.1. Intention der verschiedenen Fassungen und Interpretationsmöglichkeiten
- 5.2. Eine juristische Interpretation
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Erich Kästners Adaption von Till Eulenspiegel mit der Fassung von 1515 („Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“) zu vergleichen. Die Untersuchung soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Struktur, Inhalt, Sprache und Intention beider Versionen herausarbeiten und verschiedene Interpretationsansätze beleuchten.
- Vergleich der Struktur und des Aufbaus beider Till Eulenspiegel-Fassungen
- Analyse der inhaltlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erzählungen
- Untersuchung der sprachlichen und stilistischen Mittel in beiden Texten
- Betrachtung der Adressaten und der Intertextualität
- Exploration weiterer Interpretationsmöglichkeiten, einschließlich juristischer Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Figur des Till Eulenspiegel vor – von einem Volkshelden bis hin zu einem Gauner. Sie begründet die Wahl der beiden zu vergleichenden Texte (Kästners „Till Eulenspiegel“ und die 1515er Ausgabe „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“) und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der einen Vergleich von Struktur, Inhalt, Sprache und Intention beider Fassungen vorsieht. Die Einleitung betont die Beliebtheit der Eulenspiegel-Figur und deutet auf weiterführende Forschungsansätze hin, die aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht umfassend behandelt werden können.
2. Struktur und Aufbau: Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Unterschiede zwischen Kästners und der 1515er Fassung. Der auffälligste Unterschied ist die Anzahl der Geschichten (12 bei Kästner, 96 in der älteren Ausgabe). Kästners Auswahl und die veränderte Reihenfolge der Geschichten werden diskutiert. Der Vergleich der Überschriften, der Nummerierung der einzelnen Geschichten und des Aufbaus des Inhaltsverzeichnisses unterstreicht die unterschiedlichen Intentionen und Zielgruppen beider Ausgaben: Kästners Fassung als Lesebuch im Gegensatz zur 1515er Ausgabe als kritische Studienausgabe mit Fußnoten und Erläuterungen.
Schlüsselwörter
Till Eulenspiegel, Erich Kästner, „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“, Literaturvergleich, Textgattung, Strukturanalyse, Inhaltsvergleich, Sprache und Stilmittel, Intertextualität, Interpretation, Adressaten, Juristische Interpretation.
Erich Kästners Adaption von Till Eulenspiegel im Vergleich zur Fassung von 1515: FAQs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Erich Kästners Adaption von Till Eulenspiegel mit der Fassung von 1515 („Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“). Der Fokus liegt auf der Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Struktur, Inhalt, Sprache und Intention beider Versionen.
Welche Aspekte werden im Vergleich untersucht?
Der Vergleich umfasst die Struktur und den Aufbau beider Texte (Anzahl der Geschichten, Anordnung, Überschriften, Nummerierung), den Inhalt (inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede), die Sprache und die verwendeten Stilmittel, die Adressaten und die Intertextualität. Zusätzlich werden verschiedene Interpretationsansätze, einschließlich einer juristischen Perspektive, beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Struktur und Aufbau (inkl. Vergleich des Aufbaus, Textgattung und Autoren), Inhalt (inkl. Vergleich des Inhalts, Sprache und Stilmittel, Abbildungen), Zusammenhänge und Darstellung (inkl. Adressaten und Intertextualität), Intention und andere Wissenschaften (inkl. Intention der verschiedenen Fassungen und Interpretationsmöglichkeiten, juristische Interpretation) und Fazit. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kästners Adaption und der 1515er Fassung von Till Eulenspiegel aufzuzeigen und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu diskutieren. Sie untersucht, wie die unterschiedlichen Intentionen der Autoren sich in Struktur, Inhalt und Sprache der Texte manifestieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Till Eulenspiegel, Erich Kästner, „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“, Literaturvergleich, Textgattung, Strukturanalyse, Inhaltsvergleich, Sprache und Stilmittel, Intertextualität, Interpretation, Adressaten, Juristische Interpretation.
Wie unterscheiden sich die beiden Fassungen von Till Eulenspiegel?
Der auffälligste Unterschied liegt in der Anzahl der Geschichten (12 bei Kästner, 96 in der 1515er Ausgabe). Kästner wählt Geschichten aus und verändert deren Reihenfolge. Der Aufbau, die Überschriften und die Nummerierung der Geschichten unterscheiden sich ebenfalls, was auf unterschiedliche Intentionen und Zielgruppen hindeutet: Kästners Fassung als Lesebuch im Gegensatz zur 1515er Ausgabe als kritische Studienausgabe.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der HTML-Auszug enthält kein Fazit. Ein Fazit würde die wichtigsten Ergebnisse der Vergleichsanalyse zusammenfassen und möglicherweise weitere Forschungsfragen aufwerfen.)
- Quote paper
- Christina Warneke (Author), 2006, Till Eulenspiegel im Literaturvergleich. Erich Kästners "Till Eulenspiegel" und "Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel" im Nachdruck von 1515, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82557