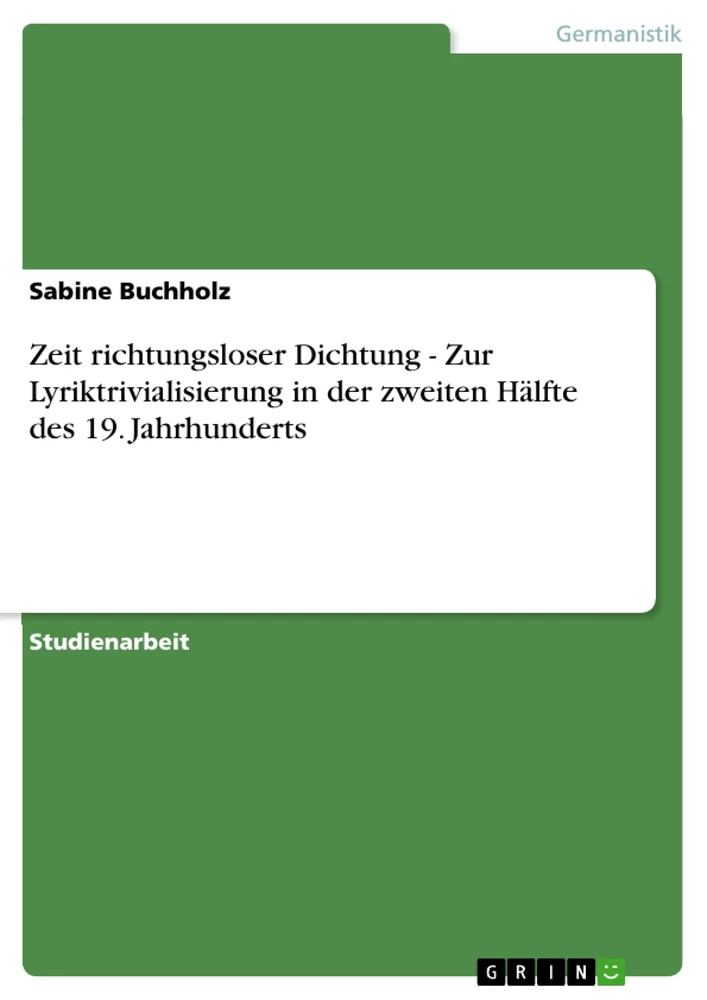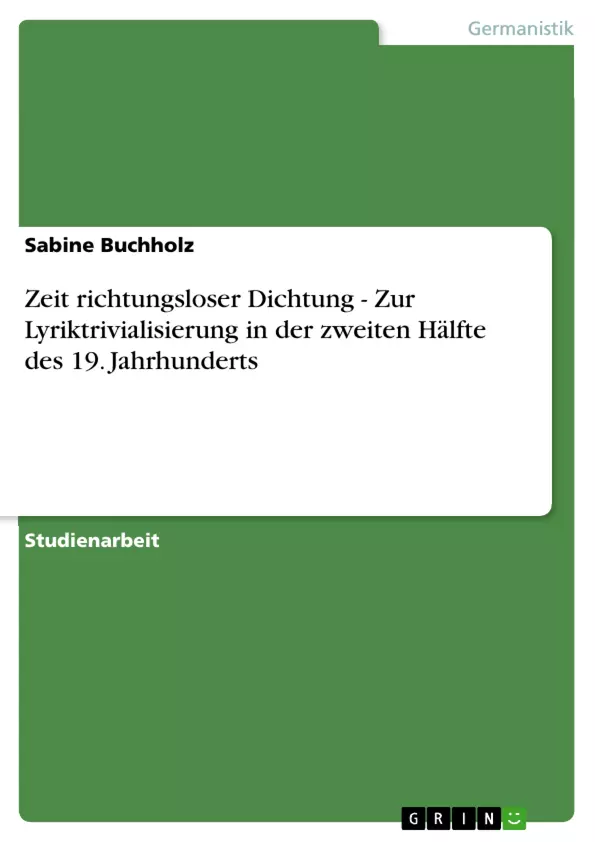Im Zeitraum zwischen 1850 und 1900 hat der Lyrikmarkt (auf Seiten der Produktion und Distribution) nachweislich einen enormen Aufschwung erlebt. Die Anzahl der Lyrik-Anfertigungen in diesen Jahrzehnten ist so gewaltig, dass man heute nur noch den kleinsten Teil der dazugehörigen Dichternamen kennt. Trotz der massenhaften Herstellung kann im lyrischen Bereich nur wenig Schöpferisches und Innovatives in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefunden werden. Stattdessen bestehen viele Anthologien jener Zeit aus einer Fülle an Triviallyrik. Häufig wird in wissenschaftlichen Untersuchungen dennoch besonders den wenigen großen Autoren Aufmerksamkeit gewidmet. Die Betonung ihrer grandiosen, jedoch – alles in allem gesehen – untypischen Werke ohne breite Resonanz verfälscht allerdings das Lyrikbild der Zeit massiv.
Es gibt verschiedene Arbeiten, die sich mit der Trivialisierung der Lyrik der damaligen Zeit befassen. Hierbei fällt auf, dass die Theorien sich teilweise widersprechen, dass sie verschiedenen Faktoren eine unterschiedliche Gewichtung zukommen lassen und dass sich andere Analysen wiederum ergänzen. Günter Häntzschel beispielsweise in seinen zahlreichen Studien hauptsächlich verschiedene Aspekte der sozialgeschichtlichen Komponente, während andere Forscher sich ausschließlich der Epigonenthese widmen, so etwa Claude David. Und die Darstellung des Literaturwissenschaftlers Jörg Schönert hebt den Aspekt der Distribuenten und der Präsentation der Texte hervor.
Die vorliegende Arbeit intendiert, jene Ursachen, die an dem Phänomen der Lyriktrivialisierung ab etwa 1850 mitwirken, aufzuzeigen. Hierbei werden die vorangegangene Epoche und die Theorie des Epigonentums ebenso einzubeziehen sein wie soziale Umstände, so zum Beispiel die (geschlechterbezogene) Schulbildung oder die sich ausbreitende Industrialisierung. Außerdem müssen sowohl die Anteile, welche die Produzenten an der Entwicklung hatten, als auch der Part der Rezipienten und der Distribuenten aufgeschlüsselt und kombiniert werden, um die Beziehungen und Abhängigkeiten der drei Mitwirkenden am Lyrikmarkt herauszustellen.
Ziel der Arbeit ist es, das vertrackte Geflecht der Faktoren, die schließlich unumgänglich zur Trivialisierung der damaligen Lyrikproduktionen geführt haben, zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- A. Einführung und Ziel der Arbeit
- B. Trivialliteratur im Allgemeinen – Was kennzeichnet diesen Sammelbegriff?
- II. Die Produzenten trivialer Lyrik, Teil 1: Die Epigonenthese
- A. Der Umbruch von der ersten zur zweiten Jahrhunderthälfte
- B., Männlein vs. Weiblein' - Die Geschlechterfrage
- C. Bildung und das weibliche Geschlecht
- 1. Die Höhere Töchterschule
- 2. Die Frau nach der Schulzeit
- III. Auswirkungen der sozialen Faktoren auf den Lyrikmarkt
- A. Folgen für die Lyrikproduktion - Die Produzenten, Teil 2
- B. Die Situation der Distribuenten und ihre Organe
- 1. Anthologien
- 2. Deklamatorien
- 3. Lyrik in Zeitschriften am Beispiel des Familienblattes ,,Gartenlaube”
- IV. Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Lyriktrivialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die Ursachen für den Aufschwung des Lyrikmarktes, sowohl auf Seiten der Produktion als auch der Distribution, und die Gründe für die gleichzeitig beobachtete Abnahme von Originalität und schöpferischer Kraft in der Lyrik jener Zeit. Die Arbeit beleuchtet die Rolle sozialer Faktoren, die Rolle der Epigonenthese, und die Auswirkungen der Rezeption auf die Trivialisierung des lyrischen Schaffens.
- Der Aufschwung des Lyrikmarktes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- Die Ursachen für die Trivialisierung der Lyrik
- Die Rolle sozialer Faktoren wie der Geschlechterfrage und der Schulbildung
- Die Bedeutung der Epigonenthese in der Lyrikproduktion
- Die Auswirkungen der Rezeption auf die Trivialisierung von Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Diese Einleitung stellt das Paradoxon des Aufschwungs des Lyrikmarktes bei gleichzeitiger Trivialisierung der Lyrikproduktion im späten 19. Jahrhundert dar. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und stellt die wichtigsten Forschungsansätze zur Lyriktrivialisierung vor.
- II. Die Produzenten trivialer Lyrik, Teil 1: Die Epigonenthese: Dieses Kapitel analysiert die sozialen Faktoren, die zur Trivialisierung der Lyrikproduktion beigetragen haben. Es geht auf den Umbruch von der ersten zur zweiten Jahrhunderthälfte, die Geschlechterfrage und die Rolle der Bildung für Frauen ein.
- III. Auswirkungen der sozialen Faktoren auf den Lyrikmarkt: Dieses Kapitel untersucht die Folgen der sozialen Faktoren für die Lyrikproduktion und die Situation der Distribuenten. Es analysiert die Rolle von Anthologien, Deklamatorien und Zeitschriften wie der ,,Gartenlaube" in der Verbreitung von Lyrik.
Schlüsselwörter
Trivialliteratur, Lyrik, Epigonenthese, soziale Faktoren, Geschlechterfrage, Schulbildung, Anthologien, Deklamatorien, Lyrikmarkt, Distribution, Rezeption, Trivialisierung, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Lyrik im späten 19. Jahrhundert „trivial“?
Trotz massenhafter Produktion fehlte es an Originalität; viele Werke waren epigonale Nachahmungen früherer Epochen, die auf den Massengeschmack ausgerichtet waren.
Was besagt die Epigonenthese?
Sie beschreibt das Phänomen, dass Dichter dieser Zeit vor allem Vorbilder der Klassik und Romantik nachahmten, ohne eigene schöpferische Innovationen hervorzubringen.
Welchen Einfluss hatte die Schulbildung für Frauen auf den Lyrikmarkt?
Die Bildung in „Höheren Töchterschulen“ förderte eine Lyrikrezeption und -produktion, die oft dem häuslichen und sentimentalen Bereich zuzuordnen war.
Welche Rolle spielten Zeitschriften wie die „Gartenlaube“?
Solche Familienblätter waren wichtige Distribuenten, die Triviallyrik in großen Auflagen verbreiteten und den Geschmack des Bürgertums prägten.
Was sind Deklamatorien?
Deklamatorien waren Sammlungen von Gedichten, die speziell für den öffentlichen oder privaten Vortrag zusammengestellt wurden und zur Popularisierung trivialer Lyrik beitrugen.
- Citar trabajo
- Sabine Buchholz (Autor), 2004, Zeit richtungsloser Dichtung - Zur Lyriktrivialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82617