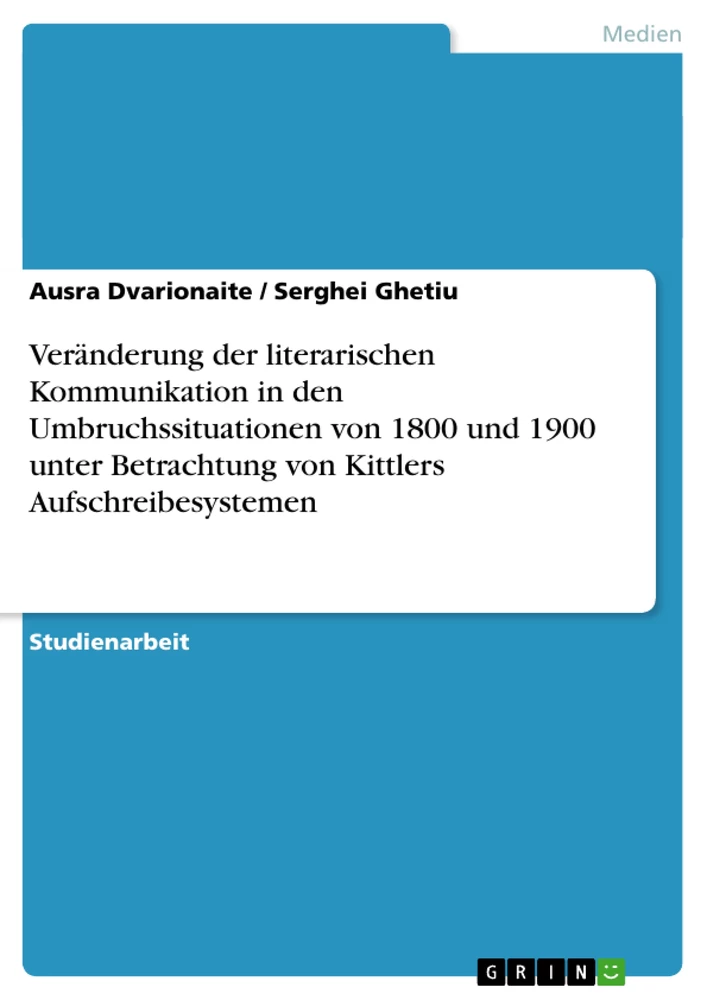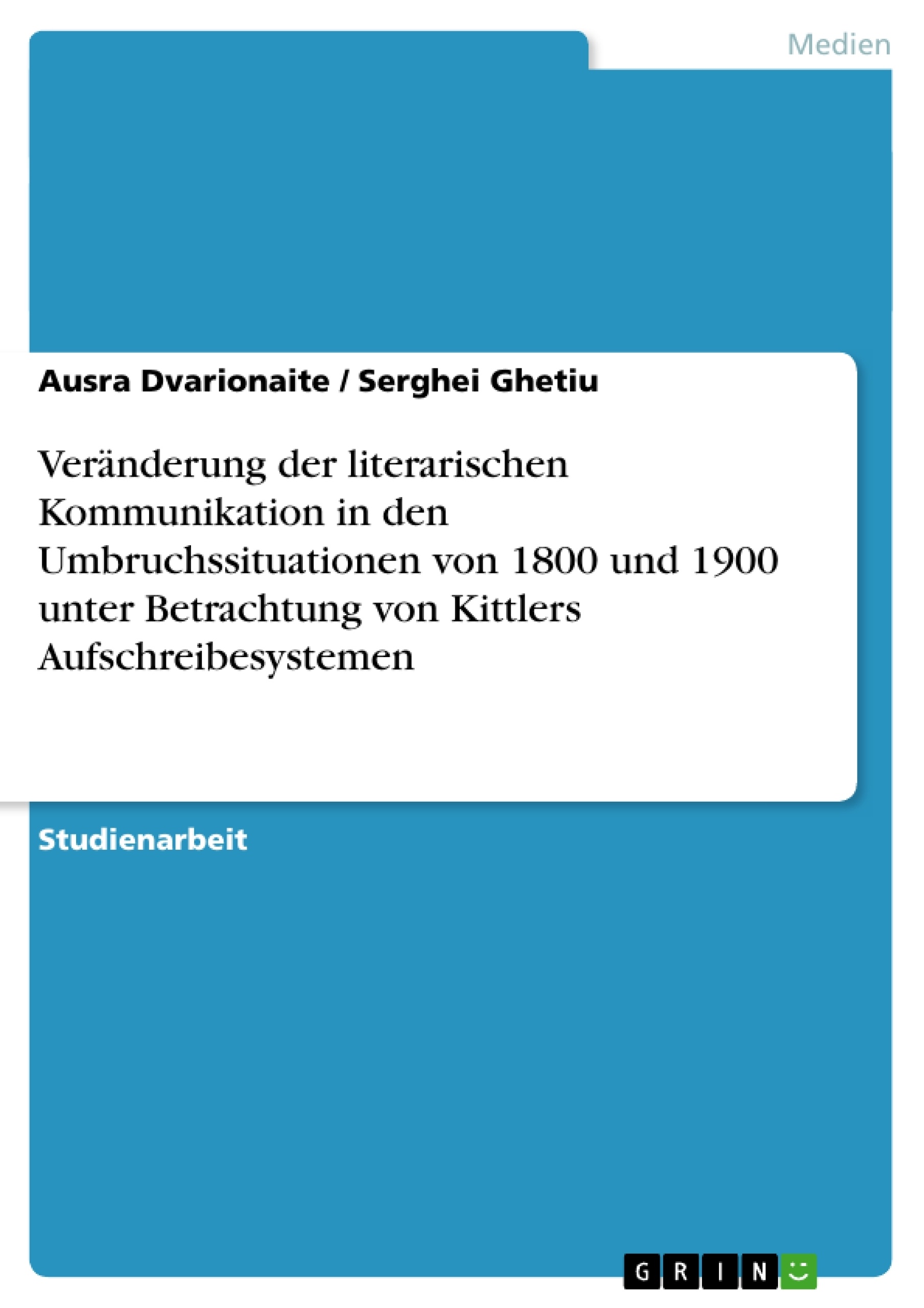In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich die literarische Kommunikation unter dem Einfluss von Medien verändert hat. Die besonderen Schwerpunkte sind vor allem Kittlers Aufschreibesysteme und deren Wirkung auf die Literatur 1800-1900. Als Beispiel für Aufschreibesystem 1800 wird das Werk „Die Leiden des jungen Werthers“ von Johann Wolfgang Goethe angeführt, was vor allem die Bedeutung der schriftlichen Kommunikation und die des Individuums in Literatur 1800 zeigen soll. Für Aufschreibesystem 1900, wo der Literatur unter dem Einfluss von neuen Medien Grammophon und Film bloß ein enger Bereich des Symbolischen bleibt, wird das Gedicht „Ein Wort“ von Gottfried Benn interpretiert, was die Unterschiede zwischen zwei Aufschreibesystemen demonstrieren soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in Friedrich Kittlers Medientheorien
- Aufschreibesysteme
- 1. Aufschreibesystem 1800.
- 1.1. Alphabetisierung
- 1.2. Institutionen um 1800: die Universität und der Staat.
- 1.3. Dichtung als wichtigste Kulturträger und Funktion des Autors........
- 1.4. Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werthers“.
- 2. Aufschreibesysteme 1900.
- 2.1. Die neue Wissenschaft Psychophysik.
- 2.2. Technische Datenspeicherung...
- 2.3. Psychoanalyse und Literatur
- 2.4. Gottfried Benns Gedicht „Ein Wort“.
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Veränderung der literarischen Kommunikation im Kontext der Umbruchsituationen von 1800 und 1900. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Friedrich Kittlers Aufschreibesystemen und deren Auswirkungen auf die Literatur. Die Arbeit beleuchtet, wie sich die Medienlandschaft in diesen beiden Epochen entwickelt hat und welchen Einfluss dies auf die Gestaltung und Rezeption literarischer Werke hatte.
- Entwicklung der literarischen Kommunikation im Kontext von Medienwandel
- Kittlers Theorie der Aufschreibesysteme
- Analyse von Aufschreibesystemen in den Epochen 1800 und 1900
- Bedeutung von Alphabetisierung und Bildung im 18. Jahrhundert
- Einfluss neuer Medien wie Grammophon und Film auf die Literatur des frühen 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung in Friedrich Kittlers Medientheorien: Dieser Abschnitt stellt die medientheoretischen Ansätze von Friedrich Kittler vor und beleuchtet seine Kritik an hermeneutischen und soziologischen Ansätzen in der Literaturwissenschaft. Die Bedeutung von Medien als Informationsvermittler im Kontext von Literatur wird diskutiert.
- Aufschreibesysteme: Dieses Kapitel erläutert Kittlers Konzept der Aufschreibesysteme, die als Netzwerke von Techniken und Institutionen betrachtet werden, welche die Speicherung und Verarbeitung von Informationen in einer Kultur ermöglichen.
- 1. Aufschreibesystem 1800.: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Veränderungen im Bildungssystem und der Alphabetisierung im 18. Jahrhundert, die Kittler als Ausgangsbasis des ersten Aufschreibesystems sieht. Es wird die Bedeutung von Institutionen wie Universität und Staat sowie die Rolle des Autors und der schriftlichen Kommunikation in der Literatur dieser Zeit untersucht.
- 2. Aufschreibesysteme 1900.: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Medien wie Grammophon und Film im frühen 20. Jahrhundert und deren Einfluss auf die literarische Kommunikation. Es werden die Auswirkungen der neuen Medien auf die literarische Gestaltung und die Rezeption untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Medienwandel, Aufschreibesysteme, Literatur, Alphabetisierung, Bildung, Universität, Staat, Autor, schriftliche Kommunikation, Grammophon, Film, Psychophysik, Psychoanalyse, und Gottfried Benn. Die theoretischen Grundlagen der Arbeit basieren auf Friedrich Kittlers medientheoretischen Ansätzen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Friedrich Kittler unter "Aufschreibesystemen"?
Es sind Netzwerke von Techniken und Institutionen, die einer Kultur die Speicherung und Verarbeitung von Daten ermöglichen.
Was kennzeichnet das "Aufschreibesystem 1800"?
Es ist geprägt durch Alphabetisierung, die zentrale Rolle der Dichtung als Kulturträger und die Bedeutung des Individuums, beispielhaft dargestellt an Goethes "Werther".
Wie verändert sich die Literatur im "Aufschreibesystem 1900"?
Unter dem Einfluss technischer Medien wie Grammophon und Film verliert die Literatur ihr Monopol auf die Datenspeicherung; ihr bleibt nur noch der Bereich des Symbolischen.
Welche Rolle spielt Gottfried Benn in dieser Analyse?
Sein Gedicht "Ein Wort" dient als Beispiel für das Aufschreibesystem 1900 und demonstriert die veränderte literarische Kommunikation im 20. Jahrhundert.
Welchen Einfluss hatte die neue Wissenschaft der Psychophysik?
Sie trug zur Entstehung des Aufschreibesystems 1900 bei, indem sie menschliche Wahrnehmung messbar machte und die Grundlage für technische Speicherungsmedien legte.
- Citation du texte
- Ausra Dvarionaite (Auteur), Serghei Ghetiu (Auteur), 2007, Veränderung der literarischen Kommunikation in den Umbruchssituationen von 1800 und 1900 unter Betrachtung von Kittlers Aufschreibesystemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82681