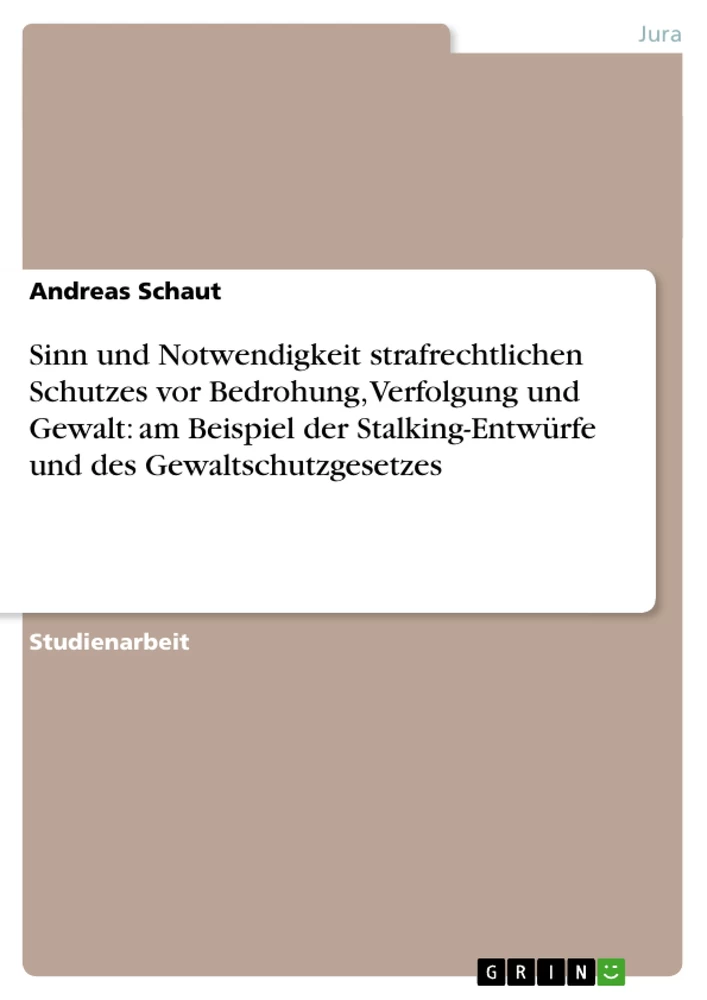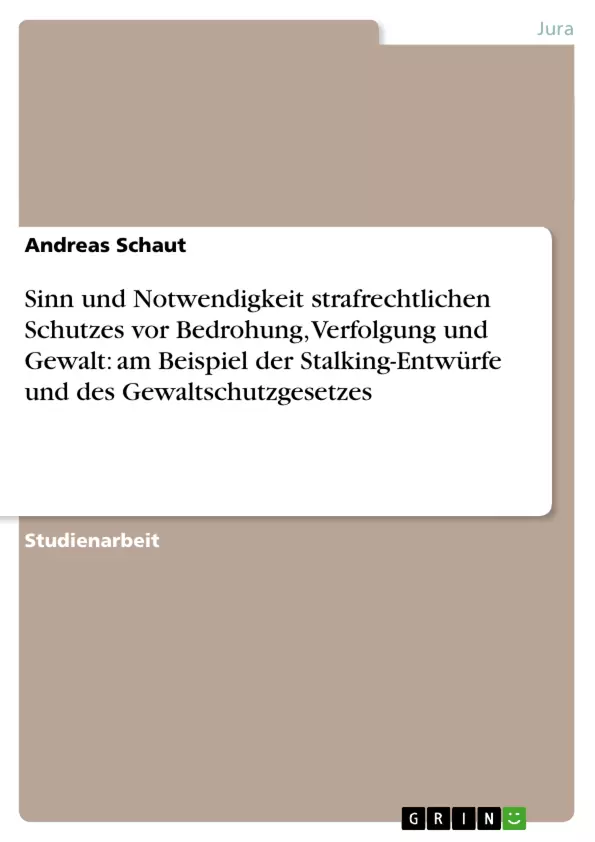In dubio pro libertate – dieser Restriktionsgrundsatz wird oft angeführt, wenn unsicher ist, ob durch freiheitsbeschränkende gesetzgeberische Interventionen ein erstrebtes Ziel überhaupt erreicht werden kann. So wundert es nicht, dass diese Maxime auch früh von liberaler Seite gegen die Absicht des Gesetzgebers ins Feld geführt wurde, das Strafgesetzbuch um den Tatbestand des Stalking zu erweitern. Ob die partiell geforderte gesetzgeberische Zurückhaltung auf dem Gebiet des Strafrechts zum Schutz vor Belästigung, Bedrohung und Gewalt auch im Hinblick auf die Erscheinungsformen des Stalking geboten erscheint, oder ob ein sinnvoller Straftatbestand nicht vielmehr längst überfällig ist, soll in dieser Arbeit vor allem mit Blick auf das Gewaltschutzgesetz und die Stalking-Entwürfe untersucht werden.
Dabei wird zunächst basierend auf kiminologischen Erkenntnissen die Phänomenologie des Stalking dargestellt um auf dieser Basis den bereits bestehenden strafrechtlichen Schutz vor solchen Verhaltensweisen zu analysieren. Nach einer Strafwürdigkeitsprüfung des Stalking-Verhaltens wird sodann unter Heranziehung des Gewaltschutzgesetzes und der Stalking-Gesetzentwürfe untersucht, was bei der Genese eines entsprechenden Straftatbestandes de lege ferenda zu beachten sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung/ Phänomenologie des Stalking
- ,,Mildes Stalking“
- ,,Schweres Stalking“
- Kriminologische Erkenntnisse
- Täter/ Stalkertypologie
- Statische Faktoren
- Dynamische Faktoren
- Situative Faktoren
- Klassifizierung
- ,,Rejected Stalker“
- ,,Intimacy seeker“
- ,,Incompetent siutors“
- ,,Resentful stalker“
- ,,Predatory stalker“
- Opfer
- Prävalenzrate
- Strafrechtlicher Schutz – Strafbarkeit nach dem StGB de lege lata
- Körperverletzungsdelikte, §§ 223f, 229 StGB
- Nötigung, § 240 StGB
- Sexuelle Nötigung, §177 StGB
- Bedrohung, § 241 StGB
- Freiheitsberaubung, § 239 StGB
- Hausfriedensbruch, § 123 StGB
- Beleidigungsdelikte, §§ 185ff StGB
- Sachbeschädigung, § 303 StGB
- Das Gewaltschutzgesetz
- Geschichte und Ziel des Gesetzes
- Gesetztechnische Konstruktion
- § 1 GewSchG
- §§ 2 und 3 GewSchG
- § 4 GewSchG
- Verfahrens- und Vollstreckungsregeln
- Positive Bewertung des Gesetzes
- Kritische Auseinandersetzung mit dem GewSchG
- Dogmatische zivil- und strafrechtliche Bindungsprobleme
- Materiellrechtliche Defizite und Probleme
- Verfahrens- und vollstreckungsrechtliche Probleme
- Praktische Probleme
- Strafwürdigkeit des Stalking
- Grundsätze einer Strafwürdigkeitsprüfung
- Anwendung der Strafwürdigkeitsgrundsätze auf Stalking
- Das zu schützende Rechtsgut
- Verfassungsrang
- gesellschaftliche Akzeptanz
- Sozialschädlichkeit
- Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips
- Schuldfähigkeit des Stalkers
- Stalking - Strafbarkeit de lege ferenda
- Entwicklungsgeschichte der Gesetzesinitiativen
- Der Gesetzentwurf des Bundesregierung: § 241b, „Nachstellung“
- Systematik des § 241b
- § 241b Absatz 1
- § 241b Absatz 2
- Der Gesetzentwurf des Bundesrates: § 238 StGB, „Schwere Belästigung“
- Systematik des § 238 nF
- § 238 nF Absatz 1
- § 238 nF Absatz 2
- § 238 nF Absatz 3
- § 238 nF Absatz 4
- § 238 nF Absatz 5
- § 238 nF Absatz 6
- die Einführung der Deeskalationshaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit strafrechtlichen Schutzes gegen Belästigung, Bedrohung und Gewalt am Beispiel der Stalking-Entwürfe und des Gewaltschutzgesetzes. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Stalking als rechtliches Phänomen, untersucht die strafrechtliche Regulierung des Stalkings und bewertet die bestehenden Gesetze sowie die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen.
- Analyse des Stalking als rechtliches Phänomen und seiner unterschiedlichen Formen
- Bewertung des strafrechtlichen Schutzes gegen Stalking im Kontext der bestehenden Gesetze
- Untersuchung der kriminologischen Erkenntnisse zu Stalking und der Rolle der Täter und Opfer
- Analyse der Gesetzesentwürfe zur Strafbarkeit des Stalkings und deren Relevanz für den strafrechtlichen Schutz
- Bewertung der Notwendigkeit eines umfassenden strafrechtlichen Schutzes gegen Belästigung, Bedrohung und Gewalt im Kontext des Stalking-Phänomens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und führt in die Thematik des strafrechtlichen Schutzes gegen Belästigung, Bedrohung und Gewalt am Beispiel des Stalking ein. Kapitel II beleuchtet die verschiedenen Formen von Stalking, während Kapitel III kriminologische Erkenntnisse zum Stalking mit Schwerpunkt auf Tätertypologie, Opfer und Prävalenzraten präsentiert. Kapitel IV analysiert die Strafbarkeit des Stalkings nach geltendem Recht, wobei verschiedene Delikte im StGB betrachtet werden. Kapitel V widmet sich dem Gewaltschutzgesetz, seiner Entstehung und seiner Bedeutung für den Schutz vor Stalking. Kapitel VI diskutiert die Strafwürdigkeit des Stalkings und die Anwendung der Strafwürdigkeitsgrundsätze. Kapitel VII beleuchtet die Entwicklung der Gesetzesinitiativen zur Strafbarkeit des Stalkings und analysiert die wichtigsten Gesetzentwürfe.
Schlüsselwörter
Stalking, Belästigung, Bedrohung, Gewalt, Strafrecht, Strafbarkeit, Gewaltschutzgesetz, Straftaten, Stalkertypologie, Opfer, Prävalenz, Rechtsschutz, Gesetzesentwürfe, Strafwürdigkeit, Rechtsgüterschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Gewaltschutzgesetz im Zusammenhang mit Stalking?
Das Gewaltschutzgesetz ermöglicht es Opfern, gerichtliche Schutzanordnungen wie Kontakt- und Näherungsverbote gegen Stalker zu erwirken.
Was versteht man unter der Stalkertypologie?
Die Kriminologie unterscheidet verschiedene Tätermotive, wie den „Rejected Stalker“ (nach einer Trennung), den „Intimacy Seeker“ oder den „Predatory Stalker“.
Wie war Stalking vor der Einführung spezifischer Gesetze strafbar?
Vor der Einführung des Nachstellungsparagrafen (§ 238 StGB) mussten Einzelstraftaten wie Nötigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung herangezogen werden.
Warum wurde ein eigener Straftatbestand für „Nachstellung“ gefordert?
Da die Summe der Belästigungen oft schwerwiegender ist als die einzelnen Taten, sollte eine Gesetzeslücke geschlossen werden, um Opfer besser vor psychischem Terror zu schützen.
Was ist der Unterschied zwischen „mildem“ und „schwerem“ Stalking?
Die Phänomenologie unterscheidet nach der Intensität der Nachstellung, der Dauer und dem Grad der Bedrohung für das Leben des Opfers.
Was bedeutet der Grundsatz „In dubio pro libertate“ in diesem Kontext?
Es ist ein Restriktionsgrundsatz, der zur Zurückhaltung bei neuen Strafgesetzen mahnt, sofern nicht sicher ist, ob sie das angestrebte Ziel der Sicherheit tatsächlich erreichen.
- Citar trabajo
- Andreas Schaut (Autor), 2006, Sinn und Notwendigkeit strafrechtlichen Schutzes vor Bedrohung, Verfolgung und Gewalt: am Beispiel der Stalking-Entwürfe und des Gewaltschutzgesetzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82949