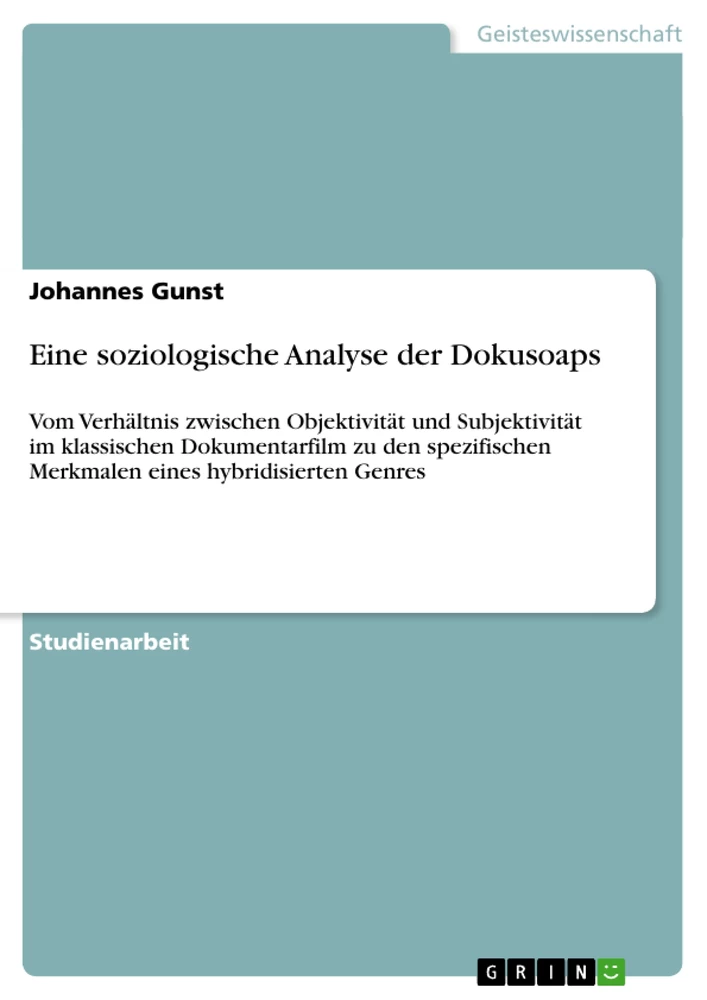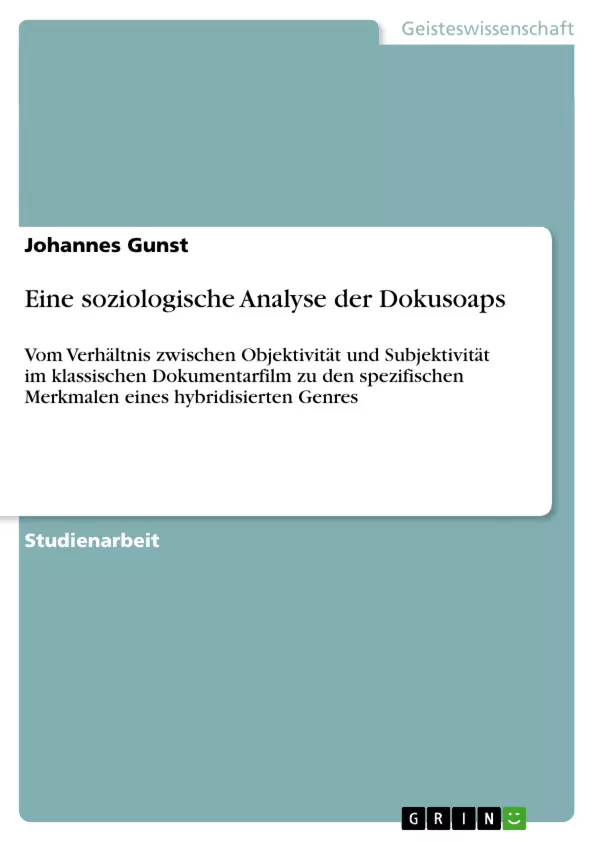Dokusoaps sind ein recht neues Genre und schon der zusammengesetzte Name gibt einen Hinweis darauf, dass es sich um eine Mischung aus Fiktivem (Soap) und nicht-fiktivem (Dokumentation) handeln soll.
Doch wie viel Dokumentarisches steckt tatsächlich in den Dokusoaps? Und kann die Dokumentation im ursprünglichen Sinne wirklich als nicht-fiktiv charakterisiert werden?
Um diese Fragen zu beantworten und die Dokusoaps in ihren Merkmalen, Rezeptionsmotiven und Wirkungen zu erfassen, scheint also der Blick zurück zum klassischen Dokumentarfilm hilfreich und angebracht. Unter systemtheoretischen Aspekten soll das Verhältnis zwischen Objektivität und Subjektivität, also zwischen Realität und Repräsentation im klassischen Dokumentarfilm untersucht werden. Dies soll sowohl auf Seiten des Produktionsprozesses als auch auf Seiten der Rezeption geschehen, um schließlich Aussagen über mögliche Wirkungen treffen zu können.
Unter Zuhilfenahme der so gewonnenen theoretischen Erkenntnisse soll analysiert werden, was im Kontrast zu klassischen Dokumentarfilmen den Kern des Wesens von Dokusoaps in Bezug auf ihr spezifisches Verhältnis zur Realität ausmacht. Der Realitätsbezug von Dokusoaps im Zusammenhang mit einer Darstellung von empirischen Befunden zu Nutzungsmotiven soll schließlich die spezielle Attraktivität von Dokusoaps verständlicher machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des Dokumentarfilms
- Definition und Anspruch des klassischen Dokumentarfilms
- Dokumentarfilme als Wirklichkeitskonstruktion
- Rezeption und Wirkungen von Dokumentarfilmen
- Das Genre der Dokusoap
- Rahmenbedingungen für die Entstehung von Dokusoaps
- Definition, Kennzeichen und Verbreitung des Genres
- Nutzungsmotive und Wirkungen von Dokusoaps
- Zusammensetzung des Publikums
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Genre der Dokusoaps anhand der Frage nach dem Verhältnis von Objektivität und Subjektivität in der Darstellung von Realität. Dazu wird zunächst der klassische Dokumentarfilm unter systemtheoretischen Aspekten betrachtet, um die Herausforderungen und Grenzen der objektiven Darstellung von Realität zu beleuchten. Anschließend wird dieses Wissen auf das Genre der Dokusoaps übertragen, um die spezifischen Merkmale und die Attraktivität dieses hybridisierten Genres zu verstehen.
- Definition und Anspruch des klassischen Dokumentarfilms
- Dokumentarfilme als Wirklichkeitskonstruktion
- Der Realitätsbezug von Dokusoaps
- Nutzungsmotive und Wirkungen von Dokusoaps
- Die spezifischen Merkmale der Dokusoap
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Genre der Dokusoaps vor und erläutert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie setzt den Fokus auf die Ambivalenz des Genre-Begriffs „Dokusoap“, der eine Mischung aus Fiktivem und Nicht-fiktivem impliziert. Um die spezifischen Merkmale der Dokusoap besser zu verstehen, wird in der Arbeit zunächst der klassische Dokumentarfilm unter systemtheoretischen Aspekten betrachtet.
Die Theorie des Dokumentarfilms
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Anspruch und der Definition des klassischen Dokumentarfilms. Es wird untersucht, ob ein Dokumentarfilm tatsächlich eine objektive Realität abbilden kann, welche Zwänge bei der Produktion auftreten und welche Mechanismen bei der Rezeption durch das Publikum wirken. Die Arbeit untersucht dabei die Rolle der Selektivität und der subjektiven Interpretation bei der Konstruktion von Realität im Dokumentarfilm.
Das Genre der Dokusoap
Dieses Kapitel analysiert die Entstehung, Verbreitung und die charakteristischen Merkmale des Genres der Dokusoaps. Es befasst sich mit den Rahmenbedingungen für die Entstehung des Genres sowie mit Nutzungsmotiven und Wirkungen von Dokusoaps. Darüber hinaus wird die Zusammensetzung des Publikums beleuchtet.
Schlüsselwörter
Dokusoap, Dokumentarfilm, Objektivität, Subjektivität, Realität, Repräsentation, Systemtheorie, Wirklichkeitskonstruktion, Selektivität, Rezeption, Nutzungsmotive, Genre-Hybridisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Dokusoap?
Ein hybrides Fernsehgenre, das dokumentarische Elemente (reale Personen/Orte) mit dramaturgischen Mitteln der Soap Opera (Fiktion) verbindet.
Wie viel "Realität" steckt in einer Dokusoap?
Obwohl reale Menschen gezeigt werden, ist die Darstellung oft durch Inszenierung, gezielte Auswahl und dramatischen Schnitt stark konstruiert.
Was unterscheidet Dokusoaps vom klassischen Dokumentarfilm?
Der klassische Dokumentarfilm hat einen höheren Objektivitätsanspruch, während die Dokusoap primär auf Unterhaltung, Emotionalisierung und Voyeurismus setzt.
Warum sind Dokusoaps so beliebt beim Publikum?
Nutzungsmotive sind unter anderem soziale Vergleiche, Neugier am Leben anderer und die einfache emotionale Teilhabe an Alltagsproblemen.
Was bedeutet "Wirklichkeitskonstruktion" im Fernsehen?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Medien durch Auswahl und Rahmung eine eigene Version der Realität erschaffen, die vom Zuschauer als "echt" wahrgenommen wird.
- Citar trabajo
- Johannes Gunst (Autor), 2005, Eine soziologische Analyse der Dokusoaps, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83009