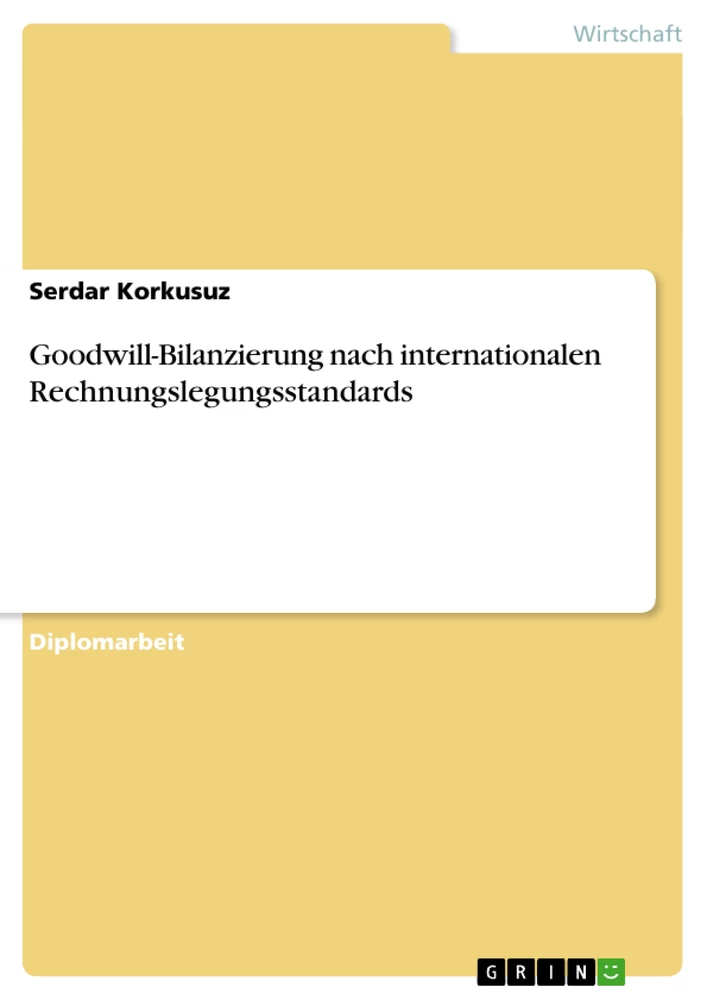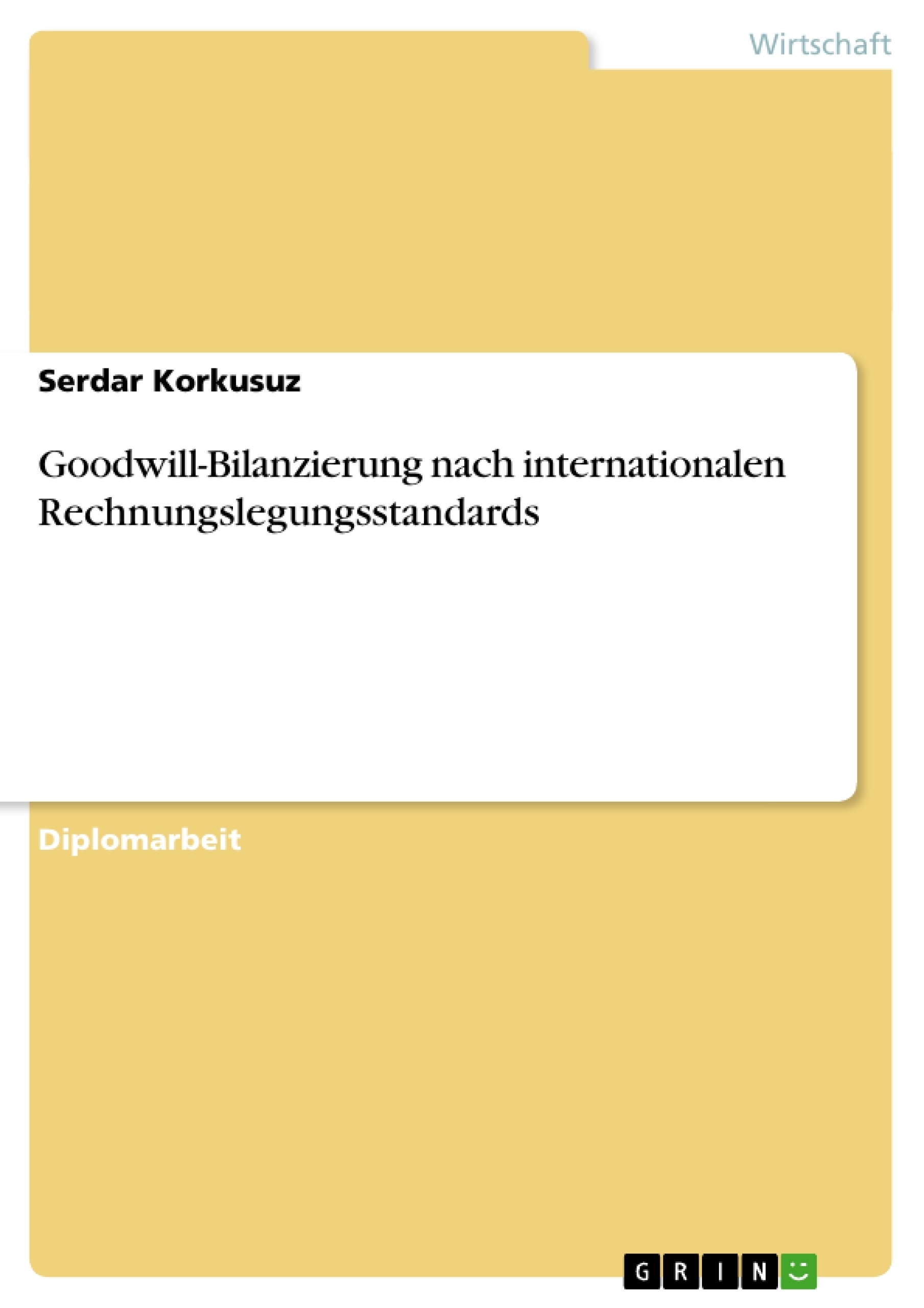„Der Kauf und Verkauf von Unternehmen bzw. Vermögensgegenständen wird auch in Zukunft unsere Wirtschaft beeinflussen. Die dazugehörigen Bewertungen dienen dabei nicht mehr ausschließlich zur Preis- und Entscheidungsfindung, sondern haben sich zu einem wichtigen Instrument der strategischen Unternehmenspolitik entwickelt.“ Insbesondere die Bedeutung des Geschäftswerts bzw. Goodwills nimmt ständig zu. „Bei zahlreichen Unternehmenszusammenschlüssen gehört er mittlerweile zu den Schlüsselgrößen der Übernahmeverhandlungen.“ Ausschlaggebend für dessen Bedeutungszuwachs ist einerseits die rapide steigende Anzahl von Unternehmenszusammenschlüssen und andererseits fallen Kaufpreis und bilanzielles Eigenkapital beim Unternehmenswerwerb immer mehr auseinander. Die Ursache dafür sind die immer Bedeutsamer werdenden immateriellen Vermögenswerte, „die sich nur teilweise hinreichend objektivieren lassen“ und somit in die Restgröße Goodwill einfließen, da sie nicht einzeln bilanziell abgebildet werden. So ist bspw. bei der Übernahme der Mannesmann AG durch Vodafone ein Goodwill in Höhe von ca. 140 Mrd. Euro entstanden. In vielen Fällen nimmt der Goodwill mehr als die Hälfte der Bilanzsumme ein und übersteigt nicht selten das bilanzielle Eigenkapital. So etwa betrug im Geschäftsjahr 2004 die „Goodwill/Eigenkapital“-Relation bei der TUI AG 126%. Aufgrund dessen investieren immer mehr Unternehmen große Summen in immaterielle Vorteile wie Know-how, Mitarbeiterqualität etc. Wegen seiner zentralen Bedeutung können schon die geringsten Modifikationen in der Bilanzierung des Goodwills die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns dramatisch beeinflussen und somit einem „wünschenswerten Unternehmenszusammenschluss im Wege stehen oder diesen begünstigen.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- Überblick über die betrachteten Rechnungslegungssysteme
- Rechnungslegung nach nationalen Vorschriften
- HGB
- DRSC
- Rechnungslegung nach internationalen Vorschriften
- US-GAAP
- IFRS
- Goodwill-Bilanzierung nach HGB
- Bilanzieller Charakter des Goodwills nach HGB
- Entstehung und Ansatz
- Folgebewertung des Goodwills nach HGB
- Pauschale Abschreibung
- Planmäßige Abschreibung
- Außerplanmäßige Abschreibung
- Verrechnung mit den Rücklagen
- Sonderfall negativer Goodwill
- Angabepflichten
- Goodwill-Bilanzierung nach DRS 4
- Die neue Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP
- Ausgangspunkt für SFAS 141 und 142
- Die Kaufpreisallokation nach SFAS 141
- Bilanzieller Charakter des Goodwills nach US-GAAP
- Folgebilanzierung des Goodwills gem. SFAS 142: Impairment-Only-Approach
- Aufteilung des Goodwills auf Reporting Units
- Durchführung des zweistufigen Impairment Tests
- Ermittlung eines Wertberichtigungsbedarfs des Goodwills
- Ermittlung und Behandlung der Wertberichtigunghöhe des Goodwills
- Zeitpunkt des Impairment Tests und testauslösende Indikatoren
- Offenlegunspflichten
- Goodwill-Bilanzierung nach IFRS 3
- Konzeption und Inhalt von IFRS 3
- Anwendungsbereich
- Die Erwerbsmethode im Rahmen der Erstkonsolidierung
- Bestimmung des Erwerbers
- Erwerbszeitpunkt
- Ermittlung der Anschaffungskosten
- Kaufpreisallokation
- Grundüberlegungen
- Identifikation von Vermögenswerten und Schulden
- Bewertung der Vermögenswerte und Schulden
- Korrektur vorläufiger Erstkonsolidierungen
- Ermittlung des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung
- Goodwill
- Negativer Goodwill/Passiver Unterschiedsbetrag
- Folgebilanzierung des Goodwills nach dem Impairment-Only-Approach
- Identifizierung der Cash Generating Units
- Der Impairment Test nach IFRS 3/IAS 36
- Ermittlung des Wertminderungsbedarfs
- Zeitpunkt und Häufigkeit des Impairment Tests
- Minderheitenanteile
- Anhangsangaben
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassender Vergleich
- Kritische Anmerkungen
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Goodwill-Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Ansätze zur Bilanzierung von Goodwill in den drei wichtigsten Rechnungslegungssystemen (HGB, US-GAAP und IFRS) zu vergleichen und zu analysieren.
- Die verschiedenen Rechnungslegungsansätze zur Goodwill-Bilanzierung
- Die Auswirkungen der unterschiedlichen Ansätze auf die Bilanzierungspraxis
- Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze
- Die Entwicklung der Goodwill-Bilanzierung im internationalen Kontext
- Die aktuelle Diskussion um die Reform der Goodwill-Bilanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert die Zielsetzung und den Gang der Untersuchung. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die betrachteten Rechnungslegungssysteme, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. In Kapitel drei wird die Goodwill-Bilanzierung nach HGB dargestellt. Es werden die Entstehung und der Ansatz von Goodwill sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Folgebewertung erläutert. Kapitel vier befasst sich mit der neuen Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP. Dabei werden die Grundzüge des Impairment-Only-Approach erläutert. Kapitel fünf behandelt die Goodwill-Bilanzierung nach IFRS 3. Es werden die Erwerbsmethode, die Kaufpreisallokation und die Folgebewertung des Goodwills nach IFRS 3 analysiert. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, stellt kritische Anmerkungen zur Goodwill-Bilanzierung an und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Goodwill-Bilanzierung.
Schlüsselwörter
Goodwill, Bilanzierung, Rechnungslegungsstandards, HGB, US-GAAP, IFRS, Impairment-Only-Approach, Erwerbsmethode, Kaufpreisallokation, Folgebewertung, Kapitalkonsolidierung, Cash Generating Unit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Goodwill in der Bilanzierung?
Der Goodwill (Geschäftswert) ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis eines Unternehmens und dessen bilanziellem Eigenkapital, oft bedingt durch immaterielle Werte wie Know-how.
Wie unterscheidet sich die Goodwill-Behandlung nach HGB und IFRS?
Während das HGB oft planmäßige Abschreibungen vorsieht, nutzt IFRS den „Impairment-Only-Approach“, bei dem nur bei tatsächlicher Wertminderung abgeschrieben wird.
Was bedeutet „Impairment-Only-Approach“?
Es handelt sich um ein Verfahren nach US-GAAP und IFRS, bei dem der Goodwill nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich auf Wertminderung (Impairment Test) geprüft wird.
Was versteht man unter Kaufpreisallokation?
Die Aufteilung des Kaufpreises auf die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden eines erworbenen Unternehmens im Rahmen der Erstkonsolidierung.
Warum ist die Goodwill-Bilanzierung so risikoreich?
Da der Goodwill oft einen großen Teil der Bilanzsumme ausmacht, können schon kleine Änderungen in der Bewertung die Ertragslage eines Konzerns massiv beeinflussen.
- Citar trabajo
- Serdar Korkusuz (Autor), 2006, Goodwill-Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsstandards, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83055