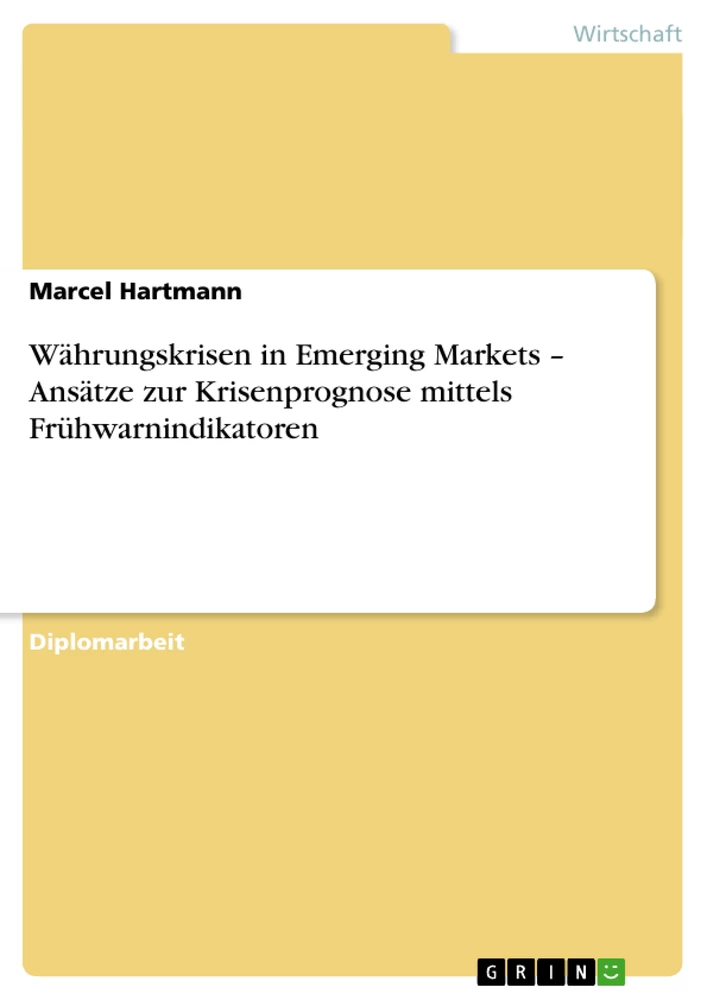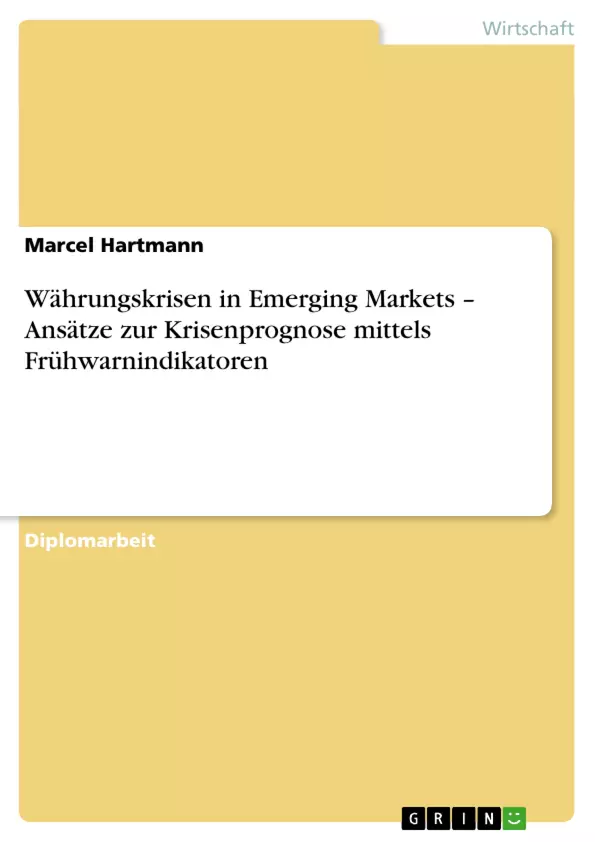Der Blick auf die Historie von Währungskrisen lässt den Schluss zu, dass diese in den letzten Jahren mit zunehmender Häufigkeit aufgetreten sind. Die Auswirkungen waren immer tiefgreifender und die betroffenen Länder wie auch die Weltwirtschaft hatten in der Folge mit immer bedeutenderen Problemen zu kämpfen. Währungskrisen sind zwar auf keinen bestimmten Typus von Ländern beschränkt, die Häufigkeit und Stärke ist in Emerging Markets aber besonders verheerend.
Es gibt verschiedene Definitionen und Ansichten darüber, ab wann von einer Währungskrise gesprochen werden kann. Es kann der reale Wechselkurs herangezogen werden, bei dessen Abwertung um einen bestimmten prozentualen Anteil relativ zur Vorperiode von einer Krise gesprochen wird. Ein anderer Ansatz sieht vor, einen Krisenindex bestehend aus Wechselkurs, Währungsreserven sowie entweder mit oder ohne Zinssatz zu konstruieren. Bei Überschreiten eines definierten Schwellenwertes kann von einer Währungskrise gesprochen werden.
In Bezug auf die Krisenvorbeugung liegt es im Interesse des Ökonomen und der Politik im Besonderen, potentielle Krisen möglichst frühzeitig zu erkennen, um geeignete Gegenmaßnahmen zur Krisenabwehr ergreifen und dadurch potentielle volkswirtschaftliche Defizite beseitigen zu können. Hierbei kommt Frühwarnindikatoren eine bedeutende Rolle zu.
Ex post betrachtet verschlechtern sich vor Ausbruch von Währungskrisen viele ökonomische Aggregate. Je nach verwendetem Modell, kann mittels logisch deduktiver oder ökonometrischer Verfahren versucht werden, Frühwarnindikatoren zu identifizieren, so dass Währungskrisen mit mehr oder minder großer Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden können.
Die Darstellung von Ansätzen zur Prognose von Währungskrisen mittels Frühwarnindikatoren ist Gegenstand dieser Arbeit. Im zweiten Kapitel werden der Begriff und die Historie von Währungskrisen dargestellt sowie die Eigenschaften von Frühwarnindikatoren definiert. Im dritten Kapitel werden die traditionellen Ansätze zur Erklärung von Währungskrisen erster und zweiter Generation dargestellt. Hieran schließt sich das vierte Kapitel mit Darstellung neuerer, gerade für Emerging Markets relevanter, Währungskrisenmodellansätze an. Im fünften Kapitel werden verschiedene Ansätze für Frühwarnindikatoren zur Krisenprognose dargestellt; eigene Ergebnisse in Form eines Logit-Modells exemplifizieren das Vorgehen bei multivariaten Wahrscheinlichkeitsmodellen. Das sechste Kapitel schließt mit einem Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN
- SYMBOLVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFLICHKEIT UND HISTORIE
- 2.1 Definition des Begriffs Währungskrise
- 2.2 Historie von Währungskrisen
- 2.3 Besonderheiten von Währungskrisen in Emerging Markets
- 2.4 Zur Definition von Frühwarnindikatoren
- 2.4.1 Eigenschaften von Frühwarnindikatoren
- 2.4.2 Adressaten von Frühwarnindikatoren
- 2.4.3 (Politische) Implikationen von Frühwarnindikatoren
- 3 TRADITIONELLE WÄHRUNGSKRISENMODELLE
- 3.1 Modelle der ersten Generation
- 3.1.1 Kanonisches Ursprungsmodell von KRUGMAN
- 3.1.2 Flood/Garber Modell
- 3.1.3 Implikationen aus den Modellen der ersten Generation für Frühwarnindikatoren
- 3.2 Modelle der zweiten Generation
- 3.2.1 OBSTFELD Modell
- 3.2.2 Modell von JEANNE
- 3.2.3 Implikationen aus den Modellen der zweiten Generation für Frühwarnindikatoren
- 4 NEUERE WÄHRUNGSKRISENMODELLE
- 4.1 Modell der dritten Generation
- 4.1.1 Bankenkrisen
- 4.1.1.1 Moral Hazard
- 4.1.1.2 Overborrowing und internationaler Kapitalmarkt
- 4.1.2 Twin crises
- 4.2 Implikationen aus dem Modell der dritten Generation für Frühwarnindikatoren
- 4.3 Modell der „vierten Generation“
- 4.4 Zwischenfazit
- 4.5 Zum Problem der Modellgenerationen
- 5 FRÜHWARNINDIKATOREN ZUR KRISENPROGNOSE
- 5.1 Krisendefinition: Wahl der endogenen Variable
- 5.1.1 Exchange market pressure index (EMPI)
- 5.1.1.1 Krisendefinition mittels EMPI nach EICHENGREEN / ROSE / WYPLOSZ
- 5.1.1.2 Krisendefinition mittels EMPI nach KAMINSKY / LIZONDO / REINHART
- 5.1.1.3 Vereinfachung des EMPI
- 5.1.2 Krisendefinition nach ZHANG
- 5.1.3 Krisendefinition nach FRANKEL / ROSE
- 5.1.4 Vergleich der Krisendefinitionen
- 5.1.5 Zwischenfazit
- 5.2 Modellauswahl
- 5.2.1 Signal-Ansatz
- 5.2.2 Multivariate Wahrscheinlichkeitsmodelle
- 5.2.2.1 Logit-Modell
- 5.2.2.2 Probit-Modell
- 5.2.2.3 Exkurs: Nested Logit-Modell
- 5.3 Inhaltliche Modellkonstruktion
- 5.3.1 Datenauswahl
- 5.3.1.1 Regionale und zeitliche Datenauswahl
- 5.3.1.2 Paneldaten
- 5.3.2 Indikatorenauswahl: Wahl der exogenen Variablen
- 5.3.2.1 Ökonomische Indikatoren
- 5.3.2.2 Institutionelle Indikatoren
- 5.4 Zeithorizont der Eintrittswahrscheinlichkeit
- 5.5 Ergebnisse aus den Modellen
- 5.5.1 Ergebnisse aus dem Signal-Ansatz
- 5.5.2 Ergebnisse aus den Probit- / Logit-Modellen
- 5.5.3 Eigene Ergebnisse aus einem Logit-Modell
- 5.6 Empirische Evidenz
- 5.7 Soziale Kosten der Falschprognose
- 6 SCHLUSSBEMERKUNGEN
- Anhang 1: Abbildungen und Tabellen
- Anhang 2: Darstellung der sozialen Kostenfunktion nach OBSTFELD
- Anhang 3: Verwendete Datenbasis
- LITERATURVERZEICHNIS
- VERZEICHNIS DER BENUTZTEN HILFSMITTEL
Häufig gestellte Fragen
Ab wann spricht man ökonomisch von einer Währungskrise?
Definitionen basieren oft auf einer massiven Abwertung des realen Wechselkurses oder einem Krisenindex (EMPI), der Wechselkurs, Reserven und Zinsen kombiniert.
Was sind Frühwarnindikatoren für Währungskrisen?
Dies sind ökonomische oder institutionelle Aggregate, die sich bereits vor dem Ausbruch einer Krise verschlechtern und somit eine Prognose ermöglichen.
Was unterscheidet Währungskrisenmodelle der 1., 2. und 3. Generation?
1. Generation: Inkonsistente Fiskalpolitik; 2. Generation: Selbst erfüllende Erwartungen; 3. Generation: Schwächen im Bankensektor und moral hazard (oft in Emerging Markets).
Was ist der „Signal-Ansatz“?
Eine Methode, bei der einzelne Indikatoren überwacht werden; überschreiten sie einen Schwellenwert, wird ein Warnsignal für eine potenzielle Krise ausgegeben.
Warum sind Emerging Markets besonders anfällig für Währungskrisen?
Aufgrund ihrer oft instabilen Finanzsysteme, Abhängigkeit von internationalem Kapital und strukturellen ökonomischen Defiziten sind Krisen dort häufiger und verheerender.
- Quote paper
- Marcel Hartmann (Author), 2006, Währungskrisen in Emerging Markets – Ansätze zur Krisenprognose mittels Frühwarnindikatoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83065