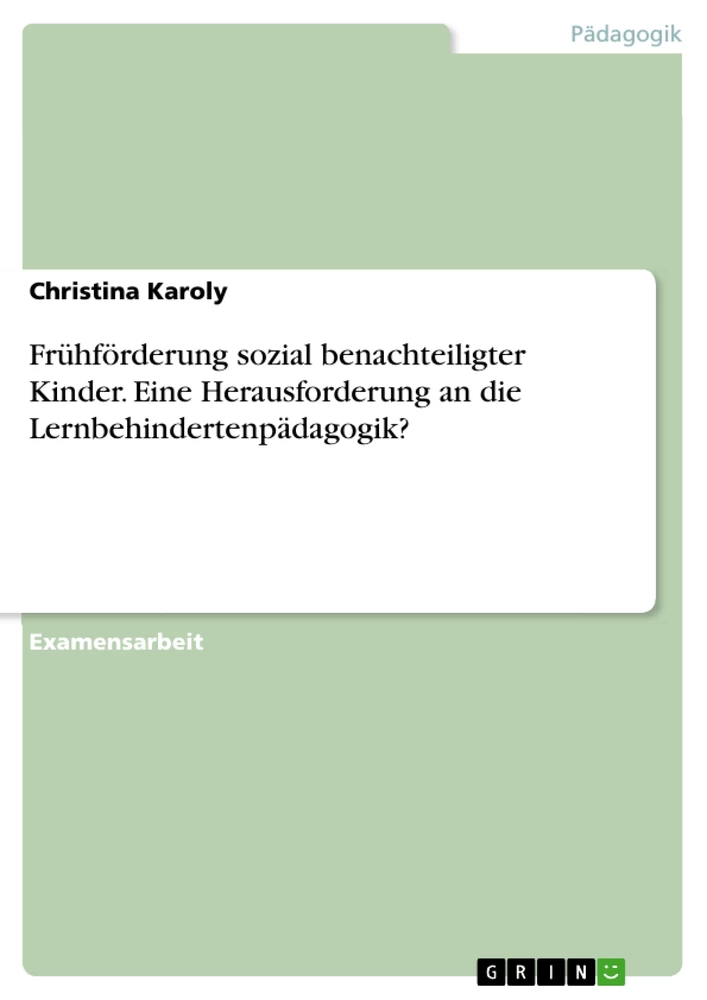Das gegenwärtige Bild der Bevölkerung in der Bundesrepublik ist unter anderem durch veränderte Sozialisationsbedingungen, den Wandel der Familienstrukturen, erhöhte soziale und ökonomische Risiken sowie den Abbau sozialstaatlicher Maßnahmen gekennzeichnet. Die Veränderung in den Familienstrukturen hat zur Folge, dass Familien heutzutage vielen Kindern nicht mehr dieselbe Konstanz wie zu früheren Zeiten bieten können. Soziale Gemeinschaften sind häufig charakterisiert durch Partnerschaftswechsel der Eltern, Patchworkfamilien, alleinerziehende Elternteile, die zudem den Lebensunterhalt verdienen müssen (Not zur Arbeit), niedriges Bildungsniveau der Eltern sowie Arbeitslosigkeit. All dies hat zu einem wachsenden Gefälle sozialer Schichten und einer Zunahme sozialer Benachteiligung mit zunehmenden Verarmungsprozessen geführt (vgl. 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005). Insbesondere Kinder, als schwächste Mitglieder der Gesellschaft sind hiervon betroffen, was sich insbesondere in einer Beeinträchtigung ihre Lebensbedingungen zeigt.
Die gesellschaftliche Realität wird daher mit einer steigenden Anzahl von Kindern konfrontiert werden, deren Lebenslagen von sozialer Gefährdung und Benachteiligung geprägt sind. Da der Zusammenhang von sozialer Benachteiligung bei Kindern und sonderpädagogischem Förderbedarf bereits ab den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wiederholt nachgewiesen worden ist, muss dieser Tatsache dringend Rechnung getragen werden (vgl. Weiß 1985, S.32). Bereits 1991 begründet Klein in seinem Artikel die Einführung der Frühförderung mit folgender Aussage: „Die Tatsache, dass behinderte Kinder häufiger aus sozial schwachen und randständigen Familien kommen als nichtbehinderte, war einer der maßgeblichen Gründe für die Einführung der Frühförderung“ (Klein 1991, S. 54).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktualität des Themas
- Fragestellung und Verlauf der Arbeit
- 1.0 Begriffsklärungen
- 1.1 Soziale Benachteiligung
- 1.2 Sonderpädagogischer Förderbedarf
- 1.3 Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und sonderpädagogischem Förderbedarf
- 1.4 Früherkennung und Frühförderung
- 2.0 Sozioökonomisch-soziokulturelle Bedingungen und Bildungschancen
- 2.1 Zusammenhang zwischen sozioökonomisch-soziokulturellen Bedingungen und Bildungschancen
- 2.2 Begründung der Prävention
- 2.3 Herausforderung an das System Frühförderung
- 2.4 Rechtliche Grundlagen der Frühförderung
- 3.0 Prävention - Früherkennung und interdisziplinäre Frühförderung
- 3.1 Früherkennung und Frühförderung als zwei Säulen der Prävention
- 3.1.1 Modell der Prävention
- 3.2 Elemente der Früherkennung
- 3.2.1 Medizinischer Bereich
- 3.2.2 Pädagogischer und psychologischer Bereich
- 3.3 Grundsätze, Aufgaben und Ziele der interdisziplinären Frühförderung
- 3.3.1 Inhaltliche Grundsätze der Frühförderung
- 3.3.2 Aufgaben und Ziele der interdisziplinären Frühförderung
- 4.0 Eltern und Erziehungsberechtigte in der Frühförderung
- 4.1 Elternarbeit und ihre Entwicklung
- 4.1.1 Das Laienmodell
- 4.1.2 Das Ko-Therapie-Modell
- 4.1.3 Das Kooperationsmodell
- 4.2 Bedeutung der Eltern/Erziehungsberechtigten für eine erfolgreiche Frühförderung
- 5.0 Wirkung der Prävention auf Kinder aus sozial benachteiligten Familien
- 5.1 Organisationsformen der Prävention
- 5.2 Zahl der geförderten Kinder – im Überblick
- 5.3 Interpretation der Daten
- Fazit - Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Frühförderung für sozial benachteiligte Kinder im Kontext der Lernbehindertenpädagogik. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen sozialer Benachteiligung auf die Entwicklung und Bildung von Kindern sowie die Rolle der Frühförderung bei der Prävention und Kompensation von Lern- und Entwicklungsstörungen. Der Fokus liegt dabei auf den Wechselwirkungen zwischen den sozioökonomisch-soziokulturellen Bedingungen, der frühkindlichen Förderung und der Entstehung von sonderpädagogischem Förderbedarf.
- Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und sonderpädagogischem Förderbedarf
- Früherkennung und Frühförderung als zentrale Elemente der Prävention
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Frühförderung
- Bedeutung der Eltern und Erziehungsberechtigten in der Frühförderung
- Wirkung der Prävention auf die Bildungschancen benachteiligter Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Aktualität des Themas und stellt die Fragestellung sowie den Aufbau der Arbeit vor. Das erste Kapitel widmet sich der Klärung grundlegender Begriffe, darunter soziale Benachteiligung, sonderpädagogischer Förderbedarf und der Zusammenhang zwischen diesen beiden. Zudem werden Früherkennung und Frühförderung im Kontext der Lernbehindertenpädagogik definiert. Im zweiten Kapitel wird der Zusammenhang zwischen sozioökonomisch-soziokulturellen Bedingungen und Bildungschancen untersucht. Die Bedeutung der Prävention für benachteiligte Kinder wird begründet, und die Herausforderungen der Frühförderung im Hinblick auf rechtliche Grundlagen und systemische Bedingungen werden beleuchtet. Kapitel drei beleuchtet das Konzept der Prävention mit Fokus auf Früherkennung und interdisziplinäre Frühförderung. Es werden Modelle der Prävention sowie Elemente der Früherkennung im medizinischen und pädagogisch-psychologischen Bereich dargestellt. Außerdem werden die Grundsätze, Aufgaben und Ziele der interdisziplinären Frühförderung ausführlich behandelt. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Eltern und Erziehungsberechtigten in der Frühförderung. Verschiedene Modelle der Elternarbeit werden vorgestellt, und es wird die Bedeutung der Elternbeteiligung für eine erfolgreiche Frühförderung betont.
Schlüsselwörter
Soziale Benachteiligung, Frühförderung, sonderpädagogischer Förderbedarf, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Elternarbeit, Prävention, Bildungschancen, sozioökonomisch-soziokulturelle Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen soziale Benachteiligung und sonderpädagogischer Förderbedarf zusammen?
Studien zeigen, dass Kinder aus sozial schwachen Familien häufiger einen sonderpädagogischen Förderbedarf entwickeln, da ihre Lebensbedingungen die frühe Entwicklung beeinträchtigen können.
Was sind die Ziele der interdisziplinären Frühförderung?
Ziel ist die Früherkennung und Kompensation von Entwicklungsverzögerungen durch die Zusammenarbeit von Medizinern, Pädagogen und Psychologen.
Welche Modelle der Elternarbeit gibt es in der Frühförderung?
Die Arbeit beschreibt das Laienmodell, das Ko-Therapie-Modell und das heute bevorzugte Kooperationsmodell zwischen Fachkräften und Eltern.
Welche sozioökonomischen Risiken gefährden die Bildungschancen von Kindern?
Arbeitslosigkeit der Eltern, niedriges Bildungsniveau, instabile Familienstrukturen und Armutsprozesse mindern die Bildungschancen erheblich.
Warum ist Prävention in der Lernbehindertenpädagogik so wichtig?
Frühzeitige Prävention kann verhindern, dass aus einer sozialen Benachteiligung eine dauerhafte Lernbehinderung oder ein massiver Förderbedarf entsteht.
- Citation du texte
- Christina Karoly (Auteur), 2007, Frühförderung sozial benachteiligter Kinder. Eine Herausforderung an die Lernbehindertenpädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83315