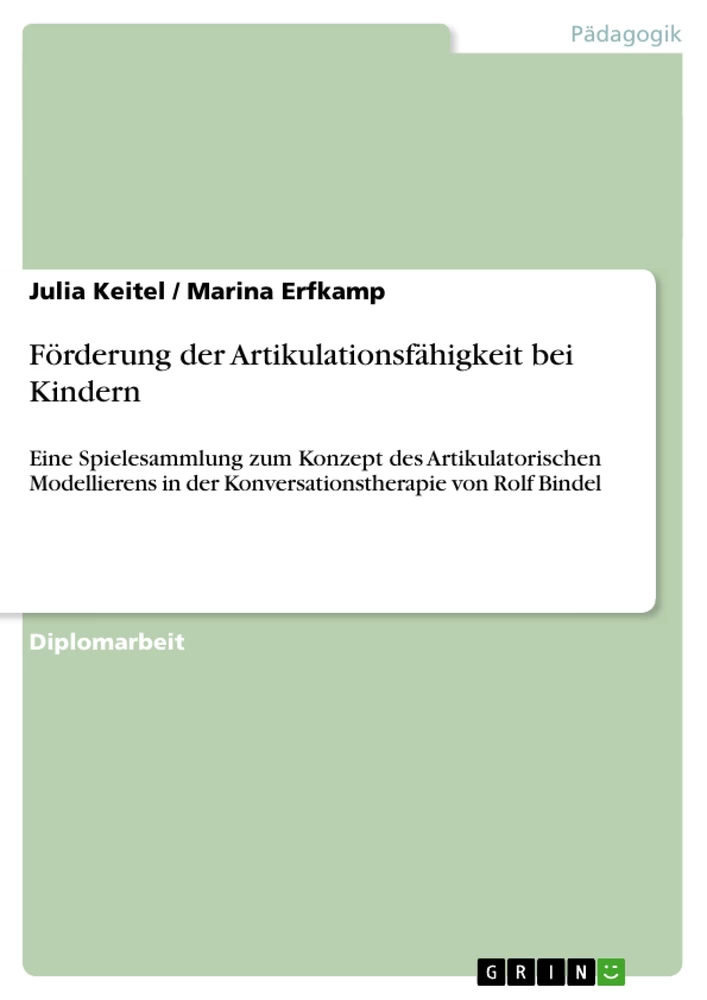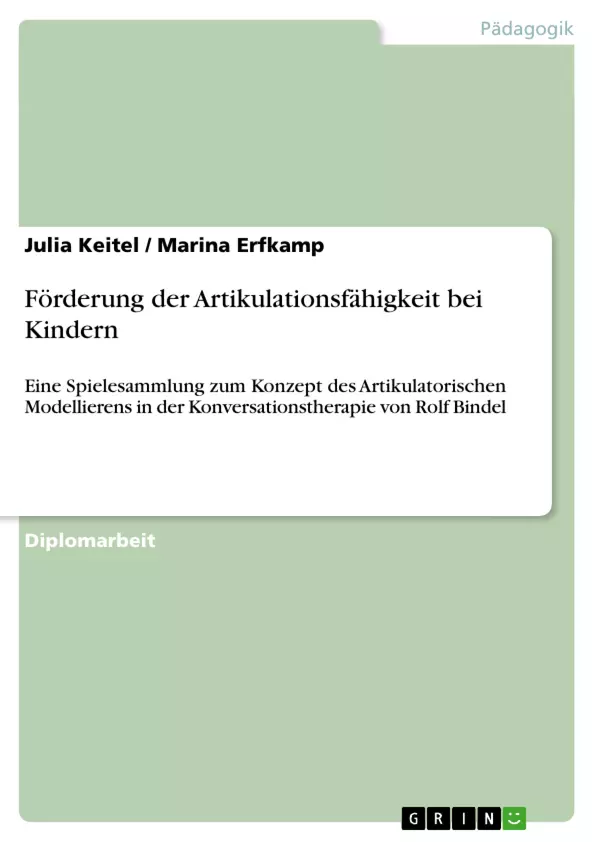Aufgrund des beträchtlichen Vorkommens von Artikulationsstörungen im sprachtherapeutischen Arbeitsalltag befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Artikulation als Störungsphänomen bei Kindern sowie der Förderung artikulatorischer Fähigkeiten. Bei genauerer Auseinandersetzung mit der Thematik zeigt sich eine große Vielfalt an Konzeptionen zur Erklärung des Phänomens, seiner Diagnose und Therapie. Aus dem Spektrum der unterschiedlichen Ansätze zur Förderung der Artikulationsfähigkeit wurde das Konzept »Artikulatorisches Modellieren in der Konversationstherapie« von Rolf Bindel zur näheren Betrachtung ausgewählt. Darüber hinaus erfolgt in Anlehnung an das Konzept von Bindel exemplarisch die Entwicklung einer Spielesammlung für die praktische Umsetzung.
Für das Verständnis der Thematik ist es aus Sicht der Autorinnen bedeutsam, im Rahmen der Kapitel 2 bis 4 zunächst die Grundlagen des Spracherwerbs sowie im Besonderen die Entwicklung der rezeptiven und produktiven Lautproduktion auszuführen.
Im sich anschließenden Kapitel erfolgen die detaillierte Darstellung des Konzeptes von Bindel sowie die kritische Abgrenzung gegenüber zwei ausgewählten Therapiekonzepten, um die Besonderheit der therapeutischen Maßnahme von Bindel hervorzuheben.
Aufgrund der Bedeutung des Spiels für die allgemeine Entwicklung des Kindes und darüber hinaus für den Spracherwerb und die Kommunikation erachten die Autorinnen in Bezug auf die entwickelte Spielesammlung eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Thematik Spiel als grundlegend. Dementsprechend wird im 6. Kapitel das Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt. Ebenso werden Formate und Spiel als wesentliche Elemente im Spracherwerb beschrieben und Konsequenzen für die Sprach- und Kommunikationsförderung gezogen.
Nach der theoretischen Abhandlung folgt in Kapitel 7 als Anregung für die Umsetzung des Konzeptes in der Sprachtherapie die Entwicklung einer Spielesammlung. Neben vielfältigen Spielebeschreibungen von zahlreichen Autoren, enthält die Spielesammlung des Weiteren Ideen aus der Praxiserfahrung der Autorinnen. Es schließt sich im 8. Kapitel eine Evaluation des Konzeptes und der Spielesammlung auf der Grundlage durchgeführter Interviews an. Durch ein abschließendes Fazit wird die Arbeit abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einleitende Aspekte zum Spracherwerb
- 2.1 Spracherwerbstheorien
- 2.2 Die sprachrelevanten Basisfähigkeiten
- 2.2.1 Sprachrelevante Operationen der sozialen Kognition
- 2.2.2 Sprachrelevante Operationen der Wahrnehmung
- 2.2.3 Sprachrelevante Operationen der Kognition
- 2.3 Die vier Bereiche des Spracherwerbs
- 2.3.1 Die Wortschatzentwicklung
- 2.3.2 Der Grammatikerwerb
- 2.3.3 Die Entwicklung der Kommunikation
- 2.3.4 Der Schriftspracherwerb
- 3. Die Entwicklung der Lautproduktion
- 3.1 Physiologischer Verlauf der allgemeinen Sprachentwicklung
- 3.1.1 Vorsprachliche Phase
- 3.1.1.1 Schreiperiode
- 3.1.1.2 Lallphase
- 3.1.2 Die sprachliche Phase
- 3.1.2.1 Einwortsätze
- 3.1.2.2 Zwei- und Mehrwortsätze
- 3.1.2.3 Frühgrammatische Phase
- 3.1.2.4 Morphosyntaktische Strukturierung
- 3.1.2.5 Annäherung an die Erwachsenensprache
- 3.1.1 Vorsprachliche Phase
- 3.2 Physiologischer Verlauf der Lautentwicklung
- 3.2.1 Zentrale Aspekte der Artikulation
- 3.2.1.1 Phonetik versus Phonologie
- 3.2.1.2 Grundelemente der Phonetik
- 3.2.1.3 Die Teilgebiete der Phonetik
- 3.2.1.4 Wesentliche Aspekte der Phonetik
- 3.2.1.5 Die Analyse von Vokalen und Konsonanten
- 3.2.1.6 Grundelemente der Phonologie
- 3.2.1.7 Das Phonem
- 3.2.1.8 Die Gewinnung des Phoneminventars
- 3.2.1.9 Phonotaktik
- 3.2.1.10 Phonologische Prozesse und Regeln
- 3.2.1 Zentrale Aspekte der Artikulation
- 3.3 Die Lautentwicklung
- 3.1 Physiologischer Verlauf der allgemeinen Sprachentwicklung
- 4. Störungen der Lautproduktion
- 4.1 Störungen der semantisch-lexikalischen Ebene
- 4.2 Störungen der syntaktisch-morphologischen Ebene
- 4.3 Störungen der pragmatisch-kommunikativen Ebene
- 4.4 Störungen der phonetisch-phonologischen Ebene
- 4.4.1 Phonetische Störungen
- 4.4.2 Phonologische Störungen
- 4.4.3 Mögliche Ursachen
- 4.4.3.1 Beeinträchtigungen bei der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen
- 4.4.3.2 Bewegungsstörungen der Artikulationsorgane
- 4.4.3.3 Erbanlagen und Einflüsse des familiären Umfelds
- 4.4.4 Auswirkungen einer Artikulationsstörung
- 5. Die Artikulationstherapie nach Rolf Bindel
- 5.1 Die Konversationstherapie
- 5.2 Artikulatorisches Modellieren in der Konversationstherapie von Rolf Bindel
- 5.2.1 Betrachtung der artikulatorischen Störung aus Bindels Sicht
- 5.2.2 Artikulatorisches Modellieren in der Konversationstherapie
- 5.2.2.1 Das Sprachganzheitsmodell von Bindel
- 5.2.2.2 Grundsätze der Therapie
- 5.2.2.3 Anforderungen an die Therapeutin
- 5.2.2.4 Bedeutung für das Klientel
- 5.2.2.5 Diagnostische Aspekte
- 5.2.2.6 Inhalte der Intervention
- 5.2.3 Zusammenfassung
- 5.3 Zwei ausgewählte Therapiekonzepte im Vergleich
- 5.3.1 Die Übungstherapie von Charles Van Riper und John V. Irwin
- 5.3.2 Die phonologische Therapie
- 6. Die Bedeutung des Spiels für den Spracherwerb und die Kommunikation
- 6.1 Das Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven
- 6.1.1 Die psychoanalytische Spieltheorie
- 6.1.2 Die Bedeutung des Spiels in der kognitiven Entwicklung
- 6.1.3 Der motivationspsychologische Ansatz
- 6.1.4 Abschließende Betrachtung bedeutender Aspekte des Kinderspiels
- 6.2 Der Spracherwerb unter Berücksichtigung von Formaten und Spiel
- 6.2.1 Gemeinsame Aspekte von Spiel und Sprache
- 6.2.2 Konsequenzen für die Sprach- und Kommunikationsförderung
- 6.2.2.1 Regelspiele
- 6.2.2.2 Konstruktionsspiele
- 6.2.2.3 Bewegungsspiele
- 6.2.2.4 Reim- und Rhythmusspiele
- 6.2.2.5 Darstellende Spiele
- 6.2.2.6 Kinderbücher als Spielmaterial
- 6.2.3 Abschließende Bemerkung
- 6.1 Das Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven
- 7. Die Spielesammlung
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Inhaltsverzeichnis der Spielesammlung
- 7.2.1 Regelspiele
- 7.2.2 Konstruktionsspiele
- 7.2.3 Bewegungsspiele
- 7.2.4 Reim- und Rhythmusspiele
- 7.2.5 Darstellende Spiele
- 7.2.6 Bilderbücher als Spielmaterial
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Förderung der Artikulationsfähigkeit bei Kindern. Ziel ist es, eine Spielesammlung zu entwickeln, die das Konzept des Artikulatorischen Modellierens in der Konversationstherapie von Rolf Bindel umsetzt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Spracherwerbs, der Entwicklung der Lautproduktion und von Störungen der Lautproduktion.
- Spracherwerbstheorien und sprachrelevante Basisfähigkeiten
- Die Entwicklung der Lautproduktion und die physiologischen Prozesse
- Störungen der Lautproduktion und deren Ursachen
- Die Artikulationstherapie nach Rolf Bindel und das Konzept des Artikulatorischen Modellierens
- Die Bedeutung des Spiels für den Spracherwerb und die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Förderung der Artikulationsfähigkeit bei Kindern. Zudem werden die Forschungsfragen und die Methode der Arbeit vorgestellt.
- Kapitel 2: Einleitende Aspekte zum Spracherwerb
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien zum Spracherwerb und untersucht die sprachrelevanten Basisfähigkeiten, die für den Spracherwerb entscheidend sind.
- Kapitel 3: Die Entwicklung der Lautproduktion
Kapitel 3 beschreibt den physiologischen Verlauf der allgemeinen Sprachentwicklung und die Entwicklung der Lautproduktion. Es werden wichtige Aspekte der Phonetik und Phonologie erläutert.
- Kapitel 4: Störungen der Lautproduktion
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Störungen der Lautproduktion, die auf unterschiedlichen Ebenen auftreten können. Es werden mögliche Ursachen und Auswirkungen von Artikulationsstörungen betrachtet.
- Kapitel 5: Die Artikulationstherapie nach Rolf Bindel
Kapitel 5 stellt die Konversationstherapie von Rolf Bindel vor und erläutert das Konzept des Artikulatorischen Modellierens. Es werden die Grundsätze der Therapie, Anforderungen an die Therapeutin und die Bedeutung für das Klientel beschrieben.
- Kapitel 6: Die Bedeutung des Spiels für den Spracherwerb und die Kommunikation
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Spiels für den Spracherwerb und die Kommunikation. Es werden verschiedene Theorien zum Spiel und deren Bedeutung für die kognitive Entwicklung betrachtet.
Schlüsselwörter
Artikulationsfähigkeit, Spracherwerb, Lautproduktion, Artikulationsstörungen, Konversationstherapie, Artikulatorisches Modellieren, Spiel, Sprachförderung, Kommunikation, Kinder
- Quote paper
- Julia Keitel (Author), Marina Erfkamp (Author), 2007, Förderung der Artikulationsfähigkeit bei Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83381