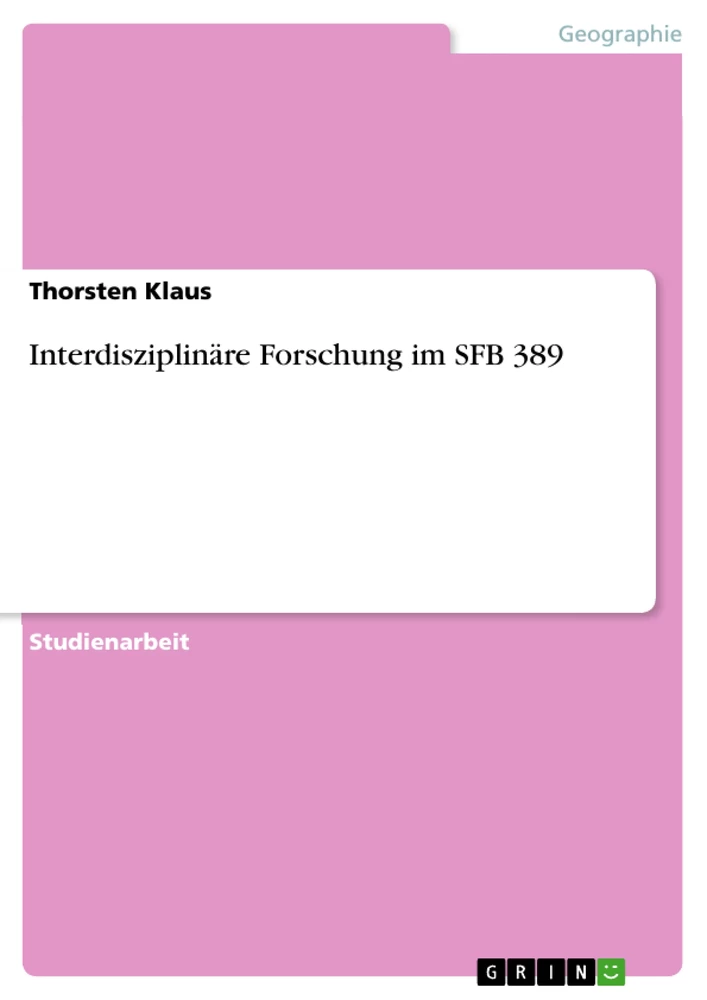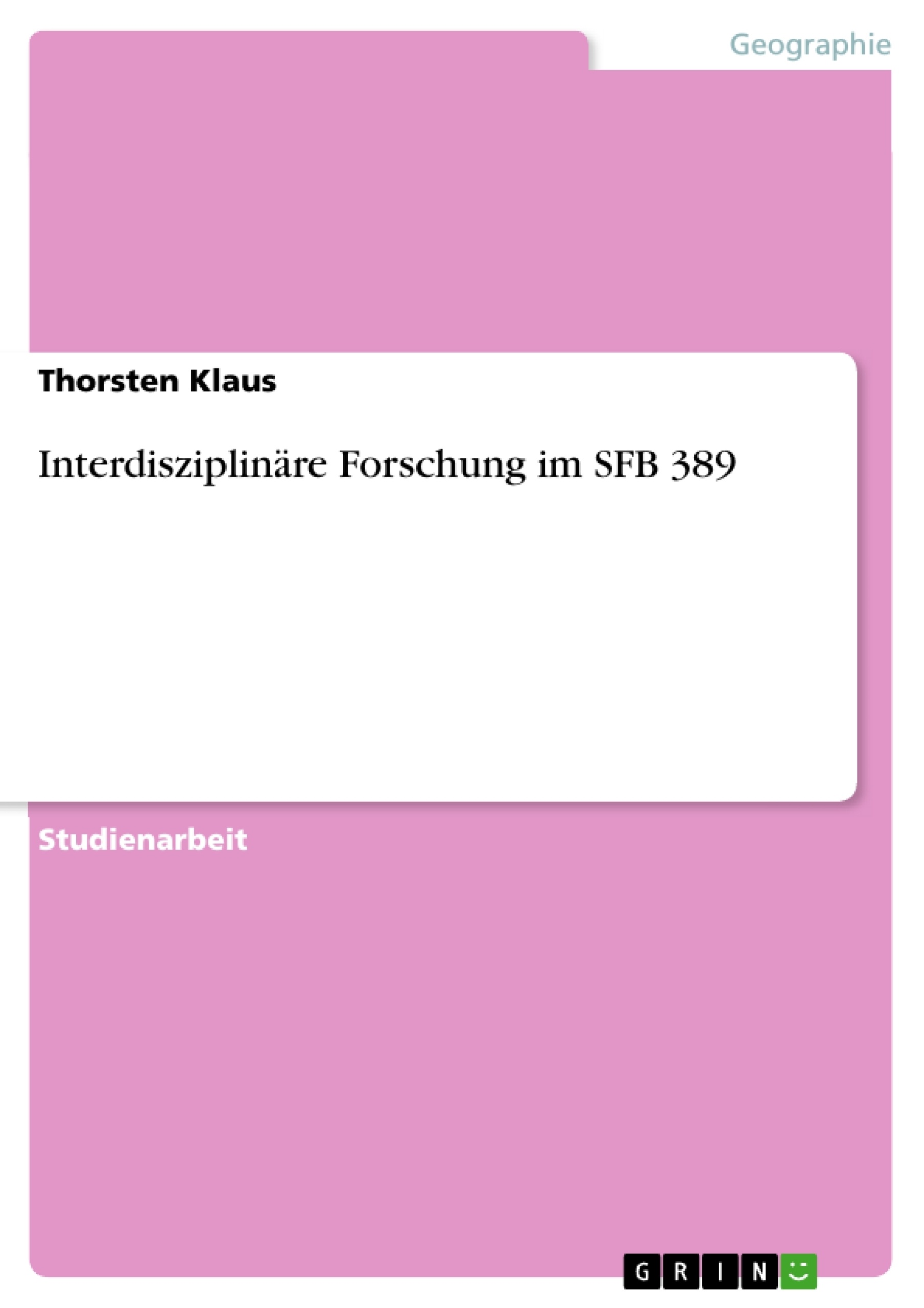Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 389 an der Universität zu Köln zum Thema „Kultur und Landschaftswandel im ariden Afrika“ untersuchen verschiedene Disziplinen gemeinsam im nordöstlichen und südwestlichen Afrika, „wie der Mensch während der letzten 12.000 Jahre Wirtschaftsweise und Lebensformen den ökologischen Grenzbedingungen der Wüsten und Halbwüsten Afrikas angepasst hat, wie er sich mit ihnen auseinandersetzt, sie seinerseits beeinflusst und welche Überlebensstrategien er in diesen Regionen bis heute entwickelt hat“ (KRÖPELIN & KUPER 2007: 28). Die um 5.000 v. u. Z. einsetzende Austrocknung des Sahararaumes wird als „Motor der Geschichte Afrikas“ (ebd.) gesehen, wodurch sich die heutige Verteilung der Völker, Sprachen und Kulturen Afrikas erklären lässt. Die interdisziplinäre Forschung ermöglicht die „vergleichende Auswertung archäologischer, geowissenschaftlicher, zoologischer und botanischer Quellen“ (ebd.) mit dem Ziel, ein möglichst umfassendes Bild der klima- und kulturwissenschaftlichen Entwicklung zu zeichnen. Interdisziplinär impliziert, dass nur die gemeinsame Forschung der verschiedenen Disziplinen zu den hier vorgestellten Ergebnissen kommen kann, nicht jede Disziplin für sich allein genommen.
Ziel dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, ob der SFB 389 tatsächlich ein interdisziplinäres Vorhaben ist, oder ob beispielsweise auch eine multidisziplinäre Vorgehensweise, d.h. ein reines Nebeneinader, aber kein Miteinander der Disziplinen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre. Bringt nur die Synthese der in den einzelnen Disziplinen erbrachten Forschungsergebnisse das Resultat einer möglichst umfassenden Gesamtdarstellung oder wäre beispielsweise die Geographie in der Lage die Forschungsergebnisse auch alleine zu erbringen?
Im Folgenden sollen - nach einer einführenden Gesamtübersicht über den SFB 389 - ausgewählte Forschungsergebnisse näher vorgestellt werden. Anschließend folgt eine eigene Einschätzung über die Aspekte der Interdisziplinarität im SFB 389.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Der Sonderforschungsbereich 389
- Teilprojekt A1 – Regionale Klimaentwicklung und menschliche Besiedlung zwischen Niltal und Zentralsahara
- Teilprojekt A5 – Landschaftsbild und Landschaftswandel im nordöstlichen Afrika: Der Modellfall Ägypten
- Teilprojekt E3 – Wege und Handel in ariden Zonen
- Der Erfolg des Alten Ägypten
- Landschaft und Ökonomie
- Siedlungen und Logistik
- Djara – Menschen und ihre Umwelt auf dem Ägyptischen Kalksteinplateau vor ca. 8.000 Jahren
- Klima und Vegetation
- Hydrologie
- Siedlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Sonderforschungsbereich 389 (SFB 389) an der Universität zu Köln untersucht die Anpassung des Menschen an die ökologischen Grenzbedingungen der Wüsten und Halbwüsten Afrikas während der letzten 12.000 Jahre. Im Fokus stehen die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt, die "historische Tiefe spezifischer Interaktionsmuster" und die Entwicklung von Überlebensstrategien in ariden Zonen. Die interdisziplinäre Forschung soll ein umfassendes Bild der klima- und kulturwissenschaftlichen Entwicklung zeichnen. Diese Arbeit hinterfragt, ob der SFB 389 tatsächlich ein interdisziplinäres Vorhaben ist oder ob eine multidisziplinäre Vorgehensweise zu ähnlichen Ergebnissen geführt hätte.
- Anpassungsstrategien des Menschen an die ökologischen Herausforderungen der Wüsten und Halbwüsten Afrikas
- Die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt in ariden Zonen
- Der Einfluss von klimatischen Veränderungen auf Kultur und Lebensformen
- Die Bedeutung interdisziplinärer Forschung für die Erforschung der Mensch-Umwelt-Beziehungen
- Die Rolle der Geographie im interdisziplinären Forschungsprojekt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung zum SFB 389 und seiner Forschungsarbeit. Im zweiten Kapitel wird der Sonderforschungsbereich 389 vorgestellt und seine interdisziplinäre Ausrichtung mit den beteiligten Fachrichtungen und den Forschungsbereichen beleuchtet. Die Teilprojekte A1, A5 und E3, die sich speziell mit Ägypten befassen, werden kurz erläutert. Das dritte Kapitel behandelt den Erfolg des Alten Ägypten und dessen ökonomische Leistungsfähigkeit, die auf die Nutzung des Niltals und seiner verschiedenen Landschaftsbereiche basiert. Dabei werden die wirtschaftlichen Aktivitäten im Niltal und die logistische Infrastruktur der Siedlungen dargestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit der Region Djara auf dem Ägyptischen Kalksteinplateau vor etwa 8.000 Jahren. Hier werden die damaligen Umweltbedingungen, wie Klima und Vegetation, sowie die Nutzung des Raumes durch prähistorische Menschen rekonstruiert. Die Untersuchung der hydrologischen Verhältnisse und die Rekonstruktion der Siedlungsweisen und Mobilität der Menschen geben Einblicke in die Lebensbedingungen der damaligen Zeit. Das letzte Kapitel zieht ein Fazit über die Bedeutung der interdisziplinären Forschung im SFB 389 und stellt die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kultur und Landschaftswandel im ariden Afrika. Wichtige Schlüsselwörter sind Interdisziplinarität, Umweltbedingungen, Anpassungsstrategien, Wüsten und Halbwüsten, Klimawandel, Besiedlungsgeschichte, Ökonomie, Landschaft, Niltal, Djara, Geographie, Archäologie, Ägyptologie und Paläobotanik.
Häufig gestellte Fragen
Was erforscht der Sonderforschungsbereich (SFB) 389?
Der SFB 389 untersucht den Kultur- und Landschaftswandel im ariden Afrika und wie der Mensch seine Lebensweise seit 12.000 Jahren an Wüstenbedingungen angepasst hat.
Warum ist Interdisziplinarität in diesem Projekt so wichtig?
Nur durch die Synthese von Archäologie, Geowissenschaften, Botanik und Zoologie lässt sich ein umfassendes Bild der Klima- und Kulturentwicklung zeichnen.
Was war der „Motor der Geschichte Afrikas“ laut SFB 389?
Die um 5.000 v. u. Z. einsetzende Austrocknung der Sahara gilt als zentraler Motor, der die Verteilung von Völkern und Sprachen prägte.
Welche Erkenntnisse gibt es zur Region Djara?
Forschungen rekonstruierten dort das Klima und die Siedlungsweisen prähistorischer Menschen auf dem ägyptischen Kalksteinplateau vor ca. 8.000 Jahren.
Hätte Geographie allein diese Ergebnisse erzielen können?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch und kommt zum Schluss, dass erst das Miteinander (Interdisziplinarität) statt eines reinen Nebeneinanders (Multidisziplinarität) den Erfolg ausmacht.
- Citar trabajo
- Thorsten Klaus (Autor), 2007, Interdisziplinäre Forschung im SFB 389, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83452