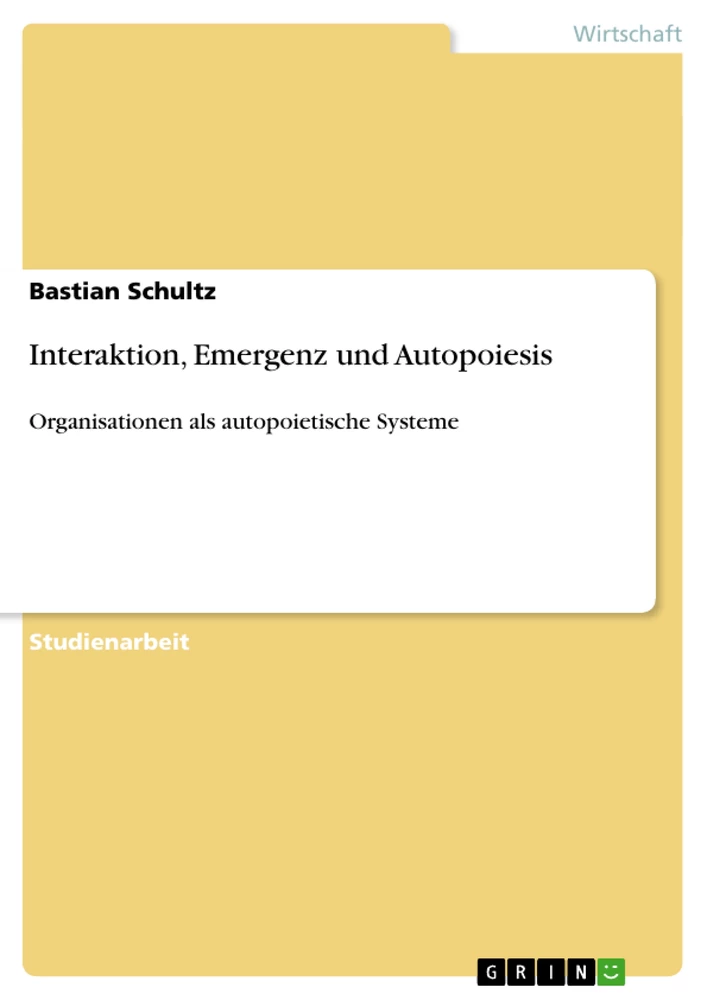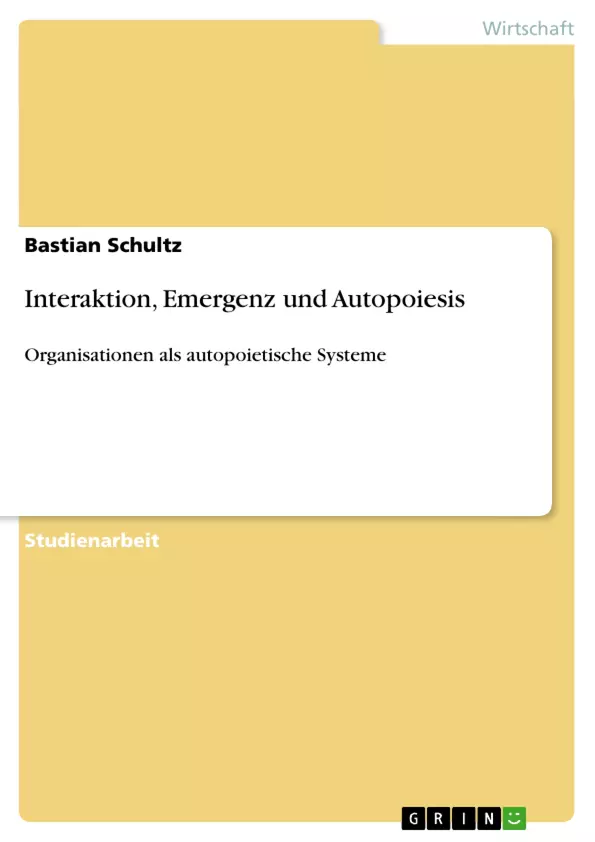„Unternehmungen lassen sich, so die These , nicht einfach als Resultat intendierter menschlicher Handlungen begreifen; dazu sind sie zu komplex“
Der Komplexität gerecht zu werden ist das Ziel der systemtheoretischen Betrachtung von Unternehmen als lebensfähige, selbst organisierende Systeme. Kann man aber eine Unternehmung einem Lebewesen gleichsetzen? In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob eine solche Betrachtung gerechtfertigt ist und welche Konsequenzen sich daraus für den Umgang in und mit solchen Systemen ergeben. Hierzu wird im fünften Kapitel das Konzept der Autopoiesis näher erläutert und die Übertragungen auf Organisationen kritisch betrachtet.
Zunächst wird jedoch mit den Grundlagen dynamischer Entscheidungen sowie einer Einführung in die Themengebiete der Interaktion und der Emergenz begonnen, da diese wichtige Grundlagen für das Verständnis eines autopoietischen Systems bilden.
Die Relevanz der betrachteten Aspekte eröffnet sich im Vergleich mit der Vorgehensweise der klassischen Entscheidungstheorie, welche in der Regel in sich abgeschlossene Modelle betrachtet, in denen anhand von einigen Kriterien gegebene Alternativen bewertet werden. Dynamische Problemstellungen, also solche, bei denen eine temporale Komponente eine Rolle spielt, werden dann meist auf einfache statische Probleme zurückgeführt, indem eine optimale Strategie für die zeitliche Abfolge festgelegt wird.
Diese Reduktion wird jedoch der Komplexität einer dynamischen Umgebung nicht ganz gerecht. Die Kenntnis der nachfolgend beleuchteten Phänomene ermöglicht es, solche Modelle kritisch im Hinblick auf die ausreichende Erfassung der Komplexität zu durchleuchten und dadurch falsche Schlüsse aus erzielten Wirkungen der getroffenen Entscheidungen zu verhindern. So kommt es vor, dass Erfolge trotz sorgfältig ausgearbeiteter Vorgehensweise nicht eintreten und dann die Vorgehensweise als falsch betrachtet wird, obwohl die tatsächliche Ursache wie im Laufe der Arbeit zu erkennen ist, oft tiefer, nämlich in der Emergenz von Entscheidungen oder in der Resistenz des autopoietischen Systems liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dynamische Entscheidungen
- Interaktion
- Emergenz
- Phänomenbeschreibung
- Beispiel: „Life“ nach J.H. Conway
- Einführung und Spielregeln
- Einige interessante Anfangszustände und deren Entwicklung
- Schlussfolgerungen und Implikationen
- Autopoiesis
- Erläuterung des biologischen Grundkonzeptes
- Übertragung in die Soziologie
- Übertragung auf Organisationen
- Einwirken auf ein autopoietisches System
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Unternehmen als selbstorganisierende Systeme mit dem Fokus auf das Konzept der Autopoiesis. Sie untersucht, ob eine solche Betrachtungsweise gerechtfertigt ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Organisation und den Umgang mit diesen Systemen ergeben.
- Dynamische Entscheidungen
- Interaktion und Emergenz
- Autopoiesis und ihre Übertragung auf Organisationen
- Kritik und Reflexion der Autopoiesis-Theorie
- Relevanz der systemtheoretischen Perspektive für die Entscheidungsfindung in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die These vor, dass Unternehmen nicht als bloße Resultate menschlicher Handlungen betrachtet werden können, sondern als komplexe, selbstorganisierende Systeme. Sie setzt die Systemtheorie als Analyseinstrument ein und beleuchtet die Relevanz dynamischer Entscheidungen, Interaktion und Emergenz für das Verständnis autopoietischer Systeme.
- Dynamische Entscheidungen: Dieses Kapitel behandelt die Besonderheiten dynamischer Entscheidungsprozesse im Vergleich zu statischen Modellen. Es erklärt, wie sich zeitliche Komponenten auf Entscheidungsprozesse auswirken und wie diese mit Differenzengleichungen formuliert werden können.
- Interaktion: Hier wird der Begriff der Interaktion im Kontext von dynamischen Beziehungen erläutert. Es wird gezeigt, wie die Einwirkung von Variablen aufeinander die Komplexität eines Systems erhöht und ein Gleichungssystem zur Darstellung dieser Beziehungen erforderlich macht. Anhand eines Beispiels aus der Zinsrechnung wird die Funktionsweise von Interaktion verdeutlicht.
- Emergenz: Dieses Kapitel behandelt das Phänomen der Emergenz, bei dem sich neue Eigenschaften und Muster aus dem Zusammenspiel einzelner Elemente eines Systems entwickeln. Das Spiel "Life" von J.H. Conway dient als Beispiel, um die Entstehung komplexer Strukturen aus einfachen Regeln zu veranschaulichen.
- Autopoiesis: Im fünften Kapitel wird das Konzept der Autopoiesis vorgestellt. Es beschreibt die Selbstproduktion und -erhaltung von Lebewesen und wird anschließend auf Organisationen übertragen. Die Übertragung auf Organisationen wird kritisch hinterfragt und die Bedeutung des Autopoiesis-Konzeptes für das Verständnis von Organisationsprozessen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Konzepten der Systemtheorie, insbesondere der Autopoiesis, und ihrer Anwendung auf die Analyse von Unternehmen. Hierbei spielen dynamische Entscheidungen, Interaktion, Emergenz und die Komplexität von Systemen eine wichtige Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Autopoiesis im Kontext von Unternehmen?
Autopoiesis beschreibt Unternehmen als lebensfähige, selbstorganisierende Systeme, die sich selbst produzieren und erhalten, ähnlich wie biologische Organismen.
Was ist das Phänomen der Emergenz?
Emergenz bezeichnet die Entstehung neuer Eigenschaften oder Muster in einem System, die nicht allein aus den Eigenschaften der einzelnen Teile erklärbar sind.
Wie unterscheidet sich die Systemtheorie von der klassischen Entscheidungstheorie?
Die klassische Theorie nutzt oft statische Modelle. Die Systemtheorie hingegen berücksichtigt die Komplexität und Dynamik sowie die Resistenz autopoietischer Systeme.
Was zeigt das Spiel "Life" von J.H. Conway?
Es dient als Beispiel für Emergenz: Aus sehr einfachen Regeln entstehen komplexe, unvorhersehbare Strukturen und Verhaltensweisen.
Kann man auf ein autopoietisches System direkt einwirken?
Direkte Eingriffe sind schwierig, da das System nach eigenen Regeln operiert. Veränderungen scheitern oft an der inneren Resistenz des Systems.
Was sind dynamische Entscheidungen?
Entscheidungen, bei denen eine zeitliche Komponente (temporale Komponente) eine Rolle spielt und die Auswirkungen einer Handlung die zukünftigen Optionen beeinflussen.
- Citation du texte
- Bastian Schultz (Auteur), 2007, Interaktion, Emergenz und Autopoiesis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83456