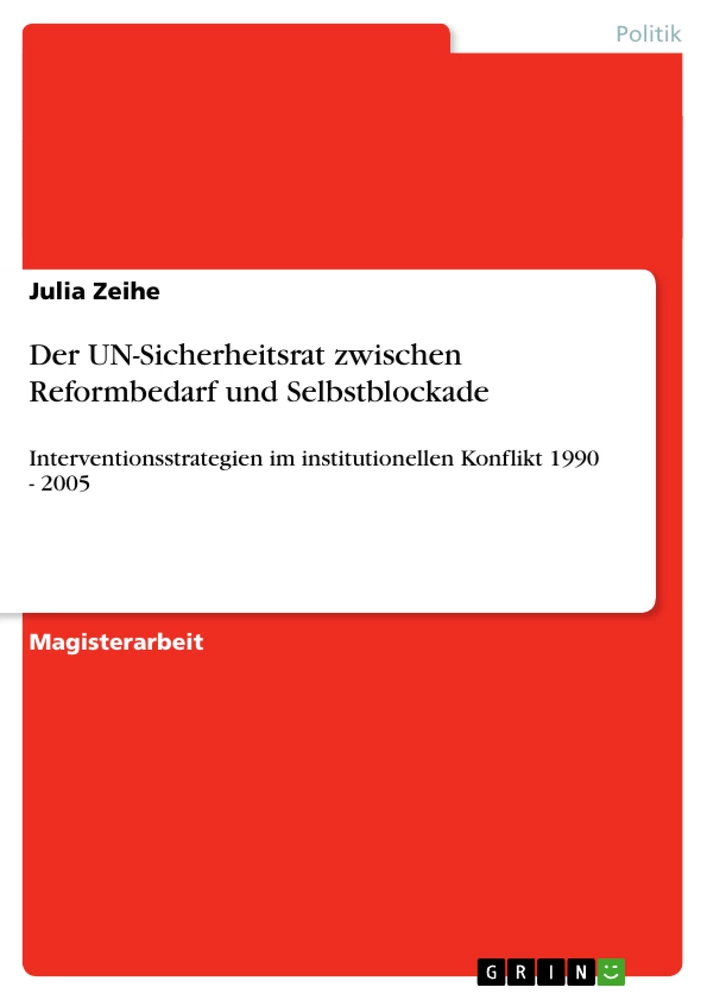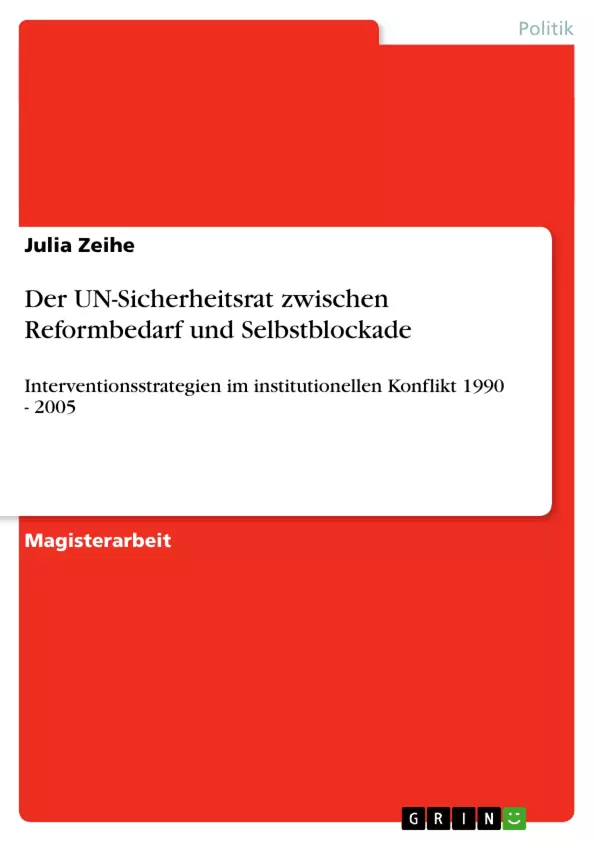Vor fast genau zwei Jahren jährte sich der 60. Jahrestag einer Internationalen Organisation, die über sechs Dekaden Höhen und Tiefen erlebte wie keine andere. Viele Hoffnungen lagen auf der Staatengemeinschaft, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges für eine Sicherung des Weltfriedens stehen sollte. Der Grundstein für die Schaffung des Jubilars, die Vereinten Nationen, wurde auf der Außenministerkonferenz in Moskau im Oktober 1943 gelegt. Gemeinschaftlich erklärten die vier Mächte China, Großbritannien, die Sowjetunion und Amerika in ihrer Abschlusserklärung: „(t)hat they recognize the necessity of establishing at the earliest practicable date a general international organisation, based on the principle of the sovereign equality of all peace-loving states, and open to membership by all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security” . Bis zu der Konferenz von Dumbarton Oaks, die zwischen dem 21.08. und 09.10.1944 statt fand, arbeiteten federführend die Amerikaner an einem Entwurf für die Staatengemeinschaft, in der im Mittelpunkt ein „Executive Council“ für die Entscheidungsfindung innerhalb der Weltorganisation stehen sollte. Dieses „outline paper“ bildete die Basis für ein erstes Statutenkonzept. Die Idee eines Sicherheitsrats war geboren, der sich nach der Gründung der Vereinten Nationen 1945 als Hauptorgan für die Wahrung des Weltfriedens und somit zum wesentlichsten Organ innerhalb der Staatengemeinschaft manifestierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Fragestellung
- Forschungsstand
- UN-Sicherheitsrat (1945 - 2005)
- Zusammensetzung und Arbeitsweise
- Aufgaben und Instrumente der Konfliktbearbeitung des UN-Sicherheitsrats
- Problematik des Vetorechts
- Instrumente des Kalten Krieges (1945-1954)
- Umorientierung nach der Blockauflösung (1989-2003)
- Das Allgemeine Gewaltverbot als Grundnorm zur Beseitigung des Krieges in den Internationalen Beziehungen
- Die Entwicklung des Allgemeinen Gewaltverbots
- Ausnahmen des Allgemeinen Gewaltverbots
- Selbstverteidigung
- Kapitel VII der UN-Charta
- Rettung eigener Staatsangehöriger
- Humanitäre Intervention
- Der Kosovo Krieg – das Scheitern der internationalen Staatengemeinschaft vor Kriegsausbruch
- Krisenherd Balkan: Vorgeschichte eines unaufhörlichen Konflikts
- Reaktion der Vereinten Nationen
- Die Selbstblockade des Sicherheitsrats
- Der Nato-Einsatz ohne UN-Mandat
- Gerechtfertigte Intervention?
- Zwischenfazit: Der Kosovo-Konflikt für den UN-Sicherheitsrat
- Der dritte Irak-Krieg - Sieg des Unilateralismus der USA?
- Vorgeschichte des Irakkrieges
- Der Zweite Golfkrieg
- Die UN-Resolution 678 - Rechtfertigung für jeglichen militärischen Einsatz?
- Folgen des Zweiten Golfkrieges
- Die Zuspitzung des Irak-Konflikts ab 2001 – Amerikas Irakpolitik
- 9/11 Auslöser für einen Krieg gegen den Terror
- Die Bush-Doktrin - Neue Nationale Sicherheitsstrategie
- Reaktion der UNO auf den Terroranschlag in New York
- Die Reaktion der Vereinten Nationen - Die Resolution 1441 zähes Ringen um eine Entscheidung
- Großbritannien - transatlantischer Vermittlungspartner
- Die USA als Initiator für einen Krieg
- Das „alte Europa“ und sein Unwillen
- Frankreich - Bestrebungen nach einer Führungsposition
- Russland - Handeln aus ökonomischen und traditionellen Gründen
- China Stratege in der internationalen Politik
- Deutschland ein eigener Weg
- Das „neue Europa“ – Ost- und Mitteleuropa
- Uneinigkeit im Sicherheitsrat und der Einmarsch in den Irak
- Uniting for Peace – ungenützte Möglichkeit?
- Völkerrechtliche Problematik
- Zwischenfazit: Der Irakkrieg für den UN-Sicherheitsrat
- Reformversuche des UN-Sicherheitsrats (1992-2005)
- Ausgangslage - vom Razali-Plan bis zur Reformdebatte 2003
- Neue Dynamik im Vorfeld des Gipfeltreffens anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen
- Die Hochrangige Gruppe und der Bericht „Eine sichere Welt: Unsere gemeinsame Zukunft“
- Bericht des Generalsekretärs „In größter Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Menschrechte“
- Die Gruppe der G4 – für eine Erweiterung ständiger Mitglieder
- Die Gruppe vereint im Konsens – die reformhemmenden Maßnahmen des Coffee - Clubs
- Die Gruppe der Afrikanischen Union - gleiche Privilegien für neue Mitglieder
- Stagnation der Reform des UN-Sicherheitsrats
- Hohe Hürde - Vetorecht und Änderung der Charta
- Reform vertagt – keine Lösung absehbar
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Funktionsweise des UN-Sicherheitsrats im Kontext von internationalen Konflikten und beleuchtet dessen Reformbedürftigkeit. Dabei wird die Frage untersucht, warum der Sicherheitsrat in den letzten Jahrzehnten häufig nicht in der Lage war, angemessen auf Krisen zu reagieren.
- Analyse der Zusammensetzung und Arbeitsweise des UN-Sicherheitsrats
- Bedeutung des Vetorechts und dessen Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat
- Untersuchung des Allgemeinen Gewaltverbots als Grundnorm des Völkerrechts und dessen Ausnahmen
- Fallstudien: Der Kosovo-Krieg und der Irakkrieg 2003/04, um die Reaktion des UN-Sicherheitsrats in spezifischen Konflikten zu analysieren
- Bewertung von Reformversuchen des UN-Sicherheitsrats in den vergangenen Jahrzehnten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Magisterarbeit vor und definiert die Forschungsfrage. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Gründung der Vereinten Nationen und die Entwicklung des UN-Sicherheitsrats. Außerdem wird die Reformbedürftigkeit des Sicherheitsrats im Kontext der letzten Jahrzehnte herausgestellt.
- UN-Sicherheitsrat (1945-2005): Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Sicherheitsrats. Es werden seine Aufgaben und die Instrumente zur Konfliktbearbeitung erläutert.
- Problematik des Vetorechts: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Vetorechts für die Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat. Es wird sowohl die historische Entwicklung als auch die aktuelle Rolle des Vetos beleuchtet.
- Das Allgemeine Gewaltverbot als Grundnorm zur Beseitigung des Krieges in den Internationalen Beziehungen: Das Kapitel analysiert die Entwicklung und die Ausnahmen des Allgemeinen Gewaltverbots als Grundnorm des Völkerrechts.
- Der Kosovo Krieg – das Scheitern der internationalen Staatengemeinschaft vor Kriegsausbruch: Dieses Kapitel analysiert den Kosovo-Krieg im Kontext der Reaktion des UN-Sicherheitsrats. Es werden die Vorgeschichte des Konflikts, die Selbstblockade des Sicherheitsrats und die Intervention der NATO ohne UN-Mandat untersucht.
- Der dritte Irak-Krieg - Sieg des Unilateralismus der USA?: Dieses Kapitel widmet sich dem Irakkrieg 2003/04 und analysiert die Reaktion des Sicherheitsrats auf die Eskalation des Konflikts. Es beleuchtet die Vorgeschichte des Krieges, die Rolle der USA und der UN-Resolution 1441.
- Reformversuche des UN-Sicherheitsrats (1992-2005): Das Kapitel analysiert die Reformversuche des UN-Sicherheitsrats in den letzten Jahrzehnten. Es werden die wichtigsten Reforminitiativen, wie der Razali-Plan und die „Hochrangige Gruppe“, vorgestellt und deren Erfolge und Misserfolge diskutiert.
- Stagnation der Reform des UN-Sicherheitsrats: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen für die Stagnation der Reform des UN-Sicherheitsrats. Es analysiert die Hindernisse wie das Vetorecht und die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind UN-Sicherheitsrat, Reform, Vetorecht, internationales Gewaltverbot, Kosovo-Krieg, Irakkrieg, Konfliktsituation, internationale Staatengemeinschaft, Machtpolitik, institutionelle Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt der UN-Sicherheitsrat als reformbedürftig?
Der Sicherheitsrat leidet oft unter einer "Selbstblockade", insbesondere durch das Vetorecht der ständigen Mitglieder, was schnelles Handeln in Krisen verhindert.
Welche Rolle spielte das Vetorecht im Kalten Krieg?
Es wurde als Instrument der Machtpolitik genutzt, um Entscheidungen der Gegenseite zu blockieren, was die Handlungsfähigkeit der UN massiv einschränkte.
Was wird am Beispiel des Kosovo-Krieges analysiert?
Die Arbeit untersucht das Scheitern der Staatengemeinschaft und den Nato-Einsatz ohne UN-Mandat aufgrund der Blockade im Sicherheitsrat.
Welche Bedeutung hat die UN-Resolution 1441 für den Irakkrieg?
Die Resolution war das Ergebnis eines zähen Ringens im Sicherheitsrat und wurde von den USA als Rechtfertigung für den Einmarsch genutzt, was völkerrechtlich höchst umstritten blieb.
Welche Reforminitiativen werden in der Arbeit genannt?
Es werden unter anderem der Razali-Plan, die G4-Gruppe (für mehr ständige Mitglieder) und der Coffee-Club (reformhemmende Maßnahmen) diskutiert.
- Quote paper
- Julia Zeihe (Author), 2007, Der UN-Sicherheitsrat zwischen Reformbedarf und Selbstblockade, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83599