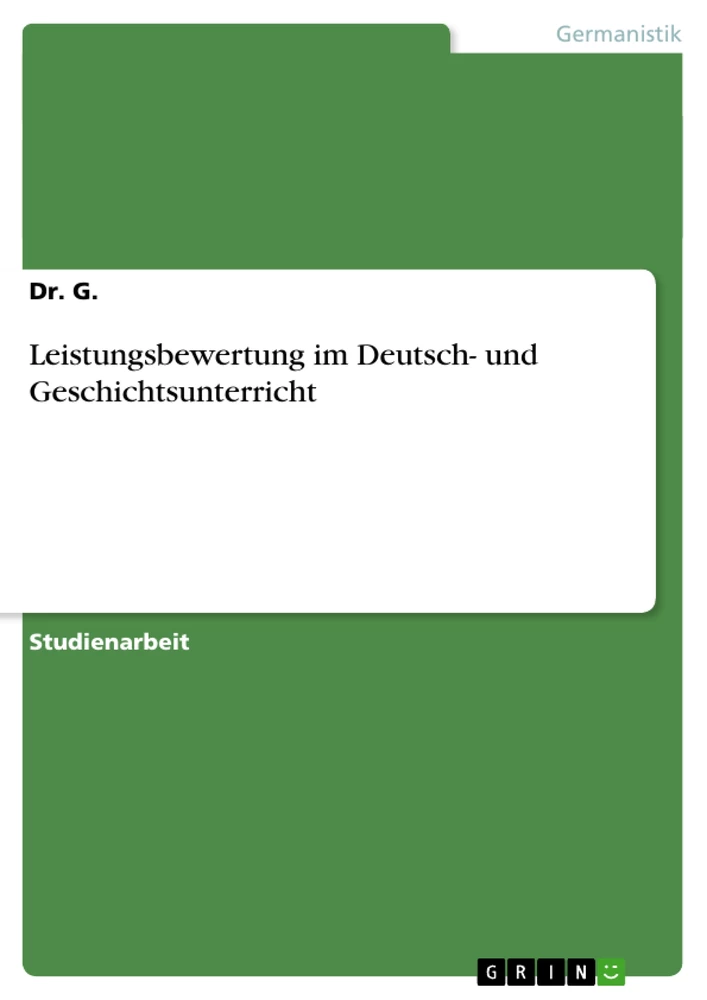Innerhalb einer immer öfter als ‚Leistungsgesellschaft’ deklarierten Umwelt sind auch die Schulen gemäß ihres Bildungsauftrages zur Schülerbewertung angehalten. Die tradierte Notengebung ist allerdings nur offenkundige Prozedur einer komplexeren Urteilsfindung. Bohl sieht in den ‚neuen Formen’ der Leistungsbeurteilung ein „drin-gendes Anliegen für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Unterrichts“ . Dass die konventionelle Notengebung und die als willkürlich empfundenen, vielleicht aufgrund der Arbeitsbelastung der Lehrer vereinzelt wirklich beliebig ausfallenden Schülerbe-wertungen schon seit längerer Zeit unter Kritik stehen, ist bekannt. Doch nach wel-chen Kriterien werden im Deutsch- und Geschichtsunterricht Schülerbeurteilungen gefällt, wie findet dieser Prozess statt, was ist der schulische Leistungsbegriff, Be-zugsrahmen und Unterschied zwischen beiden Fächern? Gibt es hier überhaupt ver-schiedene Kriterien für die Notengebung?
In einem vom Leistungsgedanken geprägten Schulalltag, in dem Menschen anhand von Bewertungen kategorisiert werden, stellt sich die Frage nach den Grundsätzen dieser Bewertung. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit den allgemei-nen Problemen der Leistungsmessung in der Schule, wobei verschiedene Faktoren erwähnt werden, die neben den objektiv erbrachten Leistungen in die Bewertung miteinfließen. Zusätzlich wird die Problematik von subjektiven Entscheidungen der Lehrkräfte und der Notengebung an sich besprochen. Anschließend wird auf die mündlichen Leistungen und deren Beurteilung im Unterricht eingegangen. Auch hier sollen zunächst generelle Probleme der Bewertung und der Beobachtung von Schü-lerverhalten angesprochen werden, bevor die Gegenüberstellung dieser Thematik im DU und GU erfolgt. Dasselbe Verfahren kommt bei der Betrachtung von schriftlichen Leistungen zum Einsatz, wobei diese noch in die Bereiche der Schulleistungsüber-prüfungen, der Notenaufteilung und der dafür verantwortlichen Bezugsnormen aufge-teilt werden. In Kapitel 5 soll ein kurzer Blick auf curriculare Verordnungen geworfen werden, die Hilfestellungen bei der Schülerbewertung bieten. Zu diesen Unterstüt-zungsmöglichkeiten gehört auch die Evaluation, die dazu befähigen kann, auch den Leistungsanspruch der Lehrer und deren Unterricht kritisch zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Probleme der schulischen Leistungsmessung
- Generelle Beurteilungsprobleme
- Leistungsbewertung oder Schubladendenken?
- Notengebung
- Mündliche Leistungen
- Generelle Probleme bei der Bewertung mündlicher Leistungen
- Beobachtungen im Unterricht
- Bewertung mündlicher Leistungen im DU und GU
- Schriftliche Leistungen
- Generelle Probleme bei der Bewertung schriftlicher Leistungen
- Bewertung schriftlicher Leistungen im DU und GU
- Schulleistungsüberprüfungen
- Aufteilung der Noten
- Bezugsnormen
- Die amtlichen Verordnungen für den DU und GU
- Evaluation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text untersucht die Problematik der Leistungsmessung im Deutsch- und Geschichtsunterricht. Er beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit der traditionellen Notengebung und der Bewertung von Schülerleistungen einhergehen, und zeigt alternative Möglichkeiten auf, um eine gerechtere und effektivere Beurteilungspraxis zu gewährleisten.
- Generelle Probleme der Leistungsmessung und subjektive Einflüsse von Lehrkräften
- Die Rolle der Notengebung und ihre Auswirkungen auf Schüler und Eltern
- Mündliche und schriftliche Leistungen: Bewertungskriterien und spezifische Herausforderungen im Deutsch- und Geschichtsunterricht
- Der Einfluss von curricularen Verordnungen und Evaluation auf die Leistungsbewertung
- Gemeinsame Kompetenz-, Leistungs- und Lernmodelle im Deutsch- und Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Leistungsbewertung im Kontext der „Leistungsgesellschaft“ dar und beleuchtet die Kritik an der konventionellen Notengebung. Sie führt die zentralen Fragen und Themen der Arbeit ein, die sich mit den Problemen der Leistungsmessung, der Bewertung mündlicher und schriftlicher Leistungen sowie mit den curricularen Verordnungen und der Evaluation beschäftigen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den generellen Problemen der Leistungsmessung. Es analysiert die Schwierigkeiten, die mit der Bewertung von Persönlichkeiten einhergehen und Beurteilungsfehler wie den Halo-Effekt und den Pygmalion-Effekt beleuchtet. Weiterhin wird die Kritik am Leistungsprinzip und der damit verbundenen Reduktion von Lernen auf quantifizierbare Ergebnisse diskutiert.
Im dritten Kapitel stehen die mündlichen Leistungen im Mittelpunkt. Es werden die generellen Probleme der Bewertung mündlicher Leistungen und der Beobachtung von Schülerverhalten untersucht. Der Fokus liegt auf den spezifischen Herausforderungen der Bewertung mündlicher Leistungen im Deutsch- und Geschichtsunterricht.
Das vierte Kapitel widmet sich der Bewertung schriftlicher Leistungen. Es befasst sich mit den generellen Problemen der Bewertung schriftlicher Leistungen sowie mit den spezifischen Herausforderungen im Deutsch- und Geschichtsunterricht. Die Schulleistungsüberprüfungen, die Notenaufteilung und die Bezugsnormen werden als wesentliche Aspekte der schriftlichen Bewertung erörtert.
Das fünfte Kapitel gibt einen kurzen Überblick über curriculare Verordnungen, die Hilfestellungen bei der Schülerbewertung bieten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Leistungsmessung, Schülerbewertung, Notengebung, Beurteilungsprobleme, mündliche Leistungen, schriftliche Leistungen, Deutschunterricht, Geschichtsunterricht, curriculare Verordnungen, Evaluation, Kompetenzmodelle, Lernmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht die konventionelle Notengebung in der Kritik?
Noten werden oft als willkürlich oder subjektiv empfunden und reduzieren komplexe Lernprozesse auf eine einzige Ziffer, was dem individuellen Lernfortschritt oft nicht gerecht wird.
Was sind typische Beurteilungsfehler von Lehrkräften?
Zu den psychologischen Fehlern zählen der Halo-Effekt (ein Merkmal überstrahlt alles) und der Pygmalion-Effekt (Erwartungen beeinflussen die Leistung).
Wie unterscheiden sich die Bewertungskriterien in Deutsch und Geschichte?
Die Arbeit untersucht spezifische Anforderungen, wie z.B. die Textanalyse im Deutschunterricht versus die Quellenkritik und historische Urteilsbildung im Geschichtsunterricht.
Welche Probleme treten bei der Bewertung mündlicher Leistungen auf?
Die Schwierigkeit liegt in der flüchtigen Natur der Beiträge und der subjektiven Wahrnehmung der Lehrkraft während des Unterrichtsgeschehens.
Können Evaluationen die Notengebung verbessern?
Ja, regelmäßige Evaluationen helfen Lehrkräften, ihren eigenen Leistungsanspruch und ihre Bewertungspraxis kritisch zu hinterfragen und transparenter zu gestalten.
- Citation du texte
- Dr. G. (Auteur), 2007, Leistungsbewertung im Deutsch- und Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83613