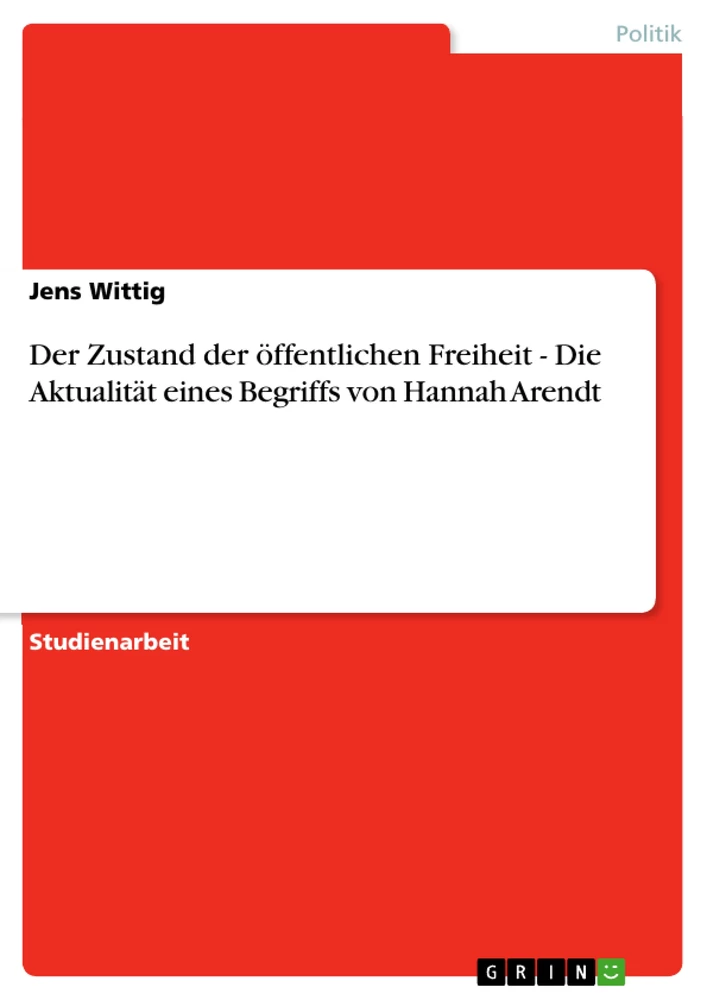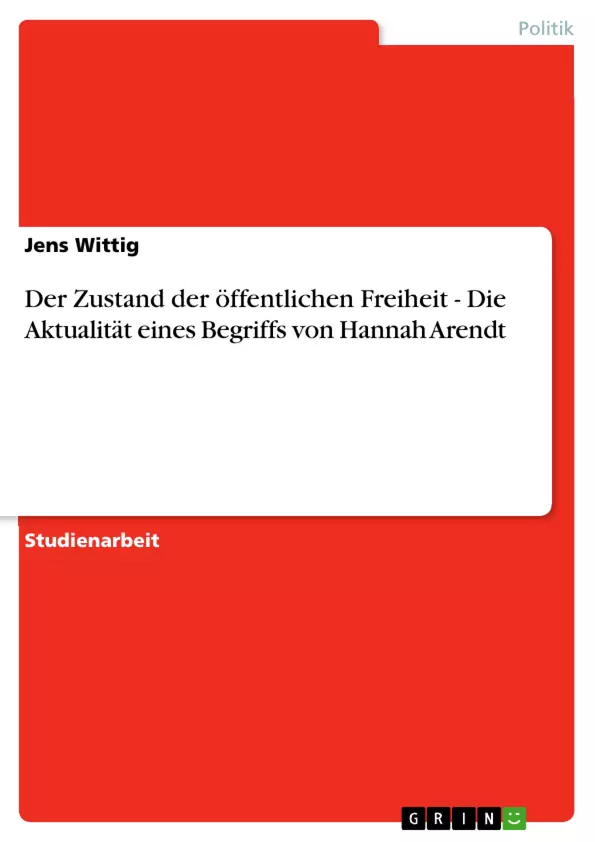Hannah Arendt schuf einen völlig neuen Begriff vom Sinn der Politik, der sich klar von allem bis dahin Gewesenen absetzte. Dementsprechend sieht sie das Politische nicht vor dem Hintergrund einer wie auch immer gearteten Verteilung und Ausübung von Machtressourcen, sondern in erster Linie als die Handlung des Einzelnen als solches. Darin wiederum, und nur darin, liegt ihrer Einschätzung eben jene Freiheit begründet, die das im Leben Erstrebenswerte im Kern enthält – also in einer Beteiligung eines jeden Bürgers an öffentlichen Angelegenheiten seines Staates. Dabei setzt sie sich nicht nur vom konventionellen Politikbegriff ab, sondern auch vom althergebrachten Verständnis von Freiheit, welche sie in zwei verschiedene Arten kategorisiert. Sie unterscheidet in diesem Zuge zwischen negativer und positiver, in näherem Sinne „öffentlicher“ Freiheit. Da der Grundsatz der Freiheit ohnehin in der gesamten Menschheitsgeschichte etwas zentral Erstrebenswertes darzustellen scheint, lohnt es sich, einen detaillierten Blick auf Hannah Arendts Verständnis davon zu werfen.
Arendt behandelt diese Begriffe im Kontext ihres Werkes „Über die Revolution“, indem sie sich vordergründig mit dem Vergleich zwischen den beiden großen, aufgrund der erfolgten Geschehnisse für die Nachwelt maßgeblichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts – der Französischen und der Amerikanischen – auseinandersetzt und so ihren Freiheitsbegriff entwickelt. Mit selbigem befasst sich auch diese Arbeit. Unter welchen Bedingungen Hannah Arendts Konzept der öffentlichen Freiheit unter den Gegebenheiten der Gegenwart zu verorten ist, soll dabei die übergeordnete Fragestellung der folgenden Abhandlung sein. Inwieweit ist dieses Konzept als solches oder Teile davon verwirklicht? Und ist es generell überhaupt soweit tragbar, dass es möglich wäre, es in die Realität umzusetzen? Kann es Kriterium und Maßstab für moderne Politik darstellen? Mit welchen Widersprüchen ist es konfrontiert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der öffentlichen Freiheit bei Hannah Arendt
- Die Ein- und Abgrenzung des Freiheitsbegriffs
- Öffentliche Freiheit versus Verfassungsstaat
- Die mangelnde Manifestierung
- Die Lösung: Das Rätesystem
- Die öffentliche Freiheit in modernen Verfassungsstaaten
- Die Rolle des Verfassungsgerichts
- Kapitalismus versus öffentliche Freiheit
- Die Schwierigkeiten des Rätesystems
- Öffentliche Freiheit trotz Repräsentation?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts Konzept der öffentlichen Freiheit im Kontext ihrer Schrift "Über die Revolution" und analysiert dessen Relevanz für moderne Verfassungsstaaten. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob und inwiefern Arendts Freiheitsbegriff unter den Bedingungen der Gegenwart realisierbar ist und als Kriterium für politische Partizipation dienen kann.
- Arendts Unterscheidung zwischen negativer und öffentlicher Freiheit
- Die Kritik an der mangelnden Manifestierung öffentlicher Freiheit im modernen Verfassungsstaat
- Arendts Vorschlag eines Rätesystems als Lösung
- Die Rolle des Verfassungsgerichts und der Kapitalismus im Kontext öffentlicher Freiheit
- Die Herausforderungen der politischen Partizipation in modernen Demokratien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer ausführlichen Darstellung des Arendtschen Freiheitsbegriffs, indem sie seine Ein- und Abgrenzung beleuchtet. Anschließend werden die Kritik Arendts am modernen Verfassungsstaat und ihr Vorschlag eines Rätesystems zur Förderung öffentlicher Freiheit erläutert. Das dritte Kapitel untersucht die Relevanz von Verfassungsgerichten, den Einfluss des Kapitalismus und die Schwierigkeiten des Rätesystems im Kontext der öffentlichen Freiheit.
Schlüsselwörter
Öffentliche Freiheit, Hannah Arendt, Verfassungsstaat, Rätesystem, politische Partizipation, Verfassungsgericht, Kapitalismus, negative Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hannah Arendt unter dem Begriff der öffentlichen Freiheit?
Für Hannah Arendt ist öffentliche Freiheit die aktive Beteiligung der Bürger an öffentlichen Angelegenheiten und das gemeinschaftliche Handeln im politischen Raum. Sie unterscheidet sich damit grundlegend von der negativen Freiheit, die lediglich die Abwesenheit von staatlichem Zwang beschreibt.
Wie grenzt Arendt die positive von der negativen Freiheit ab?
Negative Freiheit bezieht sich auf den Schutz des Privaten vor staatlichen Eingriffen. Positive oder „öffentliche“ Freiheit hingegen ist die Freiheit zum politischen Handeln und zur Mitgestaltung des Staates, die nur in der Gemeinschaft mit anderen erfahren werden kann.
Warum kritisiert Arendt den modernen Verfassungsstaat?
Arendt kritisiert, dass im modernen Verfassungsstaat die öffentliche Freiheit oft zugunsten der privaten Wohlfahrt und der reinen Verwaltung von Machtressourcen in den Hintergrund tritt, wodurch der Raum für echtes politisches Handeln schrumpft.
Welche Rolle spielt das Rätesystem in Arendts Theorie?
Arendt sieht im Rätesystem eine Lösung, um öffentliche Freiheit dauerhaft zu manifestieren. Es ermöglicht eine direktere politische Partizipation der Bürger jenseits der bloßen Repräsentation in Parteiensystemen.
In welchem Werk entwickelt Arendt ihren spezifischen Freiheitsbegriff?
Arendt entwickelt ihren Begriff der öffentlichen Freiheit primär in ihrem Werk „Über die Revolution“, in dem sie die Französische und die Amerikanische Revolution miteinander vergleicht.
Ist Arendts Konzept der öffentlichen Freiheit heute noch realisierbar?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert die Spannungsfelder zwischen Arendts Ideal und den Realitäten moderner Demokratien, wie etwa dem Einfluss des Kapitalismus und der Rolle des Verfassungsgerichts.
- Citar trabajo
- Jens Wittig (Autor), 2007, Der Zustand der öffentlichen Freiheit - Die Aktualität eines Begriffs von Hannah Arendt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83670