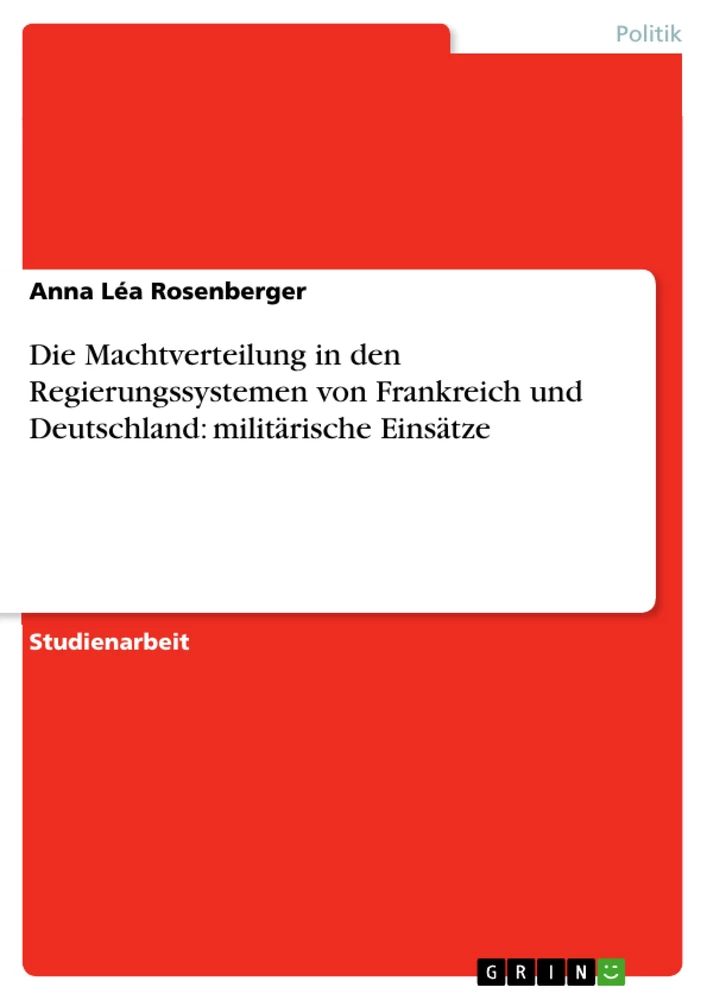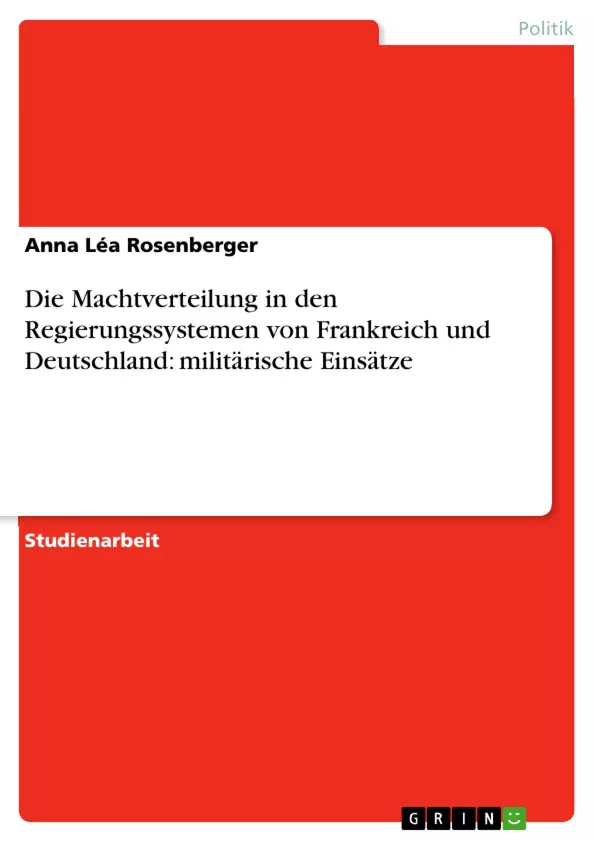Seit dem Vertrag von Nizza (Dezember 2000) verfügt die Europäische Union über eine "Eu-ropäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik" ( kurz ESVP), die es ihr ermöglichen soll, "autonom Beschlüsse zu fassen in den Fällen, in denen die NATO als Ganzes nicht einbezo-gen ist" . Zu diesem Zweck soll bis 2003 eine "schnelle Eingreiftruppe" von bis zu 60.000 Soldaten einsatzfähig sein, die sich jedoch – in Ermangelung einer stehenden europäischen Armee - auf die Kontingente wird stützen müssen, welche die EU-Staaten bereitstellen. Ob diese Truppe wirklich schnell und wirkungsvoll wird reagieren können, hängt wesentlich von den innenpolitischen Entscheidungsprozessen der einzelnen Regierungen Europas bei der Entsendung von Streitkräften ab.
Im Folgenden werden diese Prozesse in zwei Ländern untersucht, die das "Herzstück" oder auch der "Motor" bei der Einigung Europas genannt werden, die aber dennoch grundlegende Unterschiede in der Machtverteilung zwischen Staatsoberhaupt, Regierung und Parlament aufweisen: Frankreich und Deutschland.
Wie wirken sich also diese Unterschiede auf die innenpolitischen Entscheidungsprozesse bei der Entsendung von Streitkräften aus?
Dieser Vergleich erscheint gerade im Lichte der Diskussion um einen möglichen Militär-schlag gegen den Irak und den im Wahlkampf behaupteten "deutschen Weg" interessant, weil sich schon dabei zeigt, wie stark nationale Rahmenbedingungen die politische Wirklichkeit bestimmen und wie schwach der Geist der ESVP bisher ausgeprägt ist.
Um ein Verständnis für die zum Vergleich stehenden Prozesse entwickeln zu können, wird zunächst die Machtaufteilung zwischen Parlament, Regierung und Präsident in Frankreich und in Deutschland erläutert. Darauf aufbauend werden die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beider Länder bei einem Streitkräfteeinsatz aufgezeigt, um letztlich die Wirkungsfä-higkeit der ESVP bewerten zu können.
Hinsichtlich der Literatur für den systempolitischen Teil der Hausarbeit verschafften die Wer-ke von Klaus von Beyme und Udo Kempf einen guten Überblick, auch wenn sie nicht näher auf die Machtbefugnisse zum Einsatz von Streitkräften eingehen. Für diese Analyse waren im Besonderen die Aufsätze von Pascal Vennesson und Werner Link, die Studie von Alexander Siedschlag und der Informationsrapport der Assemblée nationale hilfreich. Für den Ausblick auf die nähere Zukunft der ESVP dienten vor allem die Aufsätze von Gunther Hellmann und Hans Henning von Sandrart.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Machtverteilung im Regierungssystem Frankreichs
- Der Staatspräsident
- Der Premierminister
- Das Parlament
- Kleines Fazit zur Machtverteilung im französischen Regierungssystem
- Die Machtverteilung im Regierungssystem Deutschlands
- Die Bundesregierung
- Das Parlament
- Der Bundespräsident
- Kleines Fazit zur Machtverteilung im deutschen Regierungssystem
- Die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beim Einsatz von Streitkräften
- In Frankreich
- In Deutschland
- Die Machtverteilung im Regierungssystem Frankreichs
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Machtverteilung zwischen den Verfassungsorganen in Frankreich und Deutschland und deren Auswirkungen auf die innenpolitischen Entscheidungsprozesse beim Einsatz von Streitkräften. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Systeme im Kontext der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).
- Vergleich der Machtverteilung in den Regierungssystemen Frankreichs und Deutschlands.
- Analyse der Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beim Einsatz von Streitkräften in beiden Ländern.
- Bewertung der Wirkungsfähigkeit der ESVP im Lichte der nationalen Entscheidungsprozesse.
- Untersuchung der Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die politische Realität.
- Beurteilung der Rolle des Staatsoberhauptes, der Regierung und des Parlaments bei der Entsendung von Streitkräften.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den steigenden Bedarf an einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Kosovo-Krieg und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie führt die Notwendigkeit eines Vergleichs der innenpolitischen Entscheidungsprozesse in Frankreich und Deutschland bei der Entsendung von Streitkräften an, insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede in der Machtverteilung zwischen Staatsoberhaupt, Regierung und Parlament. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz und die verwendete Literatur.
Die Machtverteilung im Regierungssystem Frankreichs: Dieses Kapitel analysiert die Machtverteilung im französischen Regierungssystem, wobei der Fokus auf der zentralen Rolle des Staatspräsidenten liegt. Die Analyse beleuchtet die konstitutionellen Befugnisse des Präsidenten, darunter seine Rolle als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, seine Befugnis zur Ernennung und Entlassung des Premierministers und seine Möglichkeiten, das Parlament aufzulösen. Die Gegenüberstellung dieser Befugnisse mit den Kompetenzen der Regierung und des Parlaments verdeutlicht das präsidial geprägte System Frankreichs. Die starke Position des Präsidenten im Vergleich zu den anderen Organen wird herausgearbeitet.
Die Machtverteilung im Regierungssystem Deutschlands: Im Gegensatz zum französischen System wird hier die Machtverteilung im deutschen Regierungssystem beschrieben. Der Fokus liegt auf dem parlamentarischen Charakter des Systems und der damit verbundenen Gewaltenteilung zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundespräsident. Die Rolle der Bundeskanzlerin als Regierungschefin und die Funktion des Bundestages als zentrales Legislativorgan werden analysiert. Der Bundespräsident wird als Staatsoberhaupt mit eher repräsentativen Funktionen dargestellt. Der Unterschied zum präsidentialen System Frankreichs wird deutlich herausgearbeitet.
Die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beim Einsatz von Streitkräften: Dieses Kapitel vergleicht die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beim Einsatz von Streitkräften in Frankreich und Deutschland. Es werden die jeweiligen institutionellen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen analysiert und die Unterschiede in den Vorgehensweisen der beiden Länder aufgezeigt. Der Vergleich beleuchtet die unterschiedlichen Rollen und Einflussmöglichkeiten des Staatsoberhaupts, der Regierung und des Parlaments in beiden Ländern.
Schlüsselwörter
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Machtverteilung, Regierungssystem, Frankreich, Deutschland, Streitkräfte, Entscheidungsprozesse, Staatspräsident, Bundeskanzler, Parlament, Verfassung, Gewaltenteilung, Innenpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Vergleich der Machtverteilung in den Regierungssystemen Frankreichs und Deutschlands und deren Auswirkungen auf die innenpolitischen Entscheidungsprozesse beim Einsatz von Streitkräften
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Machtverteilung in den Regierungssystemen Frankreichs und Deutschlands und untersucht, wie diese die innenpolitischen Entscheidungsprozesse beim Einsatz von Streitkräften beeinflussen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Systeme im Kontext der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Machtverteilung in den Regierungssystemen beider Länder, analysiert die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse beim Einsatz von Streitkräften, bewertet die Wirkungsfähigkeit der ESVP im Lichte nationaler Entscheidungsprozesse, untersucht Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen und deren Einfluss, und beurteilt die Rolle des Staatsoberhauptes, der Regierung und des Parlaments bei der Entsendung von Streitkräften.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Kapiteln zur Machtverteilung in Frankreich und Deutschland sowie zu den Entscheidungsprozessen beim Einsatz von Streitkräften, und eine Schlussfolgerung. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der Staatspräsident in Frankreich?
Im französischen System spielt der Staatspräsident eine zentrale Rolle. Die Analyse beleuchtet seine konstitutionellen Befugnisse, darunter seine Rolle als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, seine Befugnis zur Ernennung und Entlassung des Premierministers und seine Möglichkeiten, das Parlament aufzulösen. Seine starke Position im Vergleich zu Regierung und Parlament wird herausgearbeitet.
Wie ist die Machtverteilung im deutschen Regierungssystem?
Das deutsche System ist im Gegensatz zum französischen eher parlamentarisch geprägt. Die Arbeit analysiert die Gewaltenteilung zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundespräsident. Die Rolle der Bundeskanzlerin als Regierungschefin und des Bundestages als zentrales Legislativorgan werden ebenso beleuchtet wie die eher repräsentativen Funktionen des Bundespräsidenten.
Wie werden die Entscheidungsprozesse beim Einsatz von Streitkräften verglichen?
Das Kapitel zum Einsatz von Streitkräften vergleicht die Entscheidungsbefugnisse und -prozesse in Frankreich und Deutschland. Es analysiert die institutionellen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und zeigt die Unterschiede in den Vorgehensweisen beider Länder auf, wobei die unterschiedlichen Rollen und Einflussmöglichkeiten des Staatsoberhaupts, der Regierung und des Parlaments im Fokus stehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Machtverteilung, Regierungssystem, Frankreich, Deutschland, Streitkräfte, Entscheidungsprozesse, Staatspräsident, Bundeskanzler, Parlament, Verfassung, Gewaltenteilung, Innenpolitik.
Was ist das Fazit der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt den steigenden Bedarf an gemeinsamer europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Kosovo-Krieg und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie begründet die Notwendigkeit eines Vergleichs der innenpolitischen Entscheidungsprozesse in Frankreich und Deutschland bei der Entsendung von Streitkräften aufgrund der Unterschiede in der Machtverteilung und skizziert den methodischen Ansatz und die verwendete Literatur.
- Citation du texte
- Anna Léa Rosenberger (Auteur), 2002, Die Machtverteilung in den Regierungssystemen von Frankreich und Deutschland: militärische Einsätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8367