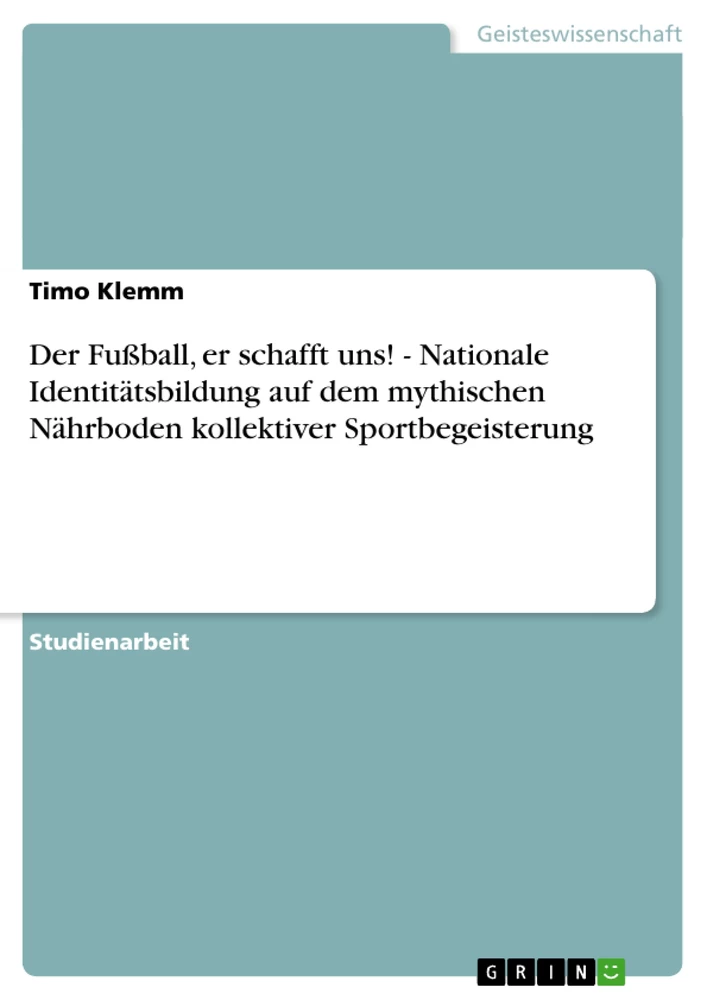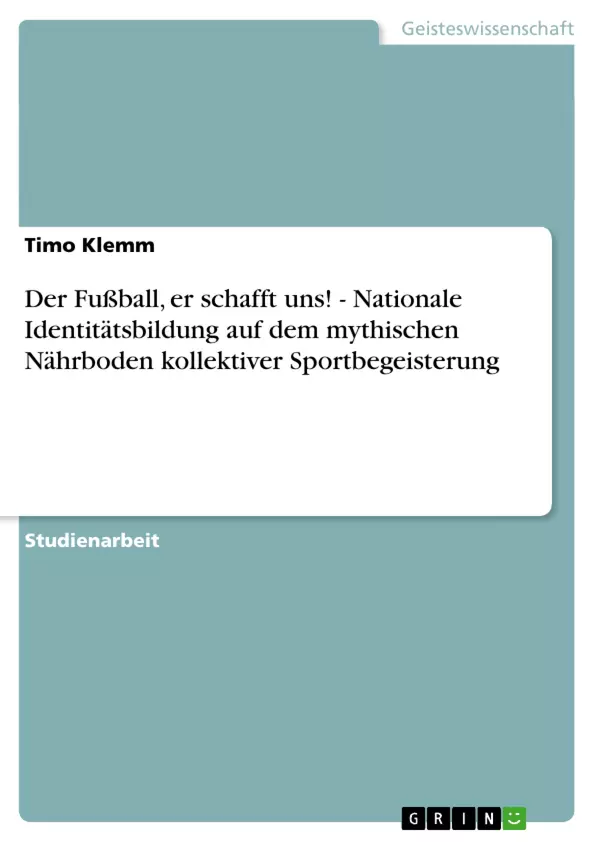Dass Fußball den Rahmen eines bloß sportlichen Ereignisses verlassen, dass er „ein Baustein für Identität, für unser kollektives Gedächtnis, für nationale Größe oder Schmach“ sein kann, bewies die Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, die mit dem finalen „Wunder von Bern“ nicht nur bleibende Erinnerungen hinterlassen hat, sondern zuweilen auch „zum wahren Gründungsdatum der Bundesrepublik, wichtiger als die Währungsreform, die Verabschiedung des Grundgesetzes oder das Einreißen der Berliner Mauer“ stilisiert wurde.
Aus der Selbstwahrnehmung der Deutschen als Fußballnation, gegründet auf einem Mythos, der über die rein sportliche Sphäre hinaus zum Bindeglied der Gesellschaft angewachsen ist, entsteht die Selbstverständlichkeit, die Symbole der Nation in die Fußballbegeisterung mit aufzunehmen. Die Selbstidentifikation mit der symbolischen Bedeutung der Nationalmannschaft , das Gewahrwerden der Existenz einer nationalen Gemeinschaft, die in der Sportbegeisterung zusammen findet, macht den besonderen Reiz einer Fußballweltmeisterschaft aus und unterscheidet sie so von anderen möglichen Vermittlern nationaler Identität.
„Fußball schafft jeden Tag neue Wunder der Identifikation. Das neue Deutschland der Ideen gewinnt an Substanz über seine Fußballmannschaft, die mehr symbolische Kraft hat als die Politik, die Kultur oder die Kunst.“
Solange dies jedoch Gültigkeit behält, müssen Erwartungen bezüglich einer deutschen nationalen Identität, die auch abseits sportlich motivierter Spontangründungen Bestand hat, enttäuscht werden. Deshalb war auch das „deutsche Sommermärchen“ von 2006 nicht die Geburtsstunde eines „neuen deutschen Patriotismus“, sondern nur das inzwischen ritualisierte Auf- und Ausleben nationaler Gefühle im Rahmen kollektiver Sportbegeisterung. Das dies heute in einem solchen Ausmaß möglich ist, ist eine Folge des durch den „Mythos von Bern“ entstandenen gesamtgesellschaftlichen und übersportlichen Stellenwerts des Fußballs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nation und Mythos
- Zum Begriff der Nation
- Funktionen und Wirkungen politischer Mythen
- Mythen als Sinnstifter
- Integration durch Mythen
- Die Legitimationsfunktion politischer Mythen
- Die emanzipatorische Funktion politischer Mythen
- Politische Kulte und Heldenverehrung
- Deutsche Identität und Mentalität nach 1945
- Der Mythos um das „,Wunder von Bern”
- Die Ereignisse und Reaktionen
- Die Topoi des „Mythos von Bern”
- Überhöhungen der Mannschaft
- Überhöhungen einzelner Personen
- Überhöhungen der Gesamtdarstellung und gesellschaftlichen Bedeutung
- Vom Sport zum Mythos
- Rezeptionsgeschichte
- Gesellschaftspolitische Funktionen des „Mythos von Bern”
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Beziehung zwischen dem Fußball als kollektivem Sportereignis und der nationalen Identität in Deutschland zu untersuchen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob und inwiefern die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland den Status eines Mythos erlangt hat, vergleichbar mit dem „Wunder von Bern“ von 1954.
- Die Funktion von Mythen in der nationalen Identitätsbildung
- Die Bedeutung von Sportveranstaltungen für die Konstruktion von Nationalität
- Die Rezeption und Tradierung des „Wunder von Bern“
- Der Stellenwert des „Sommermärchens“ von 2006 für die deutsche Identität
- Der Vergleich zwischen dem „Wunder von Bern“ und der Weltmeisterschaft 2006
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Kontext der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und die Debatte um Patriotismus und Nationalismus, die im Zuge der WM entbrannte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Zusammenhang zwischen dem Begriff der Nation und der Funktion von Mythen in der Politik. Es werden verschiedene Aspekte von Mythen beleuchtet, wie ihre Rolle als Sinnstifter, Integrationsinstrument, Legitimationsgrundlage und Mittel der Emanzipation. Das dritte Kapitel analysiert die deutsche Identität und Mentalität nach 1945 und zeigt auf, wie die Weltmeisterschaft 1954 und das „Wunder von Bern“ die deutsche Nachkriegsgesellschaft prägten. Das vierte Kapitel widmet sich dem Mythos um das „Wunder von Bern“ und untersucht die Ereignisse, die Reaktionen, die Topoi des Mythos, seine Rezeption und die gesellschaftlichen Funktionen.
Schlüsselwörter
Nationale Identität, politische Mythen, Fußball, „Wunder von Bern“, Weltmeisterschaft 2006, Deutschland, Patriotismus, Nationalismus, Integration, Legitimation, Rezeption, Tradierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das „Wunder von Bern“ als Gründungsdatum der BRD bezeichnet?
Der Sieg bei der WM 1954 gab den Deutschen nach dem Krieg erstmals wieder ein positives Gemeinschaftsgefühl und nationale Identität jenseits von Schmach und Schuld.
Welche Rolle spielen Mythen für die nationale Identität?
Politische Mythen dienen als Sinnstifter und Integrationsinstrumente. Sie schaffen ein kollektives Gedächtnis und legitimieren das Gefühl der Zusammengehörigkeit einer Nation.
War das „Sommermärchen“ 2006 die Geburtsstunde eines neuen Patriotismus?
Die Arbeit argumentiert, dass es eher ein ritualisiertes Aufleben nationaler Gefühle im Rahmen des Sports war, ermöglicht durch den hohen gesellschaftlichen Stellenwert des Fußballs seit 1954.
Was versteht man unter der „Symbolkraft“ der Nationalmannschaft?
Die Nationalmannschaft fungiert als Projektionsfläche für nationale Werte und Erfolg. Sie hat oft mehr symbolische Kraft als Politik, Kultur oder Kunst, um die Gesellschaft zu einen.
Wie unterscheiden sich die WM 1954 und die WM 2006 in ihrer Bedeutung?
1954 war ein existenzieller Wendepunkt für das Selbstverständnis, während 2006 eher eine moderne, entspannte Form der Selbstdarstellung einer bereits gefestigten Nation darstellte.
Warum ist Fußball ein „Baustein für das kollektive Gedächtnis“?
Weil Sportereignisse Emotionen wecken, die über Generationen hinweg geteilt und tradiert werden, wodurch sie zu festen Bestandteilen der nationalen Erzählung werden.
- Citar trabajo
- Timo Klemm (Autor), 2006, Der Fußball, er schafft uns! - Nationale Identitätsbildung auf dem mythischen Nährboden kollektiver Sportbegeisterung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83701