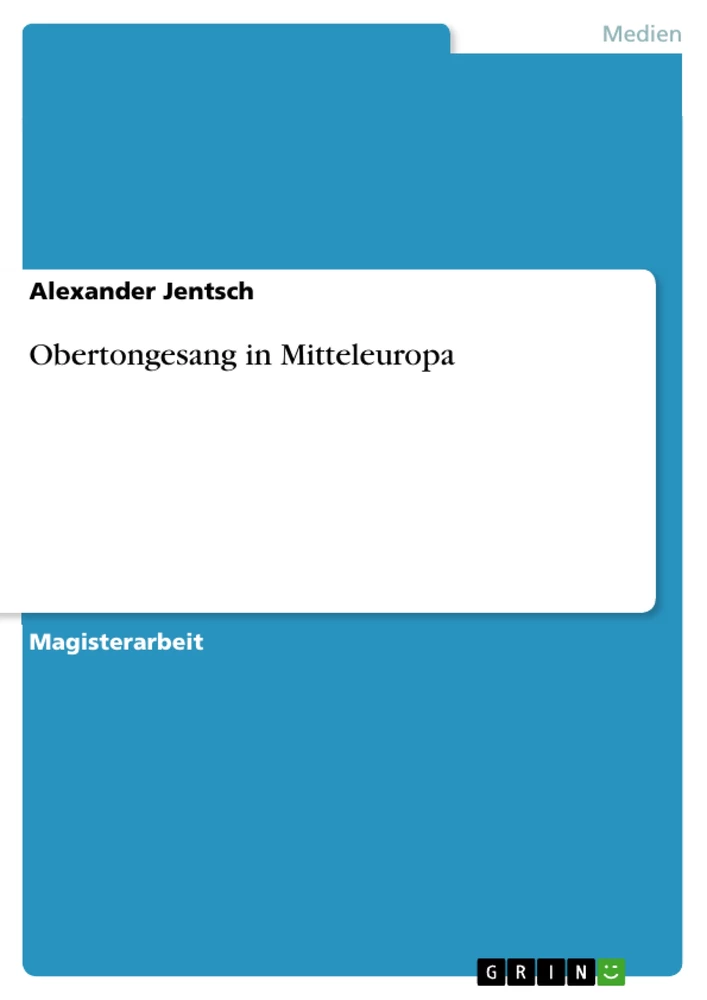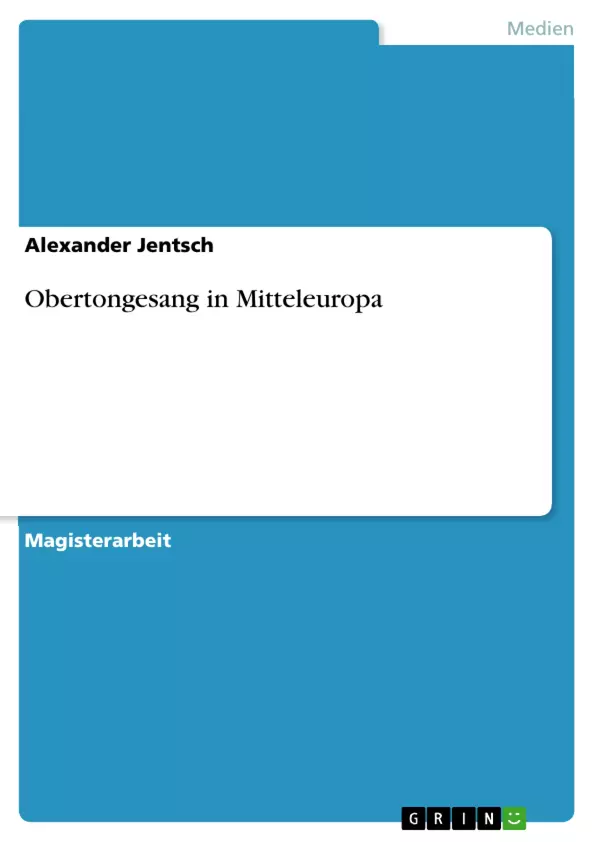Mit dem Begriff Obertongesang werden Singtechniken und musikalischen Stile bezeichnet, bei denen ein einzelner Sänger bzw. eine Sängerin scheinbar zwei- oder mehrstimmig singt. Bei verschiedenen Ethnien Zentralasiens stellen bestimmte Obertongesangsformen einen essenziellen Teil bestehender Musiktraditionen dar. In den letzten Jahrzehnten ist jedoch auch in musikalischen und esoterischen Kontexten westlicher Kulturen eine zunehmende Beschäftigung mit Obertongesang zu beobachten. Diese führt insbesondere in Mitteleuropa und den USA in breitem Umfang zu musiktheoretischen und musikpraktischen Entwicklungen. Hinsichtlich dieser Entwicklungen wird sowohl von westlichen als auch von zentralasiatischen Obertonsängern von Europäischem oder Westlichem Obertongesang gesprochen. Aus Sicht der Vergleichenden Musikwissenschaft steht jedoch in Frage, ob eine solche Differenzierung inhaltlich sinnvoll ist. Der Aufklärung dieser Sachlage widmet sich die vorliegende Arbeit.
Um eine Beschäftigung mit dem Thema zu ermöglichen, werden einführend die physikalischen und physiologischen Grundlagen des Obertongesangs erläutert. Darauf folgt eine Kurzvorstellung weltweiter Beispiele der musikalischen Verwendung von Obertongesang, damit die westlichen Entwicklungen mit diesen verglichen werden können. Eine Phänomenologie der Beschäftigung mit Obertongesang in den westlichen Kulturen schließt den einführenden Teil ab, um die Relevanz der Fragestellung zu umreißen.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Geschichte des Obertongesangs in Europa. Darin werden die musikgeschichtlichen Entwicklungen chronologisch dargestellt, die zu den gegenwärtig bestehenden Obertongesangsformen in Mitteleuropa führen. Richtungsweisende Entwicklungen der okzidentalen Kunstmusikgeschichte werden bezüglich ihres Einflusses auf den musikpraktischen Umgang mit Obertönen und ihres Beitrag für das Entstehen einer Obertongesangsform im Westen untersucht. Die Herausbildung einer Obertonmusik im Westen während der letzten Jahrzehnte wird historisch genau nachvollzogen, wobei eine Unterscheidung verschiedener Entwicklungskontexte Neue Musik bzw. Kunstmusik versus New Age – Musikalität vorgenommen wird. Schließlich werden die in Europa verwendeten Obertongesangstechniken werden mit den in Zentralasien angewandten verglichen. Wobei die Rolle der zentralasiatischen Obertongesangsformen für die Entwicklung der westlichen Obertonmusik bestimmt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Fragestellung, Lösungsansatz und Methodik
- 2. Obertongesang – eine Einführung
- 2.1 Physikalische und physiologische Grundlagen des Obertongesangs
- 2.2 Obertongesang im Kontext zentralasiatischer und anderer Musiktraditionen
- 2.3 Phänomenologie des Obertongesangs in Mitteleuropa
- 3. Geschichte des Obertongesangs in Mitteleuropa
- 3.1 Die Bedeutung von Obertönen in der Antike und der frühchristlichen Musik
- 3.1.1 Die Entdeckung der Teiltöne
- 3.1.2 Die Hypothese einer europäischen Obertongesangstradition im Mittelalter
- 3.1.3 Boethianische Gesänge
- 3.1.4 Ein Einzelfall
- 3.1.5 Gregorianischer Obertongesang als nachträglich erfundene Tradition
- 3.2 Beiträge der abendländischen Kunstmusikgeschichte zur Entwicklung einer Obertongesangstechnik
- 3.2.1 Obertoninstrumente
- 3.2.2 Polyphonie als Vorraussetzung okzidentaler Obertonmusik
- 3.2.3 Auswirkungen von Stimmungstemperaturen auf den Umgang mit Obertönen
- 3.2.4 Die Bestimmung der Obertöne durch Hermann von Helmholtz
- 3.2.5 Klangfarbenbewusstsein in der abendländischen Kunstmusik
- 3.2.6 Karlheinz Stockhausens Stimmung
- 3.3 Westlicher Obertongesang im kunstmusikalischen Kontext der letzten Jahrzehnte
- 3.3.1 Experimente und Inspirationen – die Wurzeln Westlichen Obertongesangs
- 3.3.2 Protagonisten des Westlichen Obertongesangs
- 3.3.3 Techniken Westlichen Obertongesangs
- 3.3.4 Kontextualisierungen und Stile Westlichen Obertongesangs
- 3.3.5 Notation von Obertönen
- 3.3.6 Obertongesang im Kontext von Chormusik
- 3.1 Die Bedeutung von Obertönen in der Antike und der frühchristlichen Musik
- 4. Obertongesang im Kontext des New Age
- 4.1 New Age und romantischer Orientalismus
- 4.2 Obertongesang als Weg und Sinnbild
- 4.3 Heilung mit Obertönen
- 5. Gruppenimprovisationen mit westlichen Obertongesangstechniken
- 5.1 Obertonsänger als Weltmusikstars
- 5.2 Bedeutung zentralasiatischer Formen von Obertongesang für den Westlichen Obertongesang
- 5.3 Zentralasiatischer Obertongesang in Mitteleuropa
- 5.3.1 Zentralasiatische Obertonsänger als Lehrer in Europa
- 6. Westlicher Obertongesang – Schlussfolgernde Begriffsbestimmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Praxis des Obertongesangs in den westlichen Kulturen. Sie untersucht, wie Obertongesang innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem gut vermarkteten Mittel spirituellen Erlebens im Umfeld neureligiöser Bewegungen und auf dem Esoterikmarkt in Mitteleuropa wurde. Die Arbeit analysiert dabei die unterschiedlichen Ansätze und Bedeutungen von Obertongesang, die in verschiedenen Kontexten zum Tragen kommen, von spiritueller Selbsterfahrung über künstlerische Gestaltung bis hin zu wissenschaftlichen Studien.
- Entwicklung und Verbreitung von Obertongesang in Mitteleuropa
- Verbindung von Obertongesang mit spirituellen und esoterischen Praktiken
- Differenzierung von Obertongesang im Kontext der Kunstmusik und des New Age
- Bedeutung von Obertongesang in der modernen Musik
- Einfluss zentralasiatischer Obertongesangstraditionen auf die Entwicklung des westlichen Obertongesangs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die physikalischen und physiologischen Grundlagen des Obertongesangs, die die technischen Aspekte der Gesangstechnik beleuchten. Anschließend wird Obertongesang im Kontext zentralasiatischer und anderer Musiktraditionen betrachtet, um einen globalen Überblick über verschiedene Obertongesangspraxis zu gewinnen. Der Fokus liegt dann auf der Phänomenologie des Obertongesangs in Mitteleuropa, um den konkreten Kontext dieser Arbeit zu definieren.
Das dritte Kapitel behandelt die Geschichte des Obertongesangs in Mitteleuropa und untersucht die Bedeutung von Obertönen in der Antike und der frühchristlichen Musik. Es werden verschiedene Theorien zur Existenz einer europäischen Obertongesangstradition im Mittelalter diskutiert, darunter die Rolle von Boethianischen Gesängen und die Entstehung des Gregorianischen Chorgesangs. Anschließend wird der Einfluss der abendländischen Kunstmusikgeschichte auf die Entwicklung einer Obertongesangstechnik analysiert, wobei Themen wie Obertoninstrumente, Polyphonie und die Bestimmung der Obertöne durch Hermann von Helmholtz beleuchtet werden.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Obertongesang im Kontext des New Age und beleuchtet die Verbindung von Obertongesang mit spirituellen und esoterischen Praktiken. Es werden die verschiedenen Ansätze und Bedeutungen von Obertongesang in diesem Kontext untersucht, wie z.B. die Nutzung von Obertönen als Heilmittel oder als Weg zur spirituellen Erleuchtung.
Das fünfte Kapitel widmet sich Gruppenimprovisationen mit westlichen Obertongesangstechniken und analysiert den Einfluss von Obertonsängern als Weltmusikstars. Es wird die Bedeutung von Obertongesang für den Westlichen Obertongesang im Kontext von Zentralasien und die Rolle von zentralasiatischen Obertonsängern als Lehrer in Europa untersucht.
Schlüsselwörter
Obertongesang, Mitteleuropa, New Age, Spiritualität, Esoterik, Kunstmusik, Geschichte, Tradition, Kultur, Zentralasien, Gesangstechnik, Phänomenologie, Kontextualisierung, Klangfarbe.
- Citation du texte
- M.A. Alexander Jentsch (Auteur), 2007, Obertongesang in Mitteleuropa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83717