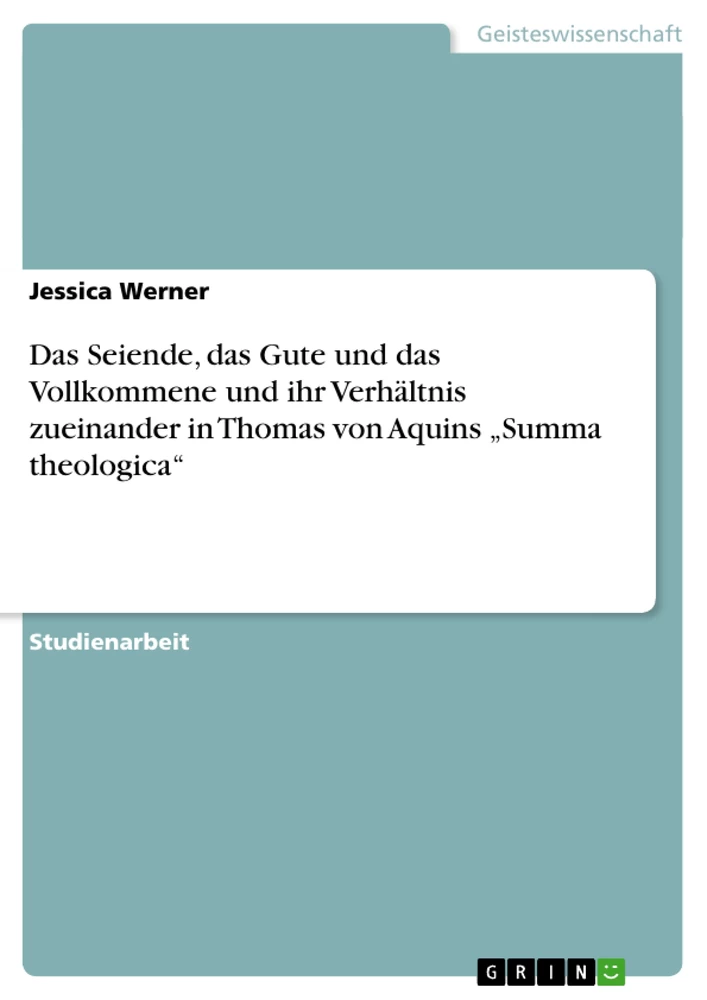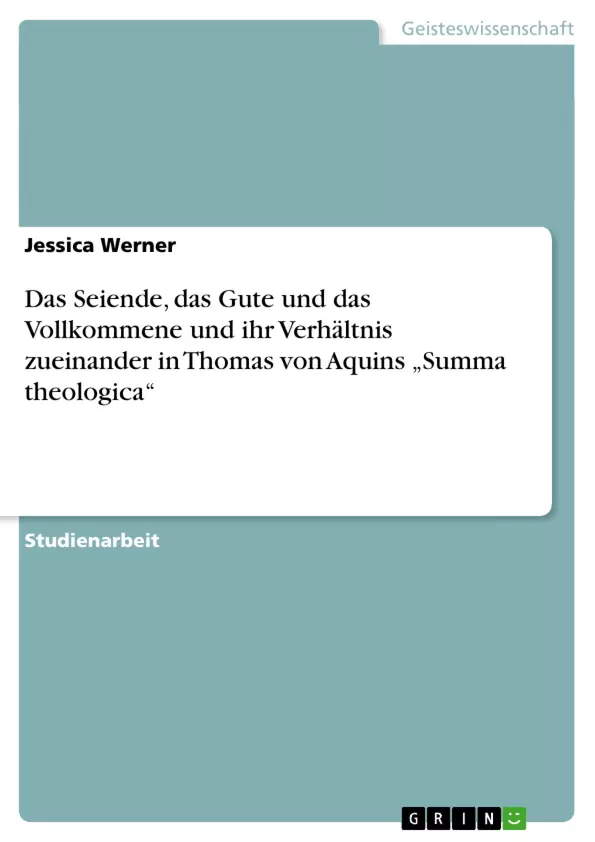In dieser Arbeit soll das Verhältnis zwischen den Begriffen „vollkommen“, „gut“ und „seiend“ untersucht werden. Dass ein Zusammenhang besteht, soll die nun folgende Ausführung zeigen:
Im zweiten Artikel der dritten Frage , der lautet „Ist Gott zusammengesetzt aus Wesensstoff und Wesensform?“ führt Thomas in seinem zweiten Argument Folgendes aus, was zentral ist für die Zusammenhänge zwischen dem Seiendem, dem Guten, und dem Vollkommenen, die in dieser Arbeit untersucht werden sollen:
„Jedes aus Stoff und Form zusammengesetzte Wesen ist gut und vollkommen durch seine Form; es ist also nur dadurch gut, daß der Stoff an der Form als der Seinsvollkommenheit teilhat. Das erste Sein aber, das zugleich das höchste Gut ist, nämlich Gott, kann sein Gutsein nicht durch Teilhabe empfangen haben, denn er ist wesenhaft gut. Das wesenhafte Gut aber ist früher als das, was nur durch Teilhabe gut ist.“
Mit dieser Aussage will Thomas beweisen, dass Gott nicht aus Wesensstoff und Wesensform zusammengesetzt ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vollkommenheit
- Die vierte Frage: Gottes Vollkommenheit
- Der erste Artikel: Ist Gott vollkommen?
- Der zweite Artikel: Finden sich in Gott die Vollkommenheiten aller Dinge vereinigt?
- Zweite Frage, dritter Artikel: Gibt es einen Gott?
- Zusammenfassung
- Die vierte Frage: Gottes Vollkommenheit
- Das Seiende und das Gute – Die fünfte Frage
- Der erste Artikel: Ist das Gute sachlich vom Seienden verschieden?
- Die Behauptungen
- Die Antwort
- Widerlegung der Behauptungen
- Der zweite Artikel: Ist das Gute begrifflich früher als das Seiende?
- Die Behauptungen
- Die Antwort
- Widerlegung der Behauptungen
- Der dritte Artikel: Ist alles Seiende gut?
- Die Behauptungen
- Die Antwort
- Widerlegung der Behauptungen
- Der erste Artikel: Ist das Gute sachlich vom Seienden verschieden?
- Das Verhältnis von Seiendem, Gutem und Vollkommenem – Zusammenfassung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis der Begriffe „vollkommen“, „gut“ und „seiend“ in der „Summa theologica“ von Thomas von Aquin. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen aufzuzeigen und Thomas' Verständnis von „Gutsein“ zu erläutern. Die Arbeit analysiert dazu, wie die Begriffe im Kontext der Gottesbeweise und der Frage nach der Zusammensetzung Gottes aus Stoff und Form verwendet werden.
- Das Verhältnis von Seiendem, Gutem und Vollkommenem in der „Summa theologica“
- Thomas von Aquins Definition von „Gutsein“
- Die Rolle des Begriffs „Gutsein“ in den Gottesbeweisen
- Die Frage nach der Zusammensetzung Gottes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen den Begriffen „vollkommen“, „gut“ und „seiend“ dar und führt das zentrale Argument aus Thomas' „Summa theologica“ ein, das als Ausgangspunkt für die weitere Analyse dient.
Die Vollkommenheit
Dieses Kapitel behandelt Thomas' Begriff der Vollkommenheit, indem es die ersten beiden Artikel der vierten Frage „Ist Gott vollkommen?“ und „Finden sich in Gott die Vollkommenheiten aller Dinge vereinigt?“ analysiert.
Das Seiende und das Gute – Die fünfte Frage
Dieses Kapitel analysiert die fünfte Frage, die sich mit dem Verhältnis von „Seiendem“ und „Gutem“ beschäftigt. Es untersucht insbesondere die ersten drei Artikel, die Fragen nach der sachlichen und begrifflichen Unterscheidung sowie nach der Universalität des Guten in Bezug auf das Seiende behandeln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe „vollkommen“, „gut“, „seiend“, „Form“, „Stoff“, „Gott“, „Summa theologica“ und „Thomas von Aquin“. Sie analysiert das Verhältnis dieser Begriffe im Kontext der Gottesbeweise und der Frage nach der Zusammensetzung Gottes.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen das Seiende und das Gute bei Thomas von Aquin zusammen?
Nach Thomas sind das Seiende und das Gute sachlich dasselbe, unterscheiden sich aber begrifflich: Das Gute fügt dem Seienden den Aspekt der Begehrenswertheit hinzu.
Ist Gott nach Thomas von Aquin vollkommen?
Ja, Thomas beweist in der Summa theologica, dass Gott als erste Wirkursache alle Vollkommenheiten aller Dinge in sich vereinigen muss.
Was bedeutet "Gutsein durch Teilhabe"?
Geschaffene Wesen sind nur gut, weil sie an der Güte Gottes teilhaben. Gott hingegen ist "wesenhaft gut", da sein Wesen mit seinem Sein identisch ist.
Ist alles Seiende auch automatisch gut?
In der Summa wird argumentiert, dass alles, sofern es Sein besitzt, eine gewisse Güte hat, da Sein an sich eine Vollkommenheit darstellt.
Warum kann Gott nicht aus Stoff und Form zusammengesetzt sein?
Weil Stoff potenzielle Existenz bedeutet, Gott aber reiner Akt (actus purus) und somit vollkommen einfach und unzusammengesetzt sein muss.
- Citation du texte
- Jessica Werner (Auteur), 2005, Das Seiende, das Gute und das Vollkommene und ihr Verhältnis zueinander in Thomas von Aquins „Summa theologica“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83718