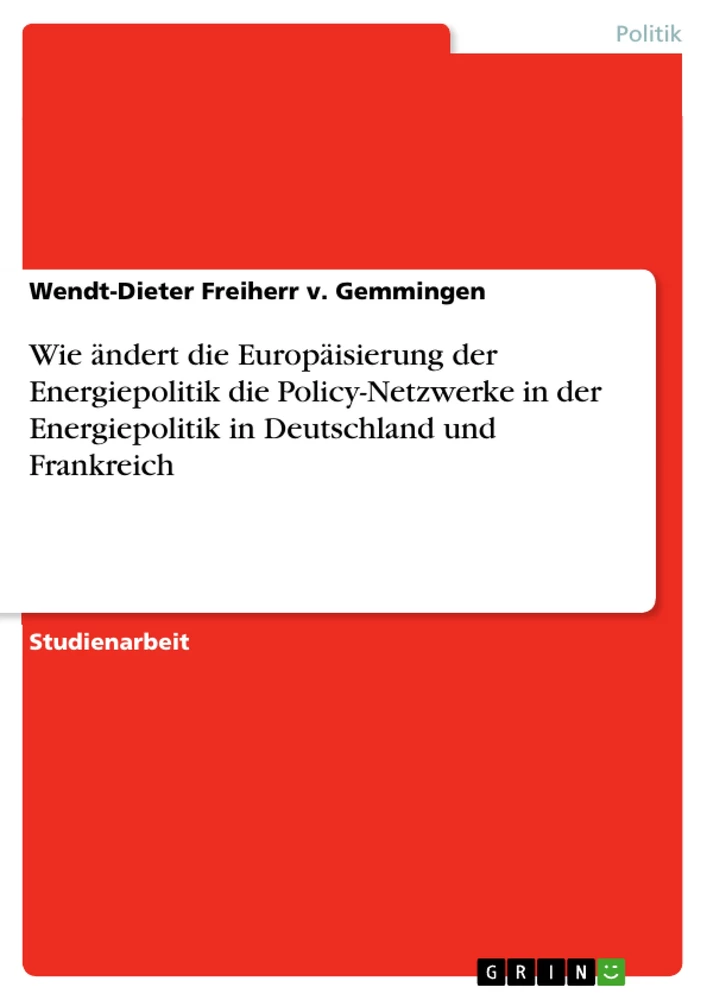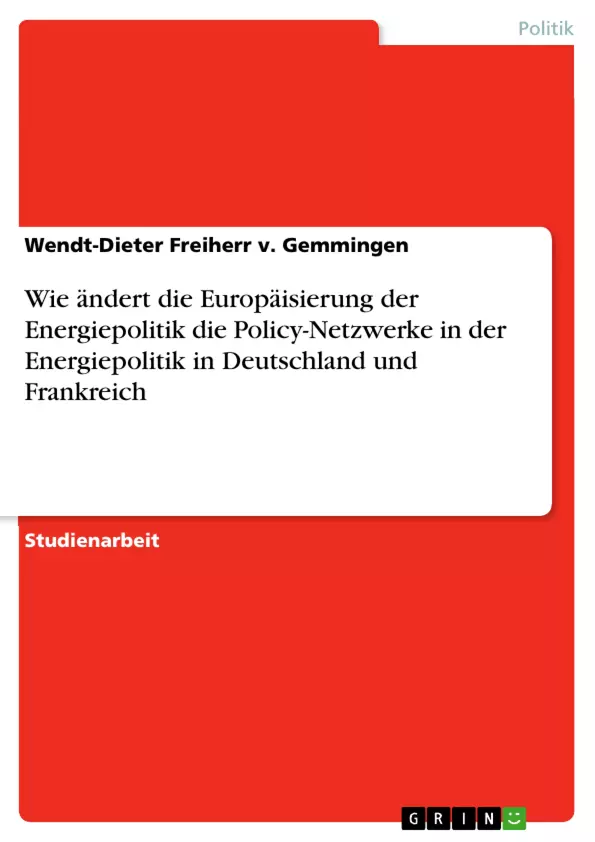Die Energiepolitik der Europäischen Union und ihrer Einzelstaaten befindet sich im Wandel. Bedingt durch die weltweite Globalisierung und damit auch Europäischen Wirtschaftsprozesse entstehen multinationale Wirtschaftskonstrukte welche unter dem Kartellrechtlichen und nationalpolitischen Einfluss der Einzelstaaten stehen.
Den Expansionsbemühungen der Unternehmen stehen dabei Nationale Interessen entgegen. Deutschland und Frankreich sind als Europäische wirtschaftliche Schlüsselnationen interessant für die Untersuchung der Fragestellung wie sich die entstandenen policy Netzwerke in der Politik zum einen und zum anderen die der Energiekonzerne und ihrer Lobbyisten im Wirtschaftlichen Entwicklungsprozess verändern.
Inhaltsverzeichnis
- Zentrale Fragestellung
- Entwicklung der Energieproduktivität in der EU
- Wer sind die Akteure der Europäischen Energiewirtschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Europäischen Union auf die Energiepolitik in Deutschland und Frankreich, insbesondere die Veränderung der policy Netzwerke in der Politik, der Energiekonzerne und ihrer Lobbyisten. Sie befasst sich mit der Bedeutung der Energiepolitik als „sektorale Strukturpolitik“ und den unterschiedlichen Ansätzen in Deutschland und Frankreich, die durch die Verstaatlichung der Energiewirtschaft in Frankreich und die Privatwirtschaftliche Organisation in Deutschland geprägt sind.
- Europäisierung der Energiepolitik
- Veränderungen von policy Netzwerken
- Nationale Interessen vs. Europäische Integration
- Energiepolitik als "sektorale Strukturpolitik"
- Vergleich Deutschland und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
Zentrale Fragestellung
Der Text stellt die zentrale Frage, wie sich die Europäisierung der Energiepolitik auf die policy Netzwerke in Deutschland und Frankreich auswirkt. Dabei werden die Herausforderungen der Globalisierung, der Einfluss multinationaler Wirtschaftskonstrukte und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern beleuchtet.
Entwicklung der Energieproduktivität in der EU
Dieses Kapitel analysiert die Energieproduktivität in der EU, mit einem Fokus auf die durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten von 1995 bis 2002. Die Notwendigkeit von jährlichen Steigerungen der Energieproduktivität um 2,9% bis zum Jahr 2020 zur Erreichung der EU-Ziele wird hervorgehoben.
Wer sind die Akteure der Europäischen Energiewirtschaft?
Dieses Kapitel identifiziert die Akteure der Europäischen Energiewirtschaft, die sich mit dem Spannungsfeld zwischen steigendem Energiebedarf und Umweltschutz auseinandersetzen. Es beschreibt die Rolle der Unternehmen, Kartellbehörden, Energiedienstleister, Transportunternehmen, Endverbraucher, Umweltschützer, Politiker und Lobbyisten. Die Generaldirektion Energie der Kommission als zentrale Kraft im europäischen Raum wird vorgestellt und ihre Aufgaben im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Europäisierung der Energiepolitik, policy Netzwerke, nationale Interessen, Energieproduktivität, Energieversorgung, Umweltschutz, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, multinationale Unternehmen, Kartellrecht, Verstaatlichung, Privatisierung, EU-Kommission, Generaldirektion Energie, Ministerrat.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die EU die nationale Energiepolitik?
Die EU setzt Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt, den Klimaschutz und die Energieproduktivität, was die Nationalstaaten zur Anpassung ihrer Policy-Netzwerke zwingt.
Was unterscheidet die Energiepolitik Deutschlands von der Frankreichs?
Frankreichs Energiemarkt war lange stark verstaatlicht und zentralisiert, während Deutschland eher auf privatwirtschaftliche Organisation und dezentrale Strukturen setzt.
Was sind Policy-Netzwerke in der Energiepolitik?
Es sind Beziehungsgeflechte zwischen politischen Akteuren, Energiekonzernen, Lobbyisten und Verbänden, die gemeinsam an der Gestaltung von Gesetzen und Strategien arbeiten.
Welche Ziele verfolgt die EU bis 2020 bei der Energieproduktivität?
Die EU strebt eine jährliche Steigerung der Energieproduktivität um ca. 2,9 % an, um Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von Importen zu verringern.
Welche Rolle spielt die Generaldirektion Energie der Kommission?
Sie ist die zentrale Kraft auf europäischer Ebene, die Richtlinien entwirft und die Einhaltung europäischer Energiestandards in den Mitgliedsstaaten überwacht.
- Quote paper
- Wendt-Dieter Freiherr v. Gemmingen (Author), 2007, Wie ändert die Europäisierung der Energiepolitik die Policy-Netzwerke in der Energiepolitik in Deutschland und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83816