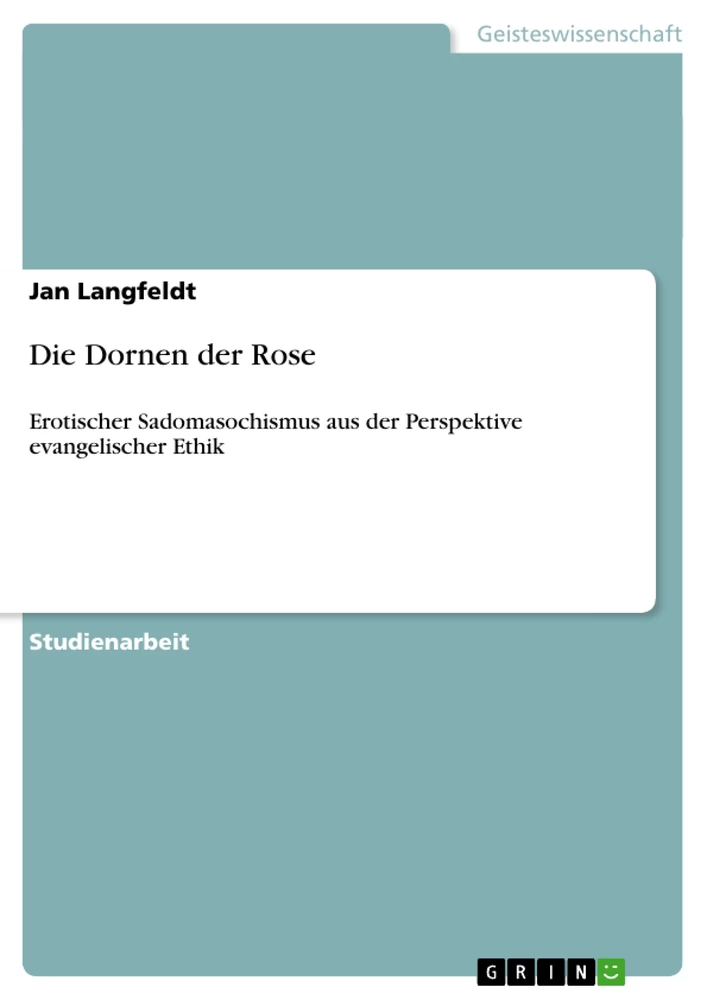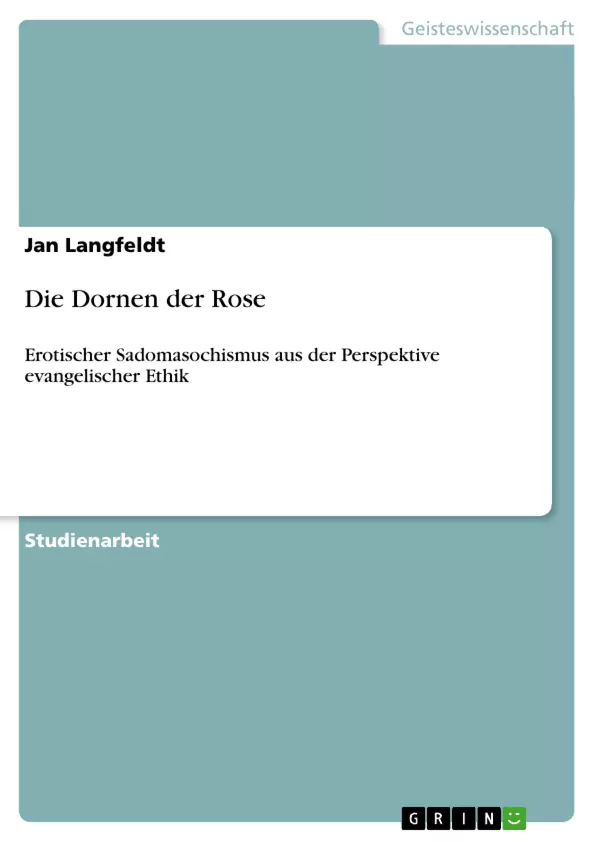Sexualität ist einer der wesentlichsten Aspekte menschlichen Daseins und, wie auch immer man sich die entsprechenden Zusammenhänge im Einzelnen konkret vorstellen mag, sowohl Folge und Ausdruck als auch Auslöser elementarster menschlicher Regungen. Sich dessen bewusst verwundert es nicht, dass sie immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen und nicht selten auch stärkster Auseinandersetzungen wird.
Seit einigen Jahren ist, nicht zuletzt durch die gute Lobbyarbeit zahlreicher verschiedener und einander bisweilen heftigst bekämpfender Interessenverbände und –Initiativen (PorNo; Smart Rhein-Ruhr; Arbeitskreis SM und Christsein etc.), der erotische Sadomasochismus für die Allgemeinheit verstärkt von Interesse. Er ruft gleichermaßen Anhänger wie seriöse Kritiker und auch fanatische Feinde – radikal-feministische Populisten wie EMMA-Herausgeberin Alice Schwarzer sprechen inzwischen in schon fast demagogisch anmutender Weise von „Sexualfaschismus“ und rücken SM-Pornografie in ideologische Nähe zum Genozid – auf den Plan. BDSM polarisiert. Umso bedauerlicher ist es, dass sich bis dato keine der in Deutschland relevanten Volkskirchen und nur wenige Theologen explizit zu dieser Art der Erotik geäußert haben. Die vorliegende Arbeit leistet hier gewissermaßen theologische Pionierarbeit.
Inhalt
0. Einleitung, Problematisierung, Aufbau
1. Sadomasochismus
1.1. Begriffsbestimmung
1.2. Signifikante Spezifika kultivierter SM-Sexualität
1.2.1. Sadomasochistische Beziehungen: Liebe, Partnerschaft, Promiskuität, Geselligkeit
1.2.2. Erotische Inszenierung: Rollenspiel, Gewaltpornografie, Fetischismus
1.3. Sadomasochismus unter psychologischen und medizinischen Gesichtspunkten
1.4. Statistisches
2. Evangelische Ethik und Sexualethik
2.1. Grundsätze evangelischer Ethik
2.1.1. Das Prinzip der Heiligkeit
2.1.2. Bezug auf Evangelium und Menschenwürde
2.1.3. Freiheit und Verantwortung
2.2. Momente evangelischer Sexualethik
2.2.1. Sexualität zwischen biblischem Primat der Reproduktion und Spiel
2.2.2. Sexualität und Liebe
2.2.3. Sexualität als Sprache
2.2.4. Sexualität und Ehe
Exkurs 1: Bibel und BDSM
Exkurs 2: Das Christentum: Religion mit sadomasochistischen Zügen
Exkurs 3: Das Recht des Menschen auf kontrollierte Selbstverletzung und –Erniedrigung
3. Sadomasochismus und evangelische Sexualethik
3.1. Der evangelischen Sexualethik entsprechende Aspekte des Sadomasochismus
3.1.1. Sadomasochismus als Liebe bzw. liebevolle Zuwendung
3.1.2. Sadomasochismus als Spiel
3.2. Der evangelischen Sexualethik widersprechende Aspekte des Sadomasochismus
3.2.1. Probleme auf der Anschauungsebene
3.2.2. Eindimensionalitätstendenzen des Sadomasochismus
3.3. Zusammenfassung und Fazit: Sadomasochismus als konzentrierter Ausdruck des Menschlichen
0. Einleitung, Problematisierung, Aufbau
Sexualität ist einer der wesentlichsten Aspekte menschlichen Daseins und, wie auch immer man sich die entsprechenden Zusammenhänge im Einzelnen konkret vorstellen mag, sowohl Folge und Ausdruck als auch Auslöser elementarster menschlicher Regungen. Sich dessen bewusst verwundert es nicht, dass sie immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen und nicht selten auch stärkster Auseinandersetzungen wird.
Seit einigen Jahren ist, nicht zuletzt durch die gute Lobbyarbeit zahlreicher verschiedener und einander bisweilen heftigst bekämpfender Interessenverbände und –Initiativen (PorNo; Smart Rhein-Ruhr; Arbeitskreis SM und Christsein etc.), der erotische Sadomasochismus[1] für die Allgemeinheit verstärkt von Interesse. Er ruft gleichermaßen Anhänger wie seriöse Kritiker und auch fanatische Feinde – radikal-feministische Populisten wie EMMA -Herausgeberin Alice Schwarzer sprechen inzwischen in schon fast demagogisch anmutender Weise von „Sexualfaschismus“[2] und rücken SM-Pornografie in ideologische Nähe zum Genozid[3] – auf den Plan. BDSM polarisiert. Umso bedauerlicher ist es, dass sich bis dato keine der in Deutschland relevanten Volkskirchen und nur wenige Theologen explizit zu dieser Art der Erotik geäußert haben. Die vorliegende Arbeit leistet hier gewissermaßen theologische Pionierarbeit.
Sie ist dreigliedrig aufgebaut, wobei im ersten Abschnitt der zu verhandelnden Arbeitsgegenstand, die sadomasochistische Erotik, näher eingegrenzt und überblicksartig dargestellt wird und im zweiten Abschnitt Grundsätze und wesentliche Momente evangelischer Ethik i.A. und der Sexualethik im Besonderen erarbeitet werden. Im dritten Abschnitt werden die Erkenntnisse der vorangegangenen Abschnitte aufeinander bezogen und der Themenkomplex Sadomasochismus kritisch erörtert.
Die Arbeit schließt mit einer auf Grundlage der vorausgegangenen Arbeitsschritte gewonnenen ethischen Beurteilung der sadomasochistischen Sexualität aus evangelischer Perspektive.
1. Sadomasochismus
1.1. Begriffsbestimmung
Der Psychologe Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) führt in seinem Buch Psychopathia sexualis, einem Klassiker der Sexualwissenschaft, erstmals die Begriffe „Sadismus“ und „Masochismus“ für die entsprechenden Paraphilien ein, die er aus den Namen zweier signifikanter Vertreter dieser „Perversionen“ herleitet: Der französische Schriftsteller Marquis Donatien-Alphonse-Francois de Sade (1740-1814; Die 120 Tage von Sodom; Sadismus), der in seinen philosophischen Erotika unmenschliche Grausamkeiten verschiedenster Art darstellt, und der galizische Romancier Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895; Venus im Pelz; Masochismus) stehen Pate.[4] Die Phänomene Sadismus und Masochismus selbst sind indes wesentlich älter, und mutmaßlich zu allen Zeiten haben zahlreiche Menschen mehr oder weniger offen sexuelle Erregung aus der Anteilnahme an Gewalt, etwa beim Beiwohnen bei einer Hinrichtung oder einem Kampfsportereignis, gezogen[5]; auch ist der spielerische Sadomasochismus unter verschiedenen Namen bereits in der Antike bekannt, wird u. in Talmud und Kamasutra erwähnt und ist als im 19. Jahrhundert in Literatur und erotischem Alltag fest verankert zu betrachten[6].
Heute bezeichnet man im Allgemeinen jene sexuelle Paraphilie, die als „Spiel mit Macht, Zwang und Unterwerfung“ diese darstellt und die diese Art der Sexualität Praktizierenden aus Zufügung (Sadismus) oder Empfang (Masochismus) von Schmerz oder Demütigung[7] Lust schöpfen lässt, als Sadomasochismus.[8] Der Koitus ist dabei nicht zwingend Bestandteil der SM-Sexualität und kann durch erotische Ersatzhandlungen wie Auspeitschen (Flagellation), Schlagen (Spanking), erniedrigende Behandlung (Pornolalie) oder der Zumutung von Ekel (Exkrementophilie) substituiert werden: Kompensationssadismus und –Masochismus.[9]
[...]
[1] Spricht der Verfasser der vorliegenden Arbeit von „Sadomasochismus“, so meint er, sofern nicht explizit anders vermerkt, immer ausschließlich den so genannten „inklinierenden Sadomasochismus“, d.h. Sadomasochismus, der auf der Metaebene im gemeinsamen Einvernehmen aller daran Beteiligten vollzogen wird. Der Verfasser gebraucht die Begriffe und Abkürzungen „Sadomasochismus“, „SM“ (Sadomasochismus) und „BDSM“ (Bondage, Disziplin, Sadismus, Masochismus) synonym. Letztere sind weniger pathologisch konnotiert als „Sadomasochismus“ und werden deshalb von vielen BDSMlern bevorzugt.
[2] Hoffmann, Arne, SM-Lexikon. Der Inside-Führer zum Sadomasochismus: Praktiken, Personen, Literatur, Film, Philosophie und vieles mehr, Berlin 2003, 350.
[3] Ebd., 159.
[4] Passig, Kathrin/ Strübel, Ira, Die Wahl der Qual. Handbuch für Sadomasochisten und solche, die es werden wollen, Hamburg2 2006, 115-129.
[5] Braun, Walter [mutmaßlich ein Pseudonym], Sadismus Masochismus Flagellantismus, Flensburg4 1989, 42f.
[6] Passig / Strübel, Wahl der Qual, 115-129.
[7] Hoffmann, SM-Lexikon, 73: „Demütigung [...] greift [...] immer auf bestimmte Grundstrukturen zurück: das Zurschaustellen bestimmter Fehler, Schwächen und Blößen des passiven Partners; ihn sexuell aufzureizen, ohne ihm Befriedigung zu gewähren, die man stattdessen demonstrativ bei anderen Menschen findet; ihn zu einem sozial oder oder für ihn selbst normalerweise inakzeptablen Verhalten zu bringen.“
[8] Hoffmann, SM-Lexikon, 329f.
[9] Dressler, Stephan / Zink, Christoph (Bearbeiter), Pschyrembel Wörterbuch Sexualität, Berlin / New York 2003, 449-451 und 320.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit "Die Dornen der Rose"?
Die Arbeit leistet theologische Pionierarbeit, indem sie den erotischen Sadomasochismus (BDSM) aus der Perspektive der evangelischen Sexualethik untersucht.
Wie wird BDSM in dieser Arbeit definiert?
Es wird primär der „inklinierende Sadomasochismus“ betrachtet, der auf gegenseitigem Einvernehmen basiert und als Spiel mit Macht und Unterwerfung verstanden wird.
Woher stammen die Begriffe Sadismus und Masochismus?
Sie wurden von Richard von Krafft-Ebing eingeführt, abgeleitet vom Marquis de Sade und Leopold von Sacher-Masoch.
Widerspricht BDSM der christlichen Ethik?
Die Arbeit wägt ab: Während Aspekte wie Liebe und Spiel Gemeinsamkeiten aufweisen, werden Tendenzen zur Eindimensionalität kritisch hinterfragt.
Gibt es Bezüge zwischen dem Christentum und BDSM?
Ein Exkurs der Arbeit untersucht provokant, ob das Christentum selbst Merkmale aufweist, die sadomasochistisch gedeutet werden könnten.
Was bedeutet "Sexualität als Sprache"?
In der evangelischen Sexualethik wird Sexualität als eine Form der Kommunikation und Zuwendung verstanden, was auch auf SM-Beziehungen übertragen werden kann.
- Quote paper
- Jan Langfeldt (Author), 2007, Die Dornen der Rose, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83937