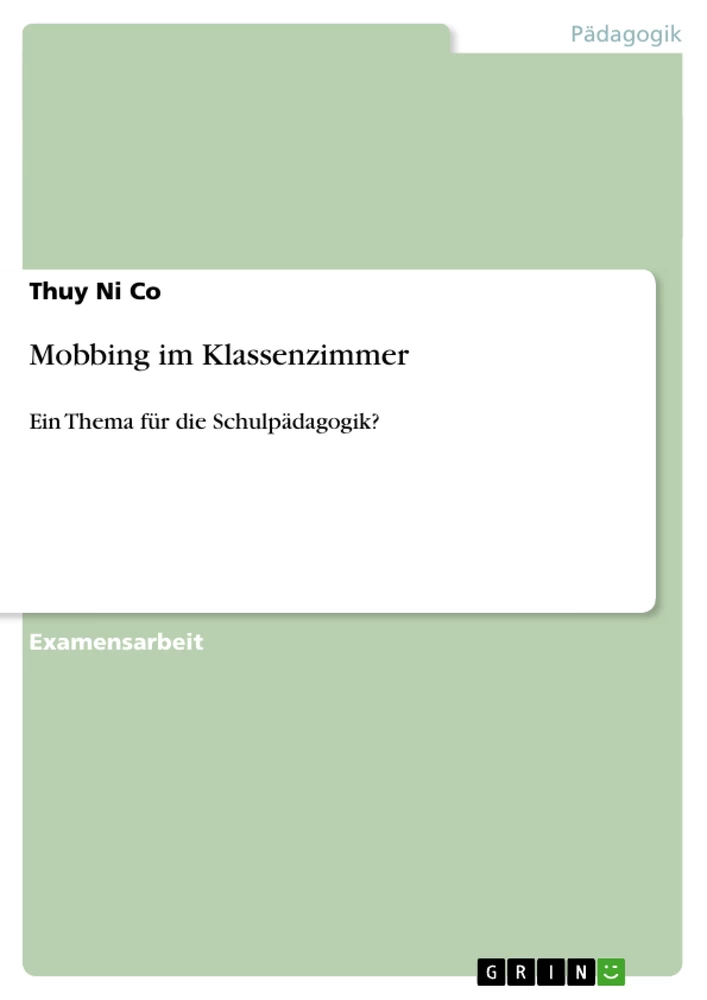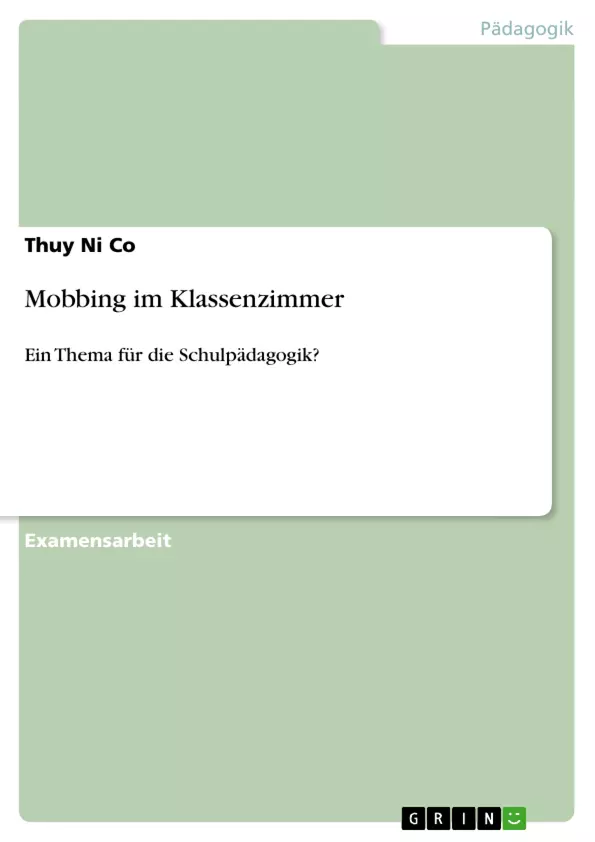Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sichert jedem einzelnen Kind den Schutz vor Verletzungen seiner Würde und seiner Person. Die UN-Kinderkonvention bekräftigt die Rechte auf Schutz und Förderung seiner Entwicklung. Alle Kinder bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr genießen einen besonderen rechtlichen Schutz, das ein Diskriminierungsverbot ausdrücklich mit einschließt. Die seit Herbst 2000 geltende Ergänzung nach §1631 Abs. 2 BGB lautet: „Jedes Kind hat ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ (Kasper 2004, S.5)
Der Begriff "Mobbing" ist mittlerweile den meisten Menschen aus den Medien bekannt und wird oft im Zusammenhang mit den Problemen an Schulen verwendet. Doch stellt sich die Frage, was genau eigentlich mit der Bezeichnung "Mobbing" gemeint ist und wie er mit dem Themenbereich "Schule" zusammenhängt. Sollte er vielleicht ein Thema für die Schulpädagogik sein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Mobbing
- Grundsätzliche Theorien
- Das Phasenmodell nach Leymann
- Eine Einschränkung
- Die Motivation der Mobber
- Familiäre Einflüsse
- Einfluss der Medien
- Konkrete Motive
- Folgen
- Psychische Auswirkungen
- Stress
- Schulangst
- Physische Auswirkungen
- Suizid
- Psychische Auswirkungen
- Mobbing in der Schule
- Fallbeispiele
- Die Entstehung von Mobbing im Klassenzimmer
- Die möglichen Konstellationen
- Mobbing unter Schülern
- Mobbing unter Lehrern
- Schüler mobben Lehrer
- Lehrer mobben Schüler
- Auswirkungen
- Einordnung in die Schulpädagogik
- Der Gegenstand der Schulpädagogik
- Die Schule als pädagogische Institution
- Lehrerprofessionalität
- Handlungskompetenz
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Das Arbeitsklima
- Interventionsprogramme
- Aggressionstraining
- Schulpsychologen und Sozialpädagogen
- Schulkliniken
- Die Anti-Mobbing-Strategie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Mobbing im Klassenzimmer und untersucht, ob es ein Thema für die Schulpädagogik sein sollte.
- Die Definition und Herleitung des Begriffs Mobbing
- Die Analyse grundlegender Theorien zum Mobbingverhalten
- Die Motivationen von Mobbern und die Auswirkungen auf die Gemobbten
- Die Entstehung von Mobbing in der Schule und die möglichen Konstellationen
- Die Einordnung von Mobbing in den Kontext der Schulpädagogik und mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema Mobbing in der Schule vor und erläutert die Relevanz dieses Themas im Hinblick auf den Schutz von Kindern.
- Der Begriff Mobbing: Es wird eine Definition von Mobbing gegeben und seine Bedeutung im Kontext der Schule erläutert.
- Grundsätzliche Theorien: Das Phasenmodell nach Leymann und seine Einschränkungen werden beleuchtet.
- Die Motivation der Mobber: Dieser Abschnitt untersucht die Motive von Mobbern, darunter familiäre Einflüsse, Einfluss der Medien und konkrete Motive.
- Folgen: Die Arbeit betrachtet die psychischen und physischen Folgen von Mobbing, einschließlich Stress, Schulangst und Suizid.
- Mobbing in der Schule: Es werden Fallbeispiele von Mobbing an Schulen vorgestellt und die Entstehung von Mobbing im Klassenzimmer analysiert. Die möglichen Konstellationen von Mobbern und Gemobbten in der Schule werden beleuchtet.
- Einordnung in die Schulpädagogik: Die Bedeutung von Mobbing für die Schulpädagogik wird erörtert, die Schule als pädagogische Institution beschrieben und verschiedene Präventions- und Interventionsmaßnahmen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Mobbing, Schulpädagogik, Lehrerprofessionalität, Handlungskompetenz, Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Die Analyse des Phänomens Mobbing in der Schule mit dem Fokus auf die Motivation der Mobber und die Folgen für die Gemobbten, stellt zentrale Themen dar.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing in der Schule definiert?
Mobbing bezeichnet systematische, über einen längeren Zeitraum anhaltende Angriffe gegen eine Person, die darauf abzielen, deren Würde zu verletzen und sie sozial zu isolieren.
Was ist das Phasenmodell nach Leymann?
Leymann beschreibt Mobbing als Prozess in vier Phasen: vom ursprünglichen Konflikt über Terrorisierung und rechtliche Fehler bis hin zur endgültigen Ausstoßung des Opfers.
Welche Konstellationen von Mobbing gibt es im Klassenzimmer?
Es gibt Mobbing unter Schülern, unter Lehrern, aber auch Fälle, in denen Schüler Lehrer mobben oder Lehrer Schüler schikanieren.
Was motiviert Mobber zu ihrem Verhalten?
Motive können Machtstreben, familiäre Einflüsse, Medieneinfluss oder die Kompensation eigener Unsicherheiten sein.
Welche Präventionsmaßnahmen gegen Mobbing sind effektiv?
Wichtig sind ein gutes Arbeitsklima, Interventionsprogramme, Aggressionstraining sowie die Einbindung von Schulpsychologen und Sozialpädagogen.
- Citar trabajo
- Thuy Ni Co (Autor), 2005, Mobbing im Klassenzimmer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83981