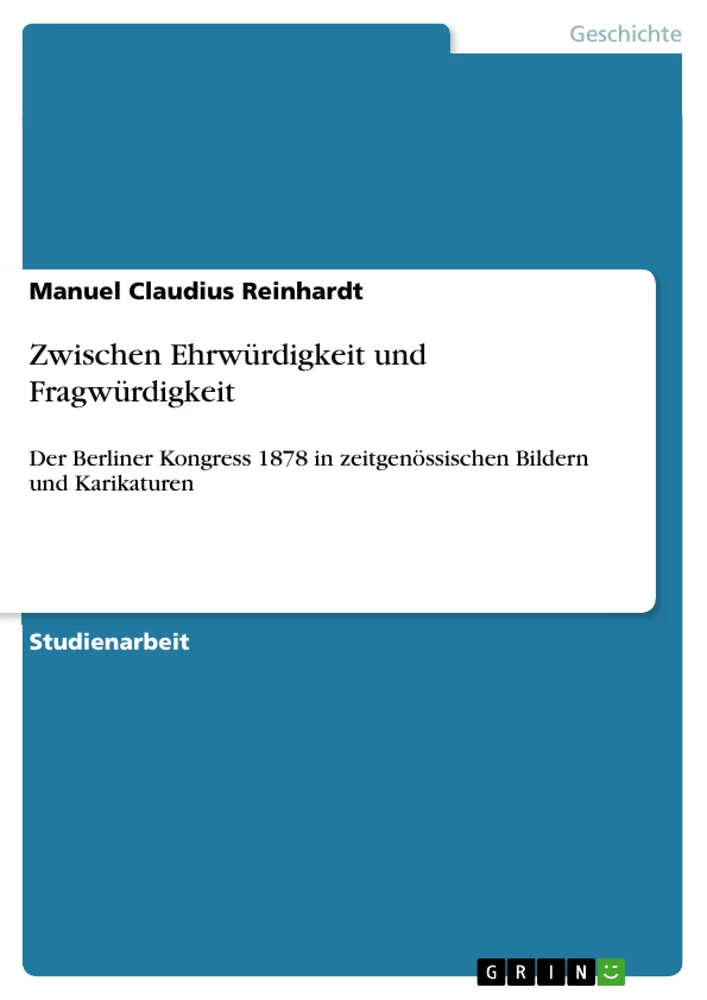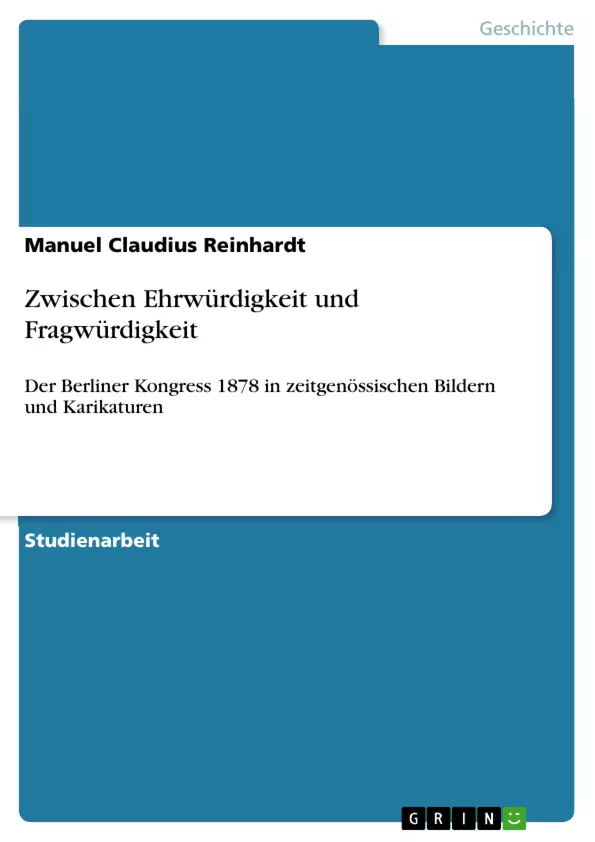„(…) in den aktuellen Geschichtsschulbüchern Europas (hat sich) ein konvergierendes Inventar von etwa 15 "Bildern zur Geschichte" etabliert, dem man offenbar europaweit einen herausragenden historischen Erinnerungs- und Symbolwert zuschreibt (…)“ . Zu diesem „Inventar“ lässt sich nach Ansicht Susanne Popps (zweifelsohne) auch Anton von Werners Gemälde „Der Kongress zu Berlin (Schlusssitzung des Berliner Kongresses am 13. Juli 1878)“ von 1881 zählen. Ein Bild geht um die Welt – von Werners Werk geht allerdings weit über die Darstellungen in Geschichtsschulbüchern hinaus. Die feierliche Enthüllung des Gemäldes im Festsaal des Berliner Rathauses am 22. März 2005 durch den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit zeugt von der Standardisierung des Werkes als (Geschichts)Bild des Berliner Kongres.
Auf der anderen Seite existieren eine Reihe von „anderen Bildern“ des Berliner Kongresses: Karikaturen. Nicht nur in deutschen Zeitungen, Magazinen oder Satirezeitschriften wie beispielsweise dem Kladderadatsch, sondern auch in weiteren europäischen wie auch amerikanischen Zeitschriften war die Konferenz der europäischen Großmächte in Berlin im Sommer 1878 ein beliebtes Ziel zeitgenössischer Karikaturisten. Bereits der Begriff Karikatur impliziert die kritische, meist überzeichnete Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand. Im Gegensatz zu Anton von Werners Gemälde – das, wie wir noch sehen werden, eine durchaus prunkvolle Abschlusssitzung mit großen Gesten und großem Respekt suggeriert – ist in Karikaturen die Vermittlung eines Inhalts bzw. Bildes weniger positiver Wertung zu beobachten. Diese sich hier gegenüberstehenden „Geschichtsbilder“ ein und desselben Ereignisses sollen in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Hieran lässt sich aufzeigen, warum sich das „positive“ Bild – so meine These – , also in diesem Fall von Werners Gemälde, in der Allgemeinheit gegen eher kritische Deutungen durchgesetzt hat. Dies ist im Übrigen nicht nur hier, sondern auch in einer Reihe weiterer Beispiele – so etwas das ebenfalls von Anton von Werner gezeichnete Bild der Reichsgründung 1871 – der Fall. Es ist jedoch unablässig, zunächst auf Bilder und im besonderen Maße auf Karikaturen als historische Quellen einzugehen und sich Fragen nach der Möglichkeit solcher Quellen zur Schaffung eines Geschichtsbildes bzw. zur Abbildung historischer Fakten – historischer Wirklichkeit? – zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Karikaturen und Bilder als historische Quellen: Grundlegende Überlegungen
- 3. Der Berliner Kongress 1878: Kontexterfassung
- 4. Der Berliner Kongress im zeitgenössischen Bild
- 4.1 Anton von Werner
- 4.2 Ein Bild geht um die Welt: Das Gemälde Anton von Werners
- 5. Der Berliner Kongress in zeitgenössischen Karikaturen
- 5.1 „Und ich habs gemacht“: Der Berliner Kongress im Kladderadatsch
- 6. Fazit
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Berliner Kongresses von 1878 in zeitgenössischen Bildern und Karikaturen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen dieses historischen Ereignisses aufzuzeigen und zu analysieren, warum ein bestimmtes Bild – das Gemälde von Anton von Werner – als dominierende Darstellung des Kongresses im öffentlichen Gedächtnis verankert ist. Die Arbeit beleuchtet dabei die Rolle visueller Medien in der Geschichtswissenschaft.
- Die Verwendung von Bildern und Karikaturen als historische Quellen
- Der Vergleich zwischen dem Gemälde von Anton von Werner und zeitgenössischen Karikaturen
- Die Konstruktion von Geschichtsbildern durch visuelle Medien
- Die Bedeutung des historischen Kontextes für die Interpretation von Bildern
- Die Rolle der Medien im öffentlichen Geschichtsdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Anton von Werners Gemälde des Berliner Kongresses aufgrund seiner positiven Darstellung im öffentlichen Bewusstsein als dominierendes Bild des Ereignisses verankert ist, im Gegensatz zu den oft kritischeren Karikaturen. Die Arbeit wird die Gegenüberstellung dieser unterschiedlichen visuellen Darstellungen analysieren, um die Gründe für die Dominanz des positiven Bildes zu untersuchen.
2. Karikaturen und Bilder als historische Quellen: Grundlegende Überlegungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundsätzlichen Frage, ob und inwieweit Bilder und Karikaturen als historische Quellen zur Konstruktion von Geschichtsbildern herangezogen werden können. Es wird argumentiert, dass Bilder einen Eindruck und ein historisches Bewusstsein erzeugen und somit zur Gestaltung von Geschichtsbildern beitragen. Der Kontext der Entstehung, Intention und des Mediums (z.B. Karikatur mit ihrem satirischen Charakter) muss jedoch bei der Interpretation berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Berliner Kongress 1878, Geschichtsbilder, visuelle Medien, Karikaturen, Anton von Werner, historische Quellen, Bildinterpretation, öffentliches Gedächtnis, politische Karikatur, Geschichtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: "Der Berliner Kongress 1878 in Bildern und Karikaturen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Darstellung des Berliner Kongresses von 1878 in zeitgenössischen Bildern und Karikaturen. Im Mittelpunkt steht der Vergleich zwischen dem Gemälde von Anton von Werner und kritischen Karikaturen der Zeit, um zu verstehen, warum Werners Werk im öffentlichen Gedächtnis als dominierende Darstellung des Kongresses verankert ist.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Berliner Kongresses, die in den visuellen Medien zum Ausdruck kommen. Sie beleuchtet die Rolle von Bildern und Karikaturen als historische Quellen und analysiert die Konstruktion von Geschichtsbildern durch visuelle Medien. Ein zentrales Ziel ist es, die Bedeutung des historischen Kontextes für die Interpretation von Bildern zu verdeutlichen und den Einfluss der Medien auf den öffentlichen Geschichtsdiskurs zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Karikaturen und Bilder als historische Quellen, Der Berliner Kongress 1878: Kontexterfassung, Der Berliner Kongress im zeitgenössischen Bild (inkl. Unterkapitel zu Anton von Werner und seinem Gemälde), Der Berliner Kongress in zeitgenössischen Karikaturen (inkl. Unterkapitel zum Kladderadatsch), Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Rolle spielt Anton von Werners Gemälde?
Anton von Werners Gemälde des Berliner Kongresses ist ein zentraler Gegenstand der Analyse. Die Arbeit untersucht, warum dieses positive Bild im öffentlichen Bewusstsein als dominierende Darstellung des Ereignisses verankert ist, im Gegensatz zu den oft kritischeren Karikaturen der Zeit. Der Vergleich zwischen dem Gemälde und den Karikaturen bildet den Kern der Argumentation.
Wie werden Bilder und Karikaturen als historische Quellen behandelt?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Verwendung von Bildern und Karikaturen als historische Quellen. Es wird betont, dass der Kontext der Entstehung, die Intention des Künstlers und der spezifische Charakter des Mediums (z.B. die satirische Natur von Karikaturen) bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Berliner Kongress 1878, Geschichtsbilder, visuelle Medien, Karikaturen, Anton von Werner, historische Quellen, Bildinterpretation, öffentliches Gedächtnis, politische Karikatur, und Geschichtswissenschaft.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die positive Darstellung des Berliner Kongresses in Anton von Werners Gemälde zu dessen Dominanz im öffentlichen Gedächtnis geführt hat, im Gegensatz zu den oft kritischeren und differenzierteren Perspektiven, die in zeitgenössischen Karikaturen zum Ausdruck kommen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte des Berliner Kongresses, der Rolle visueller Medien in der Geschichtswissenschaft und der Konstruktion von Geschichtsbildern auseinandersetzen.
- Quote paper
- Manuel Claudius Reinhardt (Author), 2007, Zwischen Ehrwürdigkeit und Fragwürdigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83992