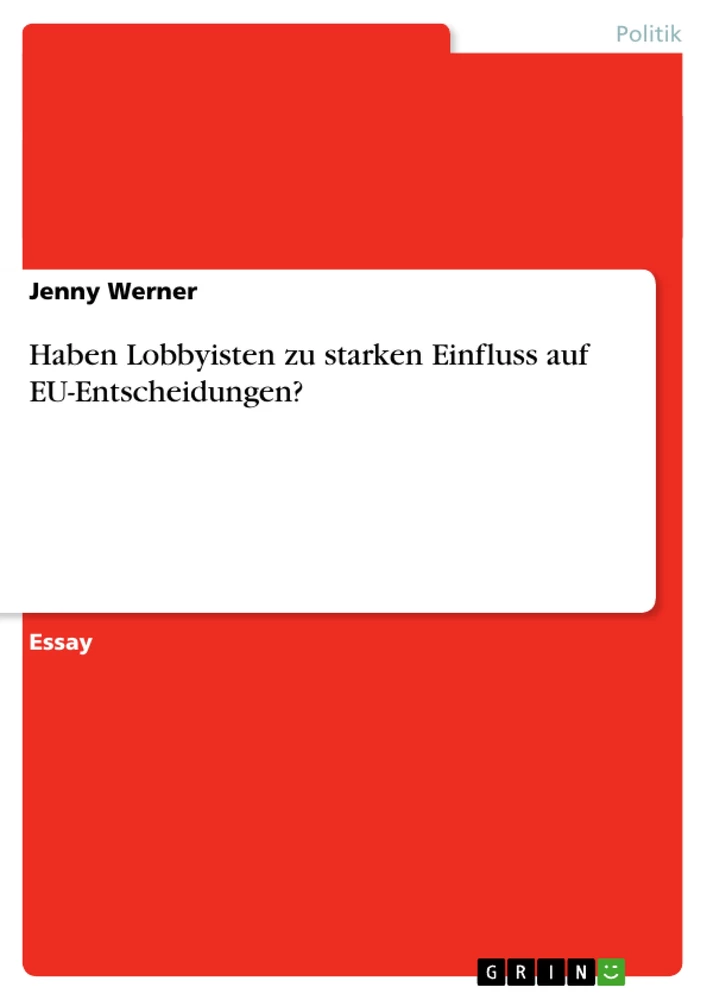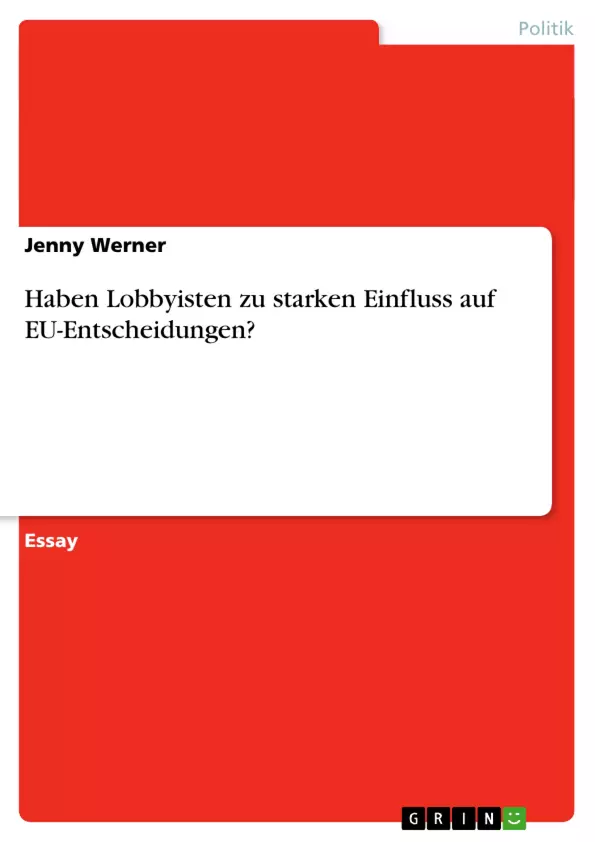Der folgende Essay beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob Lobbyisten zu starken Einfluss auf EU-Entscheidungen nehmen. Lobbyismus ist keine Neuerscheinung am politischen Horizont, sondern entstand Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Versuche von Wirtschaftsvertretern, Abgeordnete in der Vorhalle des „Willard Hotels“ in Washington D.C. zu beeinflussen. Aus dem englischen Wort „lobby“(Vorhalle), wurde dann Lobbyist. Nach Hans Merkle ist eine zeitgemäße Definition von Lobbying: „Die zielgerichtete Beeinflussung von Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung“. Mittlerweile werden 84 Prozent der neuen Gesetze in Brüssel verabschiedet, deswegen nimmt der EU-Lobbyismus eine immer wichtiger werdende Rolle ein und auf allen Ebenen des Gesetzgebungsprozess wird der Versuch EUEntscheidungen zu beeinflussen, betrieben. Wo genau die Grenze zwischen legitimer Partizipation, die durch das Grundgesetz geschützt ist und illegaler Nötigung, Korruption und Erpressung liegt, soll im nächsten Abschnitt anhand von bestimmten Kriterien erläutert werden, die es ermöglichen Licht in diese Grauzone zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Haben Lobbyisten zu starken Einfluss auf EU-Entscheidungen?
- Lobbyismus - Eine Definition
- Die Bedeutung des EU-Lobbyismus
- Die Grauzone zwischen legitimer Partizipation und illegaler Nötigung
- Die Aktionsformen des Lobbyismus
- Information und Kommunikation
- Personelle Penetration
- Politikfinanzierung
- Politische Pression
- Transparenz als Mittel zur Erhellung der Grauzone
- Die Rolle des „gläsernen Abgeordneten“
- Registrierungspflicht für Lobbyisten
- Finanzielle Unterstützung für unterprivilegierte Gruppen
- Mindeststandards für die Zusammenarbeit von Lobbyisten und Abgeordneten
- Karenzzeiten für Politiker
- Regulierung der Politikfinanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert den Einfluss von Lobbyisten auf EU-Entscheidungen und untersucht die Grauzone zwischen legitimer Partizipation und illegaler Beeinflussung.
- Definition und Entwicklung des Lobbyismus
- Relevanz des EU-Lobbyismus in der Entscheidungsfindung
- Kriterien zur Unterscheidung zwischen legalem und illegalem Lobbyismus
- Mögliche Gefahren des Lobbyismus für die Demokratie
- Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz und Regulierung des Lobbyismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil des Essays definiert Lobbyismus und beschreibt seine Bedeutung im Kontext der EU-Entscheidungsfindung. Er stellt fest, dass der EU-Lobbyismus eine zunehmende Rolle spielt und die Grenze zwischen legitimer Partizipation und illegaler Beeinflussung schwer zu ziehen ist.
- Der zweite Teil beleuchtet verschiedene Aktionsformen des Lobbyismus und bewertet deren Potenzial für legale und illegale Beeinflussung. Die vier Aktionsformen sind Information und Kommunikation, personelle Penetration, Politikfinanzierung und politische Pression.
- Der dritte Teil des Essays argumentiert, dass Transparenz der Schlüssel zur Erhellung der Grauzone zwischen legalem und illegalem Lobbyismus ist. Er präsentiert verschiedene Maßnahmen, die in der EU zur Erhöhung der Transparenz und Regulierung des Lobbyismus eingesetzt werden, wie die Registrierungspflicht für Lobbyisten, die finanzielle Unterstützung für unterprivilegierte Gruppen und die Einführung von Karenzzeiten für Politiker.
Schlüsselwörter
Lobbyismus, EU-Entscheidungen, Partizipation, Nötigung, Korruption, Transparenz, Regulierung, Politikfinanzierung, Interessensorganisationen, Demokratiedefizit, „gläserner Abgeordneter“
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Lobbyismus heute definiert?
Nach Hans Merkle ist Lobbyismus die „zielgerichtete Beeinflussung von Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung“ durch Interessengruppen.
Warum ist Lobbyismus in der EU besonders relevant?
Da mittlerweile ca. 84 Prozent der neuen Gesetze in Brüssel verabschiedet werden, konzentrieren sich Lobbyisten verstärkt auf die europäischen Institutionen.
Wo liegt die Grenze zwischen legalem Lobbyismus und Korruption?
Die Grenze ist oft eine Grauzone. Legitime Partizipation ist grundgesetzlich geschützt, während illegale Nötigung, Bestechung oder Erpressung strafbar sind.
Was sind typische Aktionsformen von Lobbyisten?
Dazu gehören Information und Kommunikation, personelle Penetration (Seitenwechsler), Politikfinanzierung und politischer Druck (Pression).
Wie kann Transparenz im EU-Lobbyismus verbessert werden?
Maßnahmen wie eine verpflichtende Registrierungspflicht, Karenzzeiten für Politiker (Abkühlphasen) und die Offenlegung von Nebeneinkünften („gläserner Abgeordneter“) werden diskutiert.
- Citar trabajo
- Jenny Werner (Autor), 2007, Haben Lobbyisten zu starken Einfluss auf EU-Entscheidungen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84040