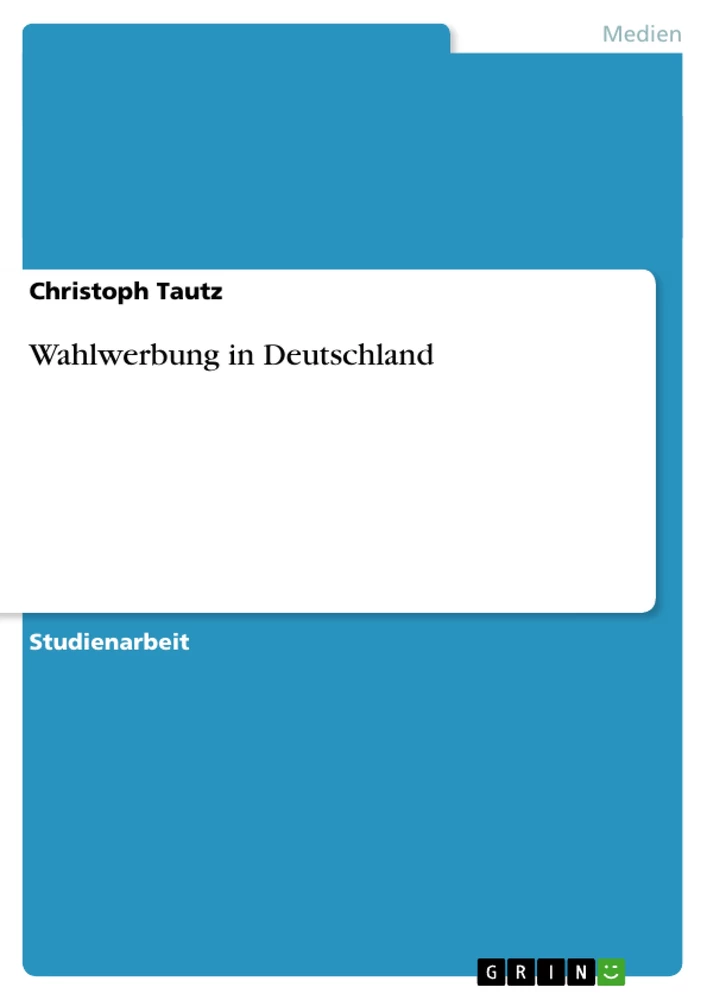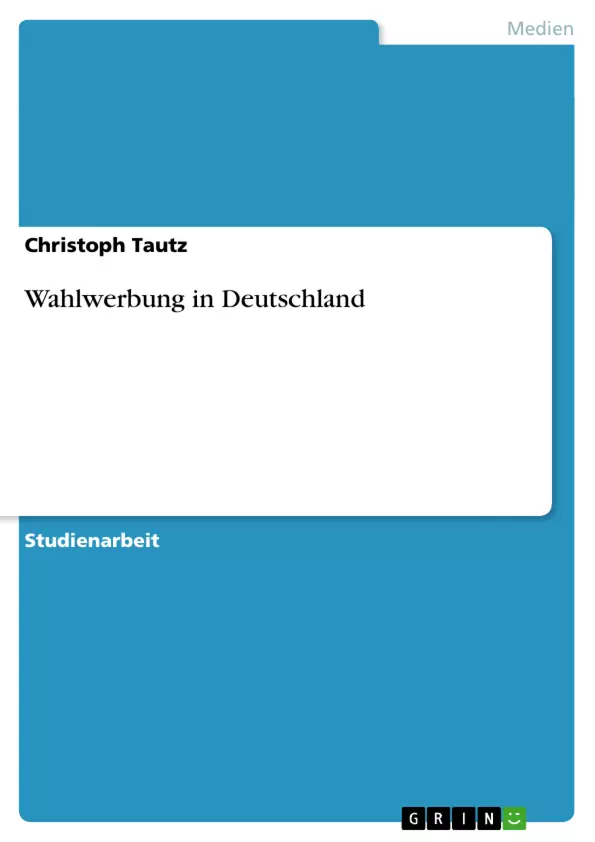In den Zeiten von Hartz IV, über fünf Millionen Arbeitslosen, einer immer größer werdenden Zahl von nichtintegrierbaren ethnischen Minderheiten mit deutschem Pass und einem stark nachlassenden Interesse an Politik, nimmt das Fernsehen eine immer bedeutendere Rolle im Wahlkampf ein. Während die Menschen früher vor Bundestagswahlen Wahlkampfauftritte besucht und in ihrem Bekanntenkreis über Politik diskutiert haben, lassen sich die Deutschen heute von Angeboten mit nur mageren politischen Inhalten im Fernsehen berieseln. Die meisten Zuschauer bleiben nur dann hängen, wenn die politischen Themen polarisieren oder wenn ihnen Politik in schon vorverdauten leicht verständlichen Häppchen serviert wird, Politik light sozusagen. Über diese Medialisierung der Politik sind sich auch Politiker und Parteien bewusst. Doch statt sich zusammenzuschließen und der Bevölkerung wieder Vertrauen in die Politik zu schenken, hat man sich auf die neue Situation eingestellt und versucht sie sich zu Nutze zu machen. Viele Studien belegen, dass das Fernsehen bei Bundestagswahlen mittlerweile die besten Möglichkeiten bietet, die Rezipienten wahlentscheidend zu beeinflussen. Mit einem einzigen Auftritt oder einer Ausstrahlung wird direkt ein großer Personenkreis angesprochen. Um das Fernsehen für wahlkampfdienliche Zwecke zu nutzen, gibt es viele Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten ist die Wahlwerbung. In der vorliegenden Arbeit werde ich die Wahlwerbung in der Bundesrepublik Deutschland untersuchen. Dabei werde ich zunächst auf die historische Entwicklung dieser Sonderwerbeform eingehen. Anschließend werde ich einige gesetzliche Regelungen zum heutigen Stand der Dinge erläutern. Außerdem werde ich die verschiedenen Formen von Wahlwerbung beschreiben und deren Ziele und Strategien darlegen, bevor ich mit einem kurzen Fazit abschließe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklung der Wahlwerbung in Deutschland
- 2.1 Aller Anfang ist schwer (1949 – 1987)
- 2.2 Neue Möglichkeiten durch private Medien (1987 – 1992)
- 2.3 „Klare Regeln“ ab 1992
- 3. Wer darf wie oft und wann?
- 4. Formen der Wahlwerbung
- 5. Ziele und Strategien der Wahlwerbung
- 5.1 Personalisierung
- 5.2 Image-Konstruktion
- 5.3 Negative Campaigning
- 5.4 (De)Thematisierung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahlwerbung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Zielsetzung besteht darin, die historische Entwicklung dieser Werbeform zu beleuchten, geltendes Recht zu erläutern und verschiedene Formen, Ziele und Strategien der Wahlwerbung zu beschreiben.
- Historische Entwicklung der Wahlwerbung in Deutschland
- Gesetzliche Regelungen und Rahmenbedingungen
- Formen der Wahlwerbung
- Ziele und Strategien der Wahlwerbung (Personalisierung, Image-Konstruktion, Negative Campaigning, (De)Thematisierung)
- Der Einfluss des Fernsehens auf den Wahlkampf
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund des Wandels im Wahlkampf durch die zunehmende Bedeutung des Fernsehens. Sie argumentiert, dass sich Politiker der Medialisierung der Politik bewusst sind und diese für wahlkampfdienliche Zwecke nutzen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Wahlwerbung in Deutschland an, inklusive ihrer historischen Entwicklung, gesetzlicher Regelungen, Formen, Ziele und Strategien.
2. Die Entwicklung der Wahlwerbung in Deutschland: Dieses Kapitel zeichnet die Geschichte der Wahlwerbung in Deutschland nach, beginnend mit der ersten Bereitstellung von Sendezeit für politische Parteien im Jahr 1924. Es beschreibt die frühen Jahre, die rechtlichen Auseinandersetzungen, die Entwicklung von Richtlinien und Regelungen, den Einfluss des Fernsehens und die Herausforderungen durch private Medien. Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Entwicklung von gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Kampf um Chancengleichheit für alle Parteien im Zugang zu den Medien.
2.1 Aller Anfang ist schwer (1949 – 1987): Dieser Abschnitt detailliert die Herausforderungen und rechtlichen Auseinandersetzungen im Umgang mit Wahlwerbung im Nachkriegsdeutschland. Er beschreibt das frühe Engagement von Parteien im Hörfunk und Fernsehen und die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die den Parteien den Zugang zu Sendezeit garantierten, jedoch nicht einen Anspruch darauf etablierten. Die Bedeutung des Prinzips der Chancengleichheit und die ersten rechtlichen Bestimmungen werden hervorgehoben.
2.2 Neue Möglichkeiten durch private Medien (1987 – 1992): Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des Aufkommens privater Medien auf die Wahlwerbung. Es beschreibt die Notwendigkeit neuer Regelungen und die kontroverse Nutzung kommerzieller Werbezeiten durch Parteien. Die Reaktion der Landesmedienanstalten und die daraus resultierenden Einschränkungen für die Platzierung von Parteienwerbung in regulären Werbeblöcken werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Anpassung an neue mediale Realitäten und den damit verbundenen Herausforderungen für die Regulierung.
Schlüsselwörter
Wahlwerbung, Deutschland, Medien, Fernsehen, Politik, Parteien, Gesetzgebung, Chancengleichheit, Wahlkampf, Rundfunk, private Medien, öffentliche Medien, Geschichte der Wahlwerbung, Regulierung, Werbestrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Wahlwerbung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Wahlwerbung in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, den gesetzlichen Regelungen, den verschiedenen Formen, Zielen und Strategien der Wahlwerbung, sowie dem Einfluss des Fernsehens.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die historische Entwicklung der Wahlwerbung in Deutschland (von 1949 bis heute), die geltenden Gesetze und Rahmenbedingungen, die verschiedenen Formen der Wahlwerbung, die Strategien der Wahlwerbung (Personalisierung, Image-Konstruktion, Negative Campaigning, (De)Thematisierung) und der Einfluss der Medien, insbesondere des Fernsehens, auf den Wahlkampf.
Wie ist die historische Entwicklung der Wahlwerbung dargestellt?
Die historische Entwicklung wird in drei Phasen unterteilt: die frühen Jahre (1949-1987) mit den Herausforderungen und rechtlichen Auseinandersetzungen um Sendezeit; die Zeit nach dem Aufkommen privater Medien (1987-1992) mit neuen Herausforderungen für die Regulierung; und die Zeit ab 1992 mit „klaren Regeln“. Der Fokus liegt auf dem Kampf um Chancengleichheit für alle Parteien im Zugang zu den Medien.
Welche gesetzlichen Regelungen werden behandelt?
Das Dokument erläutert die gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen für Wahlwerbung in Deutschland. Es beschreibt die rechtlichen Auseinandersetzungen, die Entwicklung von Richtlinien und Regelungen, und die Anpassung an neue mediale Realitäten. Die Bedeutung des Prinzips der Chancengleichheit wird hervorgehoben.
Welche Formen, Ziele und Strategien der Wahlwerbung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Formen der Wahlwerbung und analysiert Strategien wie Personalisierung, Image-Konstruktion, Negative Campaigning und (De)Thematisierung. Es wird untersucht, wie diese Strategien eingesetzt werden, um die Ziele der Parteien im Wahlkampf zu erreichen.
Welchen Einfluss hat das Fernsehen auf den Wahlkampf?
Der Einfluss des Fernsehens auf den Wahlkampf wird als bedeutender Faktor behandelt. Das Dokument analysiert, wie die Medialisierung der Politik von Parteien für wahlkampfdienliche Zwecke genutzt wird und wie sich die zunehmende Bedeutung des Fernsehens auf die Entwicklung der Wahlwerbung ausgewirkt hat.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wahlwerbung, Deutschland, Medien, Fernsehen, Politik, Parteien, Gesetzgebung, Chancengleichheit, Wahlkampf, Rundfunk, private Medien, öffentliche Medien, Geschichte der Wahlwerbung, Regulierung, Werbestrategien.
- Quote paper
- Bachelor of Arts in Social Science Christoph Tautz (Author), 2004, Wahlwerbung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84112