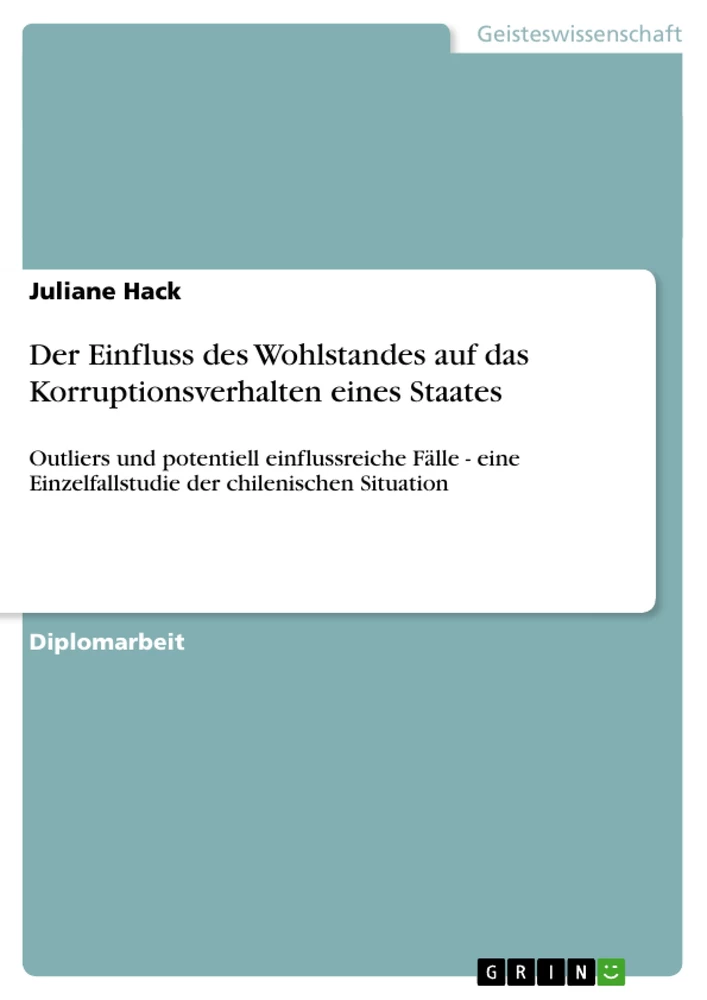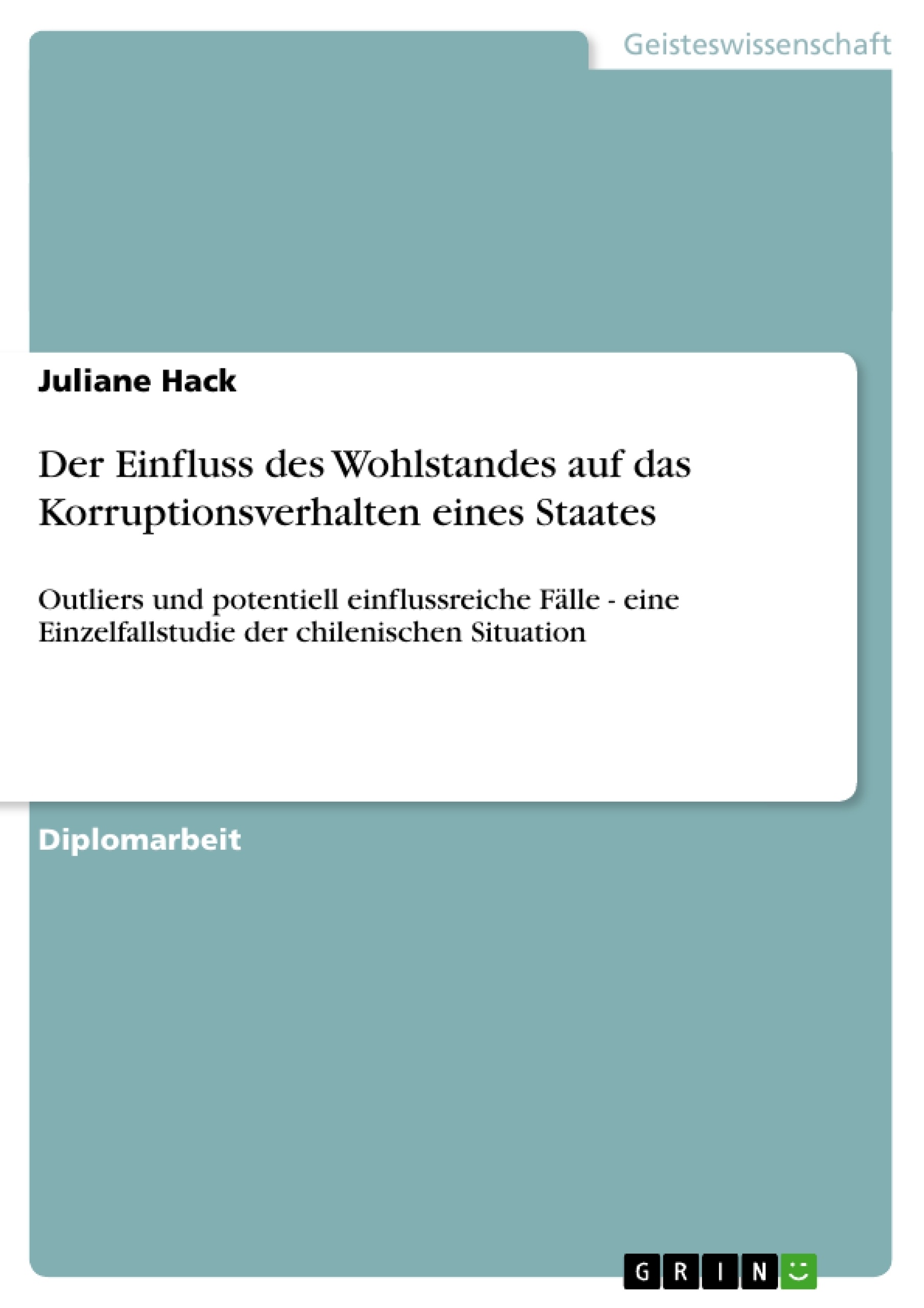In über 2000 Jahren, die seit dieser Aussage Ciceros vergangen sind, hat sich
offensichtlich wenig im menschlichen Verhalten geändert: Aktuelle Nachrichten
melden Korruption in der Vorstandsetage des VW-Konzerns, gekaufte
Sportsendungen beim MDR und Schmiergelderzahlungen von Siemens und
DaimlerChrysler an die ehemalige irakische Regierung. Dem Zuhörer kommen
weitere deutsche Skandale der letzten Jahre wie die Waffenlieferungen des
Lobbyisten Schreiber, die CDU-Spendengeldaffäre oder der Sumpf um den Bau
der Kölner Müllverbrennungsanlage in den Sinn. Es entsteht ein ungutes
Gefühl, bereicherten sich doch in allen Fällen wenige Personen heimlich und
unrechtmäßig auf Kosten ihrer Firmen oder der Bevölkerung mittels Korruption.
Was genau versteht man aber unter dieser? Wie läuft solch ein korrupter
Handel ab? Welche Konsequenzen entstehen dabei für eine Gesellschaft?
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit diesen theoretischen
Fragestellungen. Er führt in die Grundlagen der Korruption aus
wissenschaftlicher Sicht ein. Ausgehend vom Begriff der Korruption, dessen
Definition noch immer für Diskussionsstoff zwischen Forschern sorgt, werden
verschiedene Grundformen vorgestellt. Im Rahmen einer soziologischen
Modellierung wird danach das Phänomen auf der Mikro- und Makroebene eines
Systems beleuchtet. Als multidimensionales Phänomen wird Korruption in
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhang gebracht,
zu diesen Teilbereichen werden wichtige Ergebnisse der aktuellen Forschung
aufgezeigt. Abschließend wird das Thema „Ist Korruption schädlich?“
angesprochen, indem Vor- und Nachteilen der Korruption gegenübergestellt
werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS FORSCHUNGSTHEMA KORRUPTION
- Der Begriff Korruption
- Formen politischer Korruption
- Korruption im Mehrebenenmodell
- Die Mechanismen individuellen Korruptionsverhaltens
- Vom Mikrophänomen zur Institutionalisierung der Korruption
- Ursachen und Konsequenzen der Korruption
- Politikwissenschaftliche Überlegungen
- Ökonomische Zusammenhänge
- Soziologische Zusammenhänge
- Vor- und Nachteile der Korruption
- DIE MESSUNG VON KORRUPTION
- Die Fälle des CPI 1995 bis 2004
- Ein Überblick über die Verteilung der Staaten im CPI
- Die Berechnung eines Zusammenhangs zwischen Wohlstand und Korruptionsniveau
- Operationalisierung der Begriffe und Vorgehensweise
- Analyse der Fälle in den Streuungsdiagrammen
- Die Ausreißer der Regressionsgeraden
- Die Ausreißer im standardisierten Abweichungsbereich unter dem Wert –2.0
- Die Ausreißer im standardisierten Abweichungsbereich über dem Wert +2.0
- Die Analyse einflussreicher Fälle mit dem standardisierten DFBETA-Wert
- Fazit der Regressionsanalyse
- DIE EINZELFALLANALYSE DER CHILENISCHEN SITUATION
- Das südamerikanische Umfeld
- Die CPI-Daten der südamerikanischen Länder
- Allgemeine Erklärungen für die Entwicklung hoher Korruption in Südamerika
- Chiles historische Entwicklung
- Korruption in Chile
- Chiles Abweichen vom Standardfall eines südamerikanischen Landes
- Antikorruptionsmechanismen in der chilenischen Demokratie
- Das Justizsystem
- Die Medien
- Die Zivilgesellschaft
- Die zugrundeliegende Wirtschaftsethik Chiles
- Fazit der Einzelfallanalyse Chiles
- CHILE ALS VORBILD FÜR KORRUPTE LÄNDER
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Wohlstand eines Staates und dessen Korruptionsverhalten.
- Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen und Formen politischer Korruption.
- Es wird ein Modell des „principal-agent approach“ vorgestellt, um individuelles Korruptionsverhalten zu erklären.
- Die Arbeit stellt die wichtigsten politikwissenschaftlichen, ökonomischen und soziologischen Erkenntnisse zur Korruption dar.
- Der Corruption Perceptions Index (CPI) wird als Instrument zur Messung von Korruption vorgestellt und analysiert.
- Es werden Ausreißer und einflussreiche Fälle in einer Regressionsanalyse des Zusammenhangs von Wohlstand und Korruption untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Korruption am Beispiel aktueller Skandale dar und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
Das erste Kapitel bietet einen theoretischen Einblick in die allgemeine Korruptionsforschung und stellt verschiedene Definitionen und Formen politischer Korruption dar. Es wird auf die Mechanismen individuellen Korruptionsverhaltens und die Institutionalisierung des Phänomens eingegangen, sowie wichtige Ursachen und Konsequenzen von Korruption aus politikwissenschaftlicher, ökonomischer und soziologischer Perspektive dargestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Messung von Korruption. Der Corruption Perceptions Index (CPI) wird als relevanteste Art der internationalen Messung präsentiert und dessen methodische Stärken und Schwächen analysiert. Es wird die Verteilung der Staaten im CPI betrachtet und der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Korruptionsniveau mittels einer Regressionsanalyse untersucht.
Das dritte Kapitel widmet sich der Einzelfallanalyse Chiles und untersucht die Gründe für das niedrige Korruptionsniveau des Landes trotz vergleichsweise niedrigem Wohlstand. Es werden die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Chiles im Vergleich zum restlichen Südamerika dargestellt.
Das vierte Kapitel fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zeigt die Relevanz des chilenischen Beispiels für andere Länder mit hoher Korruption auf. Es werden die Wichtigkeit von demokratischen Reformen, die Stärkung der Institutionen und die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Folgen von Korruption betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Korruption, Wohlstand, Corruption Perceptions Index (CPI), Regressionsanalyse, Einzelfallanalyse, Chile, Südamerika, Politikwissenschaft, Ökonomie, Soziologie, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Zivilgesellschaft, Wirtschaftsethik.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Wohlstand und Korruption zusammen?
Die Arbeit untersucht mittels Regressionsanalyse den statistischen Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt eines Staates und seinem Korruptionsniveau laut Corruption Perceptions Index (CPI).
Was ist der Corruption Perceptions Index (CPI)?
Der CPI ist ein Instrument von Transparency International, das die wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor von Ländern weltweit misst und vergleicht.
Warum gilt Chile als Vorbild bei der Korruptionsbekämpfung?
Trotz eines vergleichsweise niedrigeren Wohlstands weist Chile ein sehr geringes Korruptionsniveau auf, was auf starke Institutionen, Medienfreiheit und eine ausgeprägte Wirtschaftsethik zurückgeführt wird.
Was ist der "Principal-Agent-Approach"?
Dies ist ein Modell zur Erklärung individuellen Korruptionsverhaltens, bei dem ein Agent (z. B. Beamter) seinen Spielraum nutzt, um auf Kosten des Prinzipals (z. B. Staat/Bevölkerung) eigene Vorteile zu erlangen.
Welche Konsequenzen hat Korruption für eine Gesellschaft?
Korruption führt zu wirtschaftlicher Ineffizienz, sozialer Ungerechtigkeit und untergräbt das Vertrauen in demokratische und rechtsstaatliche Institutionen.
- Quote paper
- Juliane Hack (Author), 2005, Der Einfluss des Wohlstandes auf das Korruptionsverhalten eines Staates, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84221